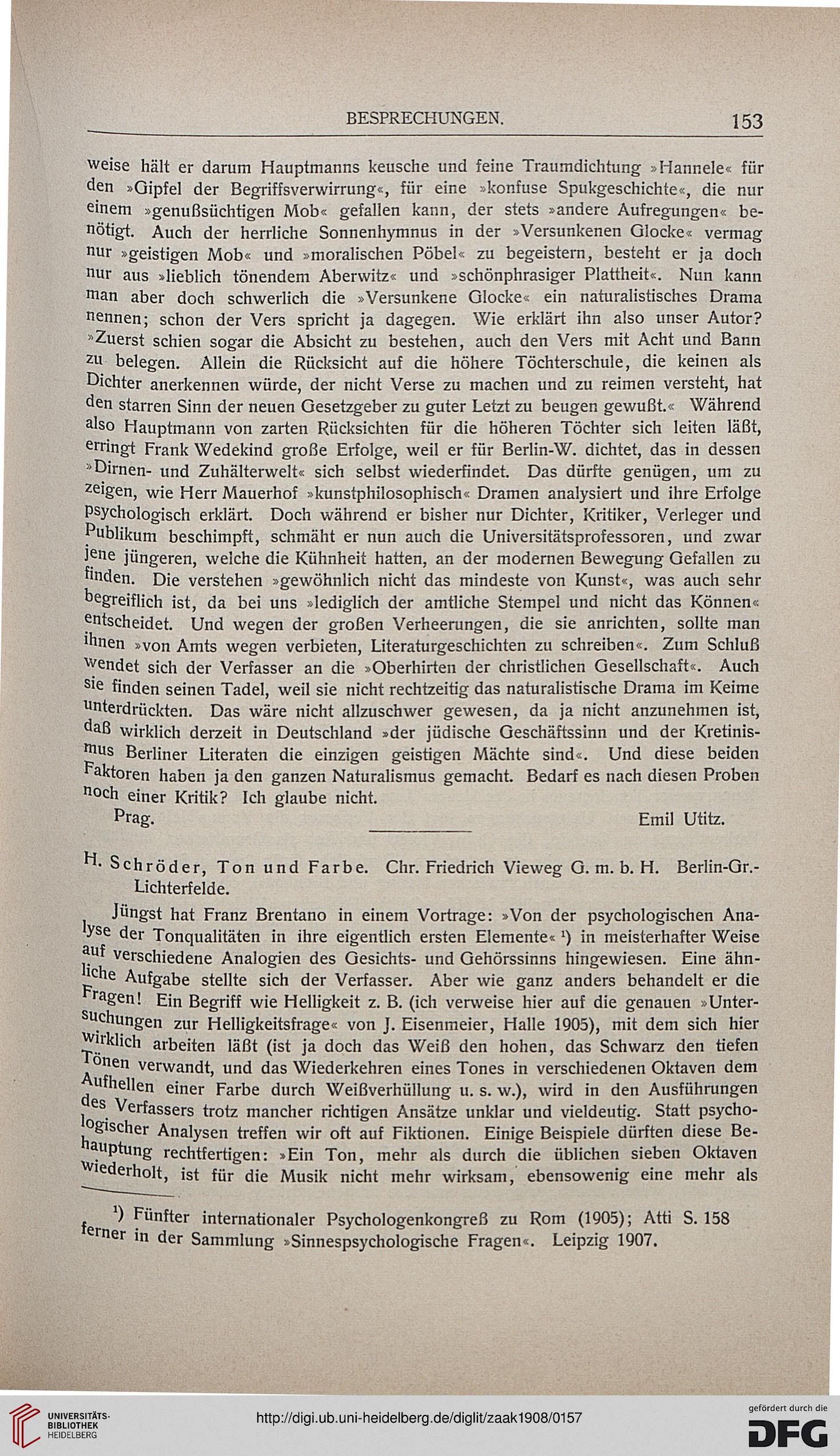BESPRECHUNGEN. 153
weise hält er darum Hauptmanns keusche und feine Traumdichtung »Hannele« für
den »Gipfel der Begriffsverwirrung«, für eine »konfuse Spukgeschichte«, die nur
einem »genußsüchtigen Mob« gefallen kann, der stets »andere Aufregungen« be-
nötigt. Auch der herrliche Sonnenhymnus in der »Versunkenen Glocke« vermag
nur »geistigen Mob« und »moralischen Pöbel« zu begeistern, besteht er ja doch
nur aus »lieblich tönendem Aberwitz« und »schönphrasiger Plattheit«. Nun kann
man aber doch schwerlich die »Versunkene Glocke« ein naturalistisches Drama
nennen; schon der Vers spricht ja dagegen. Wie erklärt ihn also unser Autor?
»Zuerst schien sogar die Absicht zu bestehen, auch den Vers mit Acht und Bann
zu belegen. Allein die Rücksicht auf die höhere Töchterschule, die keinen als
Dichter anerkennen würde, der nicht Verse zu machen und zu reimen versteht, hat
den starren Sinn der neuen Gesetzgeber zu guter Letzt zu beugen gewußt.« Während
also Hauptmann von zarten Rücksichten für die höheren Töchter sich leiten läßt,
erringt Frank Wedekind große Erfolge, weil er für Berlin-W. dichtet, das in dessen
»Dirnen- und Zuhälterwelt« sich selbst wiederfindet. Das dürfte genügen, um zu
zeigen, wie Herr Mauerhof »kunstphilosophisch« Dramen analysiert und ihre Erfolge
Psychologisch erklärt. Doch während er bisher nur Dichter, Kritiker, Verleger und
1 ublikum beschimpft, schmäht er nun auch die Universitätsprofessoren, und zwar
Jene jüngeren, welche die Kühnheit hatten, an der modernen Bewegung Gefallen zu
nnden. Die verstehen »gewöhnlich nicht das mindeste von Kunst«, was auch sehr
begreiflich ist, da bei uns »lediglich der amtliche Stempel und nicht das Können«
entscheidet. Und wegen der großen Verheerungen, die sie anrichten, sollte man
•nnen »von Amts wegen verbieten, Literaturgeschichten zu schreiben«. Zum Schluß
wendet sich der Verfasser an die »Oberhirten der christlichen Gesellschaft«. Auch
s'e finden seinen Tadel, weil sie nicht rechtzeitig das naturalistische Drama im Keime
unterdrückten. Das wäre nicht allzuschwer gewesen, da ja nicht anzunehmen ist,
daß wirklich derzeit in Deutschland »der jüdische Geschäftssinn und der Kretinis-
nius Berliner Literaten die einzigen geistigen Mächte sind«. Und diese beiden
aktoren haben ja den ganzen Naturalismus gemacht. Bedarf es nach diesen Proben
noch einer Kritik? Ich glaube nicht.
Prag. __________ Emil Utitz.
**• Schröder, Ton und Farbe. Chr. Friedrich Vieweg G.m.b.H. Berlin-Gr.-
Lichterfelde.
Jüngst hat Franz Brentano in einem Vortrage: »Von der psychologischen Ana-
yse der Tonqualitäten in ihre eigentlich ersten Elemente«') in meisterhafter Weise
» verschiedene Analogien des Gesichts- und Gehörssinns hingewiesen. Eine ähn-
cne Aufgabe stellte sich der Verfasser. Aber wie ganz anders behandelt er die
ragen! Ein Begriff wie Helligkeit z. B. (ich verweise hier auf die genauen »Unter-
uchungen zur Helligkeitsfrage« von J. Eisenmeier, Halle 1905), mit dem sich hier
Wirklich arbeiten läßt (ist ja doch das Weiß den hohen, das Schwarz den tiefen
onen verwandt, und das Wiederkehren eines Tones in verschiedenen Oktaven dem
ufhellen einer Farbe durch Weißverhüllung u. s. w.), wird in den Ausführungen
es Verfassers trotz mancher richtigen Ansätze unklar und vieldeutig. Statt psycho-
tischer Analysen treffen wir oft auf Fiktionen. Einige Beispiele dürften diese Be-
auptung rechtfertigen: »Ein Ton, mehr als durch die üblichen sieben Oktaven
■ederholt, ist für die Musik nicht mehr wirksam, ebensowenig eine mehr als
{ ') Fünfter internationaler Psychologenkongreß zu Rom (1905); Atti S. 158
rner in der Sammlung »Sinnespsychologische Fragen«. Leipzig 1907.
weise hält er darum Hauptmanns keusche und feine Traumdichtung »Hannele« für
den »Gipfel der Begriffsverwirrung«, für eine »konfuse Spukgeschichte«, die nur
einem »genußsüchtigen Mob« gefallen kann, der stets »andere Aufregungen« be-
nötigt. Auch der herrliche Sonnenhymnus in der »Versunkenen Glocke« vermag
nur »geistigen Mob« und »moralischen Pöbel« zu begeistern, besteht er ja doch
nur aus »lieblich tönendem Aberwitz« und »schönphrasiger Plattheit«. Nun kann
man aber doch schwerlich die »Versunkene Glocke« ein naturalistisches Drama
nennen; schon der Vers spricht ja dagegen. Wie erklärt ihn also unser Autor?
»Zuerst schien sogar die Absicht zu bestehen, auch den Vers mit Acht und Bann
zu belegen. Allein die Rücksicht auf die höhere Töchterschule, die keinen als
Dichter anerkennen würde, der nicht Verse zu machen und zu reimen versteht, hat
den starren Sinn der neuen Gesetzgeber zu guter Letzt zu beugen gewußt.« Während
also Hauptmann von zarten Rücksichten für die höheren Töchter sich leiten läßt,
erringt Frank Wedekind große Erfolge, weil er für Berlin-W. dichtet, das in dessen
»Dirnen- und Zuhälterwelt« sich selbst wiederfindet. Das dürfte genügen, um zu
zeigen, wie Herr Mauerhof »kunstphilosophisch« Dramen analysiert und ihre Erfolge
Psychologisch erklärt. Doch während er bisher nur Dichter, Kritiker, Verleger und
1 ublikum beschimpft, schmäht er nun auch die Universitätsprofessoren, und zwar
Jene jüngeren, welche die Kühnheit hatten, an der modernen Bewegung Gefallen zu
nnden. Die verstehen »gewöhnlich nicht das mindeste von Kunst«, was auch sehr
begreiflich ist, da bei uns »lediglich der amtliche Stempel und nicht das Können«
entscheidet. Und wegen der großen Verheerungen, die sie anrichten, sollte man
•nnen »von Amts wegen verbieten, Literaturgeschichten zu schreiben«. Zum Schluß
wendet sich der Verfasser an die »Oberhirten der christlichen Gesellschaft«. Auch
s'e finden seinen Tadel, weil sie nicht rechtzeitig das naturalistische Drama im Keime
unterdrückten. Das wäre nicht allzuschwer gewesen, da ja nicht anzunehmen ist,
daß wirklich derzeit in Deutschland »der jüdische Geschäftssinn und der Kretinis-
nius Berliner Literaten die einzigen geistigen Mächte sind«. Und diese beiden
aktoren haben ja den ganzen Naturalismus gemacht. Bedarf es nach diesen Proben
noch einer Kritik? Ich glaube nicht.
Prag. __________ Emil Utitz.
**• Schröder, Ton und Farbe. Chr. Friedrich Vieweg G.m.b.H. Berlin-Gr.-
Lichterfelde.
Jüngst hat Franz Brentano in einem Vortrage: »Von der psychologischen Ana-
yse der Tonqualitäten in ihre eigentlich ersten Elemente«') in meisterhafter Weise
» verschiedene Analogien des Gesichts- und Gehörssinns hingewiesen. Eine ähn-
cne Aufgabe stellte sich der Verfasser. Aber wie ganz anders behandelt er die
ragen! Ein Begriff wie Helligkeit z. B. (ich verweise hier auf die genauen »Unter-
uchungen zur Helligkeitsfrage« von J. Eisenmeier, Halle 1905), mit dem sich hier
Wirklich arbeiten läßt (ist ja doch das Weiß den hohen, das Schwarz den tiefen
onen verwandt, und das Wiederkehren eines Tones in verschiedenen Oktaven dem
ufhellen einer Farbe durch Weißverhüllung u. s. w.), wird in den Ausführungen
es Verfassers trotz mancher richtigen Ansätze unklar und vieldeutig. Statt psycho-
tischer Analysen treffen wir oft auf Fiktionen. Einige Beispiele dürften diese Be-
auptung rechtfertigen: »Ein Ton, mehr als durch die üblichen sieben Oktaven
■ederholt, ist für die Musik nicht mehr wirksam, ebensowenig eine mehr als
{ ') Fünfter internationaler Psychologenkongreß zu Rom (1905); Atti S. 158
rner in der Sammlung »Sinnespsychologische Fragen«. Leipzig 1907.