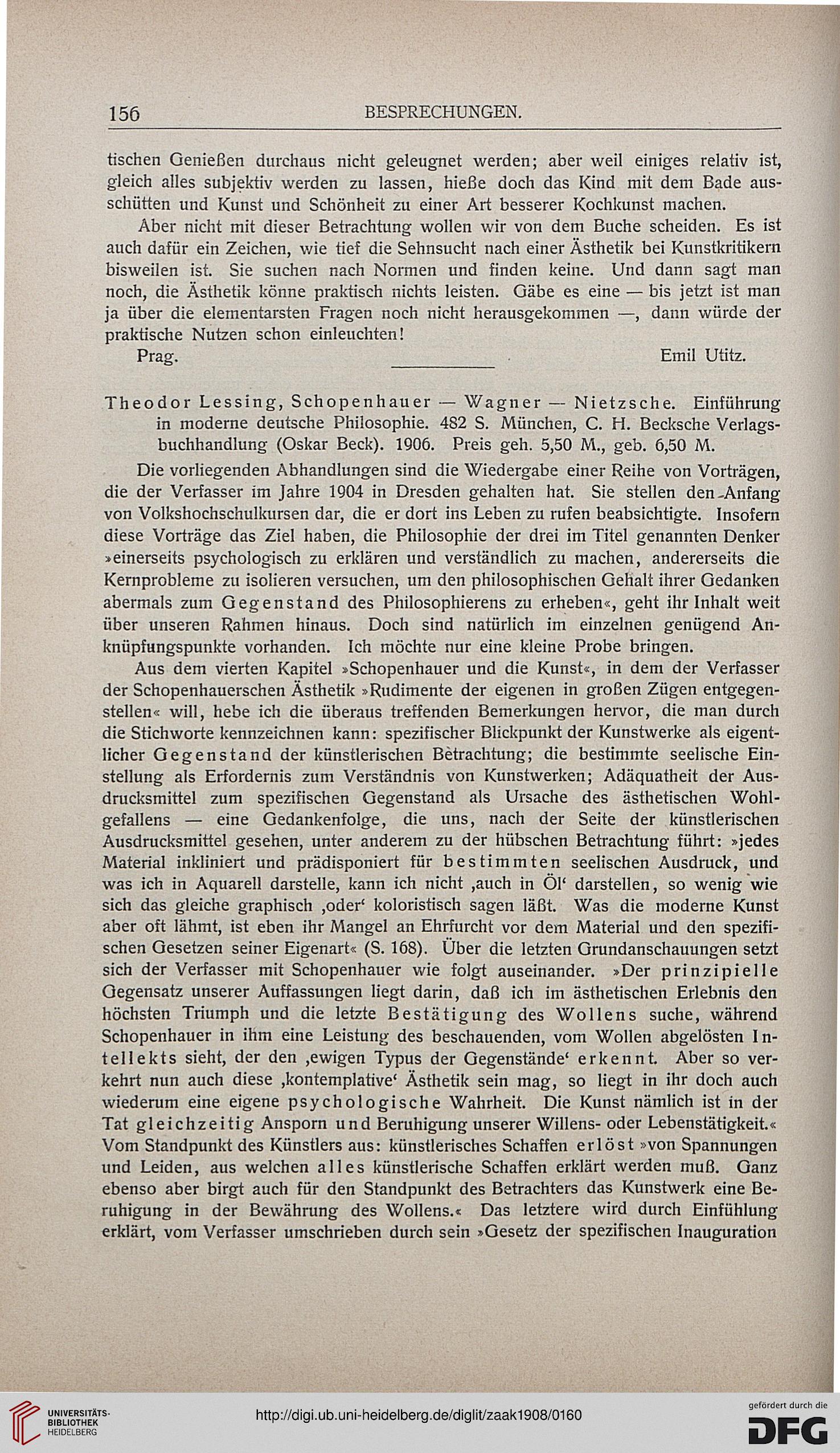BESPRECHUNGEN.
tischen Genießen durchaus nicht geleugnet werden; aber weil einiges relativ ist,
gleich alles subjektiv werden zu lassen, hieße doch das Kind mit dem Bade aus-
schütten und Kunst und Schönheit zu einer Art besserer Kochkunst machen.
Aber nicht mit dieser Betrachtung wollen wir von dem Buche scheiden. Es ist
auch dafür ein Zeichen, wie tief die Sehnsucht nach einer Ästhetik bei Kunstkritikern
bisweilen ist. Sie suchen nach Normen und finden keine. Und dann sagt man
noch, die Ästhetik könne praktisch nichts leisten. Gäbe es eine — bis jetzt ist man
ja über die elementarsten Fragen noch nicht herausgekommen —, dann würde der
praktische Nutzen schon einleuchten!
Prag. Emil Utitz.
Theodor Lessing, Schopenhauer — Wagner — Nietzsche. Einführung
in moderne deutsche Philosophie. 482 S. München, C. H. Becksche Verlags-
buchhandlung (Oskar Beck). 1906. Preis geh. 5,50 M., geb. 6,50 M.
Die vorliegenden Abhandlungen sind die Wiedergabe einer Reihe von Vorträgen,
die der Verfasser im Jahre 1904 in Dresden gehalten hat. Sie stellen den-Anfang
von Volkshochschulkursen dar, die er dort ins Leben zu rufen beabsichtigte. Insofern
diese Vorträge das Ziel haben, die Philosophie der drei im Titel genannten Denker
>einerseits psychologisch zu erklären und verständlich zu machen, andererseits die
Kernprobleme zu isolieren versuchen, um den philosophischen Gehalt ihrer Gedanken
abermals zum Gegenstand des Philosophierens zu erheben«, geht ihr Inhalt weit
über unseren Rahmen hinaus. Doch sind natürlich im einzelnen genügend An-
knüpfungspunkte vorhanden. Ich möchte nur eine kleine Probe bringen.
Aus dem vierten Kapitel »Schopenhauer und die Kunst«, in dem der Verfasser
der Schopenhauerschen Ästhetik »Rudimente der eigenen in großen Zügen entgegen-
stellen« will, hebe ich die überaus treffenden Bemerkungen hervor, die man durch
die Stichworte kennzeichnen kann: spezifischer Blickpunkt der Kunstwerke als eigent-
licher Gegenstand der künstlerischen Betrachtung; die bestimmte seelische Ein-
stellung als Erfordernis zum Verständnis von Kunstwerken; Adäquatheit der Aus-
drucksmittel zum spezifischen Gegenstand als Ursache des ästhetischen Wohl-
gefallens — eine Gedankenfolge, die uns, nach der Seite der künstlerischen
Ausdrucksmittel gesehen, unter anderem zu der hübschen Betrachtung führt: »jedes
Material inkliniert und prädisponiert für bestimmten seelischen Ausdruck, und
was ich in Aquarell darstelle, kann ich nicht ,auch in Öl' darstellen, so wenig wie
sich das gleiche graphisch ,oder' koloristisch sagen läßt. Was die moderne Kunst
aber oft lähmt, ist eben ihr Mangel an Ehrfurcht vor dem Material und den spezifi-
schen Gesetzen seiner Eigenart« (S. 168). Über die letzten Grundanschauungen setzt
sich der Verfasser mit Schopenhauer wie folgt auseinander. »Der prinzipielle
Gegensatz unserer Auffassungen liegt darin, daß ich im ästhetischen Erlebnis den
höchsten Triumph und die letzte Bestätigung des Wollens suche, während
Schopenhauer in ihm eine Leistung des beschauenden, vom Wollen abgelösten In-
tellekts sieht, der den ,ewigen Typus der Gegenstände' erkennt. Aber so ver-
kehrt nun auch diese ,kontemplative' Ästhetik sein mag, so liegt in ihr doch auch
wiederum eine eigene psychologische Wahrheit. Die Kunst nämlich ist in der
Tat gleichzeitig Ansporn und Beruhigung unserer Willens- oder Lebenstätigkeit.«
Vom Standpunkt des Künstlers aus: künstlerisches Schaffen erlöst »von Spannungen
und Leiden, aus welchen alles künstlerische Schaffen erklärt werden muß. Ganz
ebenso aber birgt auch für den Standpunkt des Betrachters das Kunstwerk eine Be-
ruhigung in der Bewährung des Wollens.« Das letztere wird durch Einfühlung
erklärt, vom Verfasser umschrieben durch sein »Gesetz der spezifischen Inauguration
tischen Genießen durchaus nicht geleugnet werden; aber weil einiges relativ ist,
gleich alles subjektiv werden zu lassen, hieße doch das Kind mit dem Bade aus-
schütten und Kunst und Schönheit zu einer Art besserer Kochkunst machen.
Aber nicht mit dieser Betrachtung wollen wir von dem Buche scheiden. Es ist
auch dafür ein Zeichen, wie tief die Sehnsucht nach einer Ästhetik bei Kunstkritikern
bisweilen ist. Sie suchen nach Normen und finden keine. Und dann sagt man
noch, die Ästhetik könne praktisch nichts leisten. Gäbe es eine — bis jetzt ist man
ja über die elementarsten Fragen noch nicht herausgekommen —, dann würde der
praktische Nutzen schon einleuchten!
Prag. Emil Utitz.
Theodor Lessing, Schopenhauer — Wagner — Nietzsche. Einführung
in moderne deutsche Philosophie. 482 S. München, C. H. Becksche Verlags-
buchhandlung (Oskar Beck). 1906. Preis geh. 5,50 M., geb. 6,50 M.
Die vorliegenden Abhandlungen sind die Wiedergabe einer Reihe von Vorträgen,
die der Verfasser im Jahre 1904 in Dresden gehalten hat. Sie stellen den-Anfang
von Volkshochschulkursen dar, die er dort ins Leben zu rufen beabsichtigte. Insofern
diese Vorträge das Ziel haben, die Philosophie der drei im Titel genannten Denker
>einerseits psychologisch zu erklären und verständlich zu machen, andererseits die
Kernprobleme zu isolieren versuchen, um den philosophischen Gehalt ihrer Gedanken
abermals zum Gegenstand des Philosophierens zu erheben«, geht ihr Inhalt weit
über unseren Rahmen hinaus. Doch sind natürlich im einzelnen genügend An-
knüpfungspunkte vorhanden. Ich möchte nur eine kleine Probe bringen.
Aus dem vierten Kapitel »Schopenhauer und die Kunst«, in dem der Verfasser
der Schopenhauerschen Ästhetik »Rudimente der eigenen in großen Zügen entgegen-
stellen« will, hebe ich die überaus treffenden Bemerkungen hervor, die man durch
die Stichworte kennzeichnen kann: spezifischer Blickpunkt der Kunstwerke als eigent-
licher Gegenstand der künstlerischen Betrachtung; die bestimmte seelische Ein-
stellung als Erfordernis zum Verständnis von Kunstwerken; Adäquatheit der Aus-
drucksmittel zum spezifischen Gegenstand als Ursache des ästhetischen Wohl-
gefallens — eine Gedankenfolge, die uns, nach der Seite der künstlerischen
Ausdrucksmittel gesehen, unter anderem zu der hübschen Betrachtung führt: »jedes
Material inkliniert und prädisponiert für bestimmten seelischen Ausdruck, und
was ich in Aquarell darstelle, kann ich nicht ,auch in Öl' darstellen, so wenig wie
sich das gleiche graphisch ,oder' koloristisch sagen läßt. Was die moderne Kunst
aber oft lähmt, ist eben ihr Mangel an Ehrfurcht vor dem Material und den spezifi-
schen Gesetzen seiner Eigenart« (S. 168). Über die letzten Grundanschauungen setzt
sich der Verfasser mit Schopenhauer wie folgt auseinander. »Der prinzipielle
Gegensatz unserer Auffassungen liegt darin, daß ich im ästhetischen Erlebnis den
höchsten Triumph und die letzte Bestätigung des Wollens suche, während
Schopenhauer in ihm eine Leistung des beschauenden, vom Wollen abgelösten In-
tellekts sieht, der den ,ewigen Typus der Gegenstände' erkennt. Aber so ver-
kehrt nun auch diese ,kontemplative' Ästhetik sein mag, so liegt in ihr doch auch
wiederum eine eigene psychologische Wahrheit. Die Kunst nämlich ist in der
Tat gleichzeitig Ansporn und Beruhigung unserer Willens- oder Lebenstätigkeit.«
Vom Standpunkt des Künstlers aus: künstlerisches Schaffen erlöst »von Spannungen
und Leiden, aus welchen alles künstlerische Schaffen erklärt werden muß. Ganz
ebenso aber birgt auch für den Standpunkt des Betrachters das Kunstwerk eine Be-
ruhigung in der Bewährung des Wollens.« Das letztere wird durch Einfühlung
erklärt, vom Verfasser umschrieben durch sein »Gesetz der spezifischen Inauguration