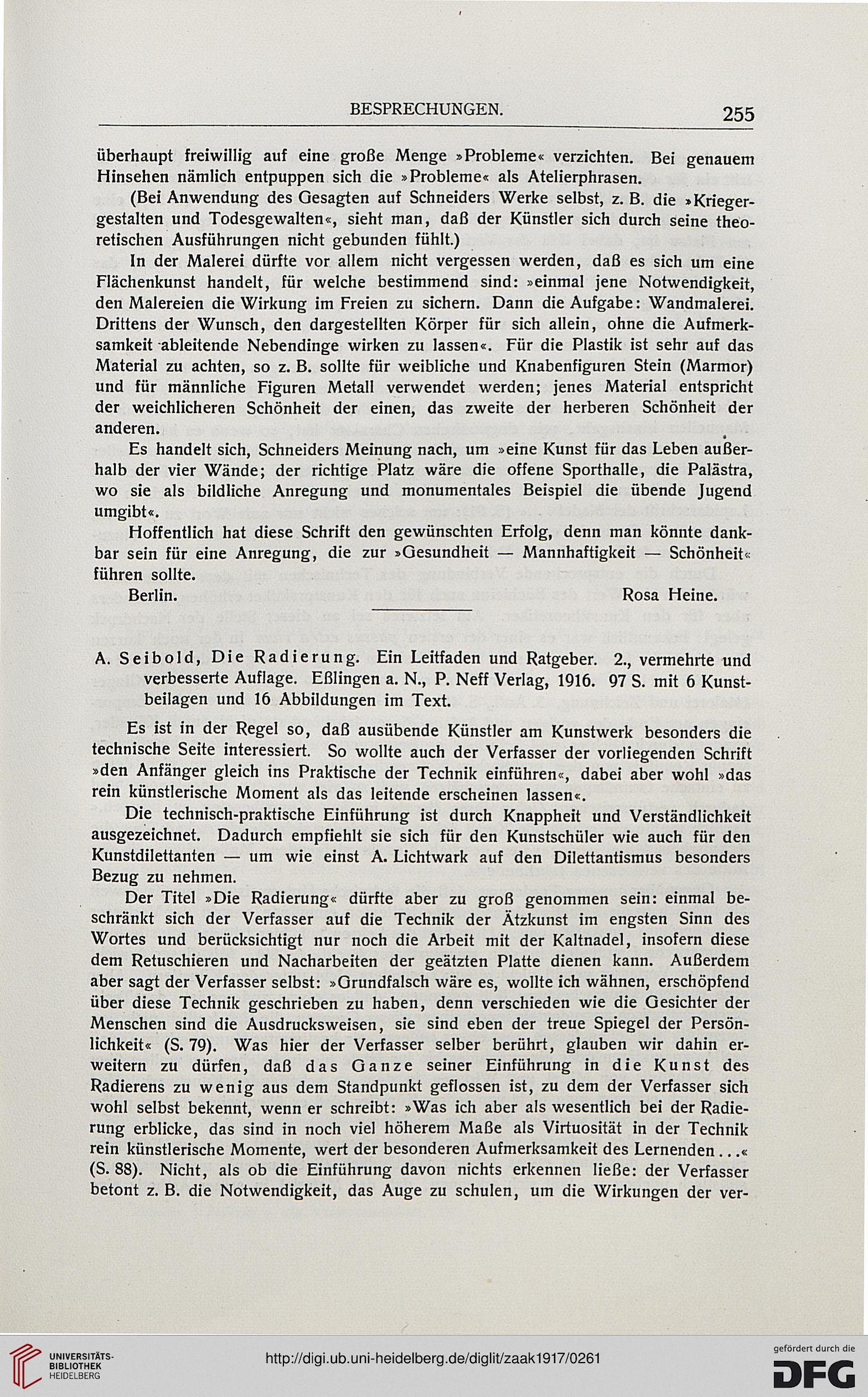BESPRECHUNGEN. 255
überhaupt freiwillig auf eine große Menge »Probleme« verzichten. Bei genauem
Hinsehen nämlich entpuppen sich die »Probleme« als Atelierphrasen.
(Bei Anwendung des Gesagten auf Schneiders Werke selbst, z. B. die »Krieger-
gestalten und Todesgewalten«, sieht man, daß der Künstler sich durch seine theo-
retischen Ausführungen nicht gebunden fühlt.)
In der Malerei dürfte vor allem nicht vergessen werden, daß es sich um eine
Flächenkunst handelt, für welche bestimmend sind: »einmal jene Notwendigkeit,
den Malereien die Wirkung im Freien zu sichern. Dann die Aufgabe: Wandmalerei.
Drittens der Wunsch, den dargestellten Körper für sich allein, ohne die Aufmerk-
samkeit ableitende Nebendinge wirken zu lassen«. Für die Plastik ist sehr auf das
Material zu achten, so z. B. sollte für weibliche und Knabenfiguren Stein (Marmor)
und für männliche Figuren Metall verwendet werden; jenes Material entspricht
der weichlicheren Schönheit der einen, das zweite der herberen Schönheit der
anderen.
Es handelt sich, Schneiders Meinung nach, um »eine Kunst für das Leben außer-
halb der vier Wände; der richtige Platz wäre die offene Sporthalle, die Palästra,
wo sie als bildliche Anregung und monumentales Beispiel die übende Jugend
umgibt«.
Hoffentlich hat diese Schrift den gewünschten Erfolg, denn man könnte dank-
bar sein für eine Anregung, die zur »Gesundheit — Mannhaftigkeit — Schönheit«
führen sollte.
Berlin. Rosa Heine.
A. Seibold, Die Radierung. Ein Leitfaden und Ratgeber. 2., vermehrte und
verbesserte Auflage. Eßlingen a. N., P. Neff Verlag, 1916. 97 S. mit 6 Kunst-
beilagen und 16 Abbildungen im Text.
Es ist in der Regel so, daß ausübende Künstler am Kunstwerk besonders die
technische Seite interessiert. So wollte auch der Verfasser der vorliegenden Schrift
»den Anfänger gleich ins Praktische der Technik einführen«, dabei aber wohl »das
rein künstlerische Moment als das leitende erscheinen lassen«.
Die technisch-praktische Einführung ist durch Knappheit und Verständlichkeit
ausgezeichnet. Dadurch empfiehlt sie sich für den Kunstschüler wie auch für den
Kunstdilettanten — um wie einst A. Lichtwark auf den Dilettantismus besonders
Bezug zu nehmen.
Der Titel »Die Radierung« dürfte aber zu groß genommen sein: einmal be-
schränkt sich der Verfasser auf die Technik der Ätzkunst im engsten Sinn des
Wortes und berücksichtigt nur noch die Arbeit mit der Kaltnadel, insofern diese
dem Retuschieren und Nacharbeiten der geätzten Platte dienen kann. Außerdem
aber sagt der Verfasser selbst: »Grundfalsch wäre es, wollte ich wähnen, erschöpfend
über diese Technik geschrieben zu haben, denn verschieden wie die Gesichter der
Menschen sind die Ausdrucksweisen, sie sind eben der treue Spiegel der Persön-
lichkeit« (S. 79). Was hier der Verfasser selber berührt, glauben wir dahin er-
weitern zu dürfen, daß das Ganze seiner Einführung in die Kunst des
Radierens zu wenig aus dem Standpunkt geflossen ist, zu dem der Verfasser sich
wohl selbst bekennt, wenn er schreibt: »Was ich aber als wesentlich bei der Radie-
rung erblicke, das sind in noch viel höherem Maße als Virtuosität in der Technik
rein künstlerische Momente, wert der besonderen Aufmerksamkeit des Lernenden ...«
(S. 88). Nicht, als ob die Einführung davon nichts erkennen ließe: der Verfasser
betont z. B. die Notwendigkeit, das Auge zu schulen, um die Wirkungen der ver-
überhaupt freiwillig auf eine große Menge »Probleme« verzichten. Bei genauem
Hinsehen nämlich entpuppen sich die »Probleme« als Atelierphrasen.
(Bei Anwendung des Gesagten auf Schneiders Werke selbst, z. B. die »Krieger-
gestalten und Todesgewalten«, sieht man, daß der Künstler sich durch seine theo-
retischen Ausführungen nicht gebunden fühlt.)
In der Malerei dürfte vor allem nicht vergessen werden, daß es sich um eine
Flächenkunst handelt, für welche bestimmend sind: »einmal jene Notwendigkeit,
den Malereien die Wirkung im Freien zu sichern. Dann die Aufgabe: Wandmalerei.
Drittens der Wunsch, den dargestellten Körper für sich allein, ohne die Aufmerk-
samkeit ableitende Nebendinge wirken zu lassen«. Für die Plastik ist sehr auf das
Material zu achten, so z. B. sollte für weibliche und Knabenfiguren Stein (Marmor)
und für männliche Figuren Metall verwendet werden; jenes Material entspricht
der weichlicheren Schönheit der einen, das zweite der herberen Schönheit der
anderen.
Es handelt sich, Schneiders Meinung nach, um »eine Kunst für das Leben außer-
halb der vier Wände; der richtige Platz wäre die offene Sporthalle, die Palästra,
wo sie als bildliche Anregung und monumentales Beispiel die übende Jugend
umgibt«.
Hoffentlich hat diese Schrift den gewünschten Erfolg, denn man könnte dank-
bar sein für eine Anregung, die zur »Gesundheit — Mannhaftigkeit — Schönheit«
führen sollte.
Berlin. Rosa Heine.
A. Seibold, Die Radierung. Ein Leitfaden und Ratgeber. 2., vermehrte und
verbesserte Auflage. Eßlingen a. N., P. Neff Verlag, 1916. 97 S. mit 6 Kunst-
beilagen und 16 Abbildungen im Text.
Es ist in der Regel so, daß ausübende Künstler am Kunstwerk besonders die
technische Seite interessiert. So wollte auch der Verfasser der vorliegenden Schrift
»den Anfänger gleich ins Praktische der Technik einführen«, dabei aber wohl »das
rein künstlerische Moment als das leitende erscheinen lassen«.
Die technisch-praktische Einführung ist durch Knappheit und Verständlichkeit
ausgezeichnet. Dadurch empfiehlt sie sich für den Kunstschüler wie auch für den
Kunstdilettanten — um wie einst A. Lichtwark auf den Dilettantismus besonders
Bezug zu nehmen.
Der Titel »Die Radierung« dürfte aber zu groß genommen sein: einmal be-
schränkt sich der Verfasser auf die Technik der Ätzkunst im engsten Sinn des
Wortes und berücksichtigt nur noch die Arbeit mit der Kaltnadel, insofern diese
dem Retuschieren und Nacharbeiten der geätzten Platte dienen kann. Außerdem
aber sagt der Verfasser selbst: »Grundfalsch wäre es, wollte ich wähnen, erschöpfend
über diese Technik geschrieben zu haben, denn verschieden wie die Gesichter der
Menschen sind die Ausdrucksweisen, sie sind eben der treue Spiegel der Persön-
lichkeit« (S. 79). Was hier der Verfasser selber berührt, glauben wir dahin er-
weitern zu dürfen, daß das Ganze seiner Einführung in die Kunst des
Radierens zu wenig aus dem Standpunkt geflossen ist, zu dem der Verfasser sich
wohl selbst bekennt, wenn er schreibt: »Was ich aber als wesentlich bei der Radie-
rung erblicke, das sind in noch viel höherem Maße als Virtuosität in der Technik
rein künstlerische Momente, wert der besonderen Aufmerksamkeit des Lernenden ...«
(S. 88). Nicht, als ob die Einführung davon nichts erkennen ließe: der Verfasser
betont z. B. die Notwendigkeit, das Auge zu schulen, um die Wirkungen der ver-