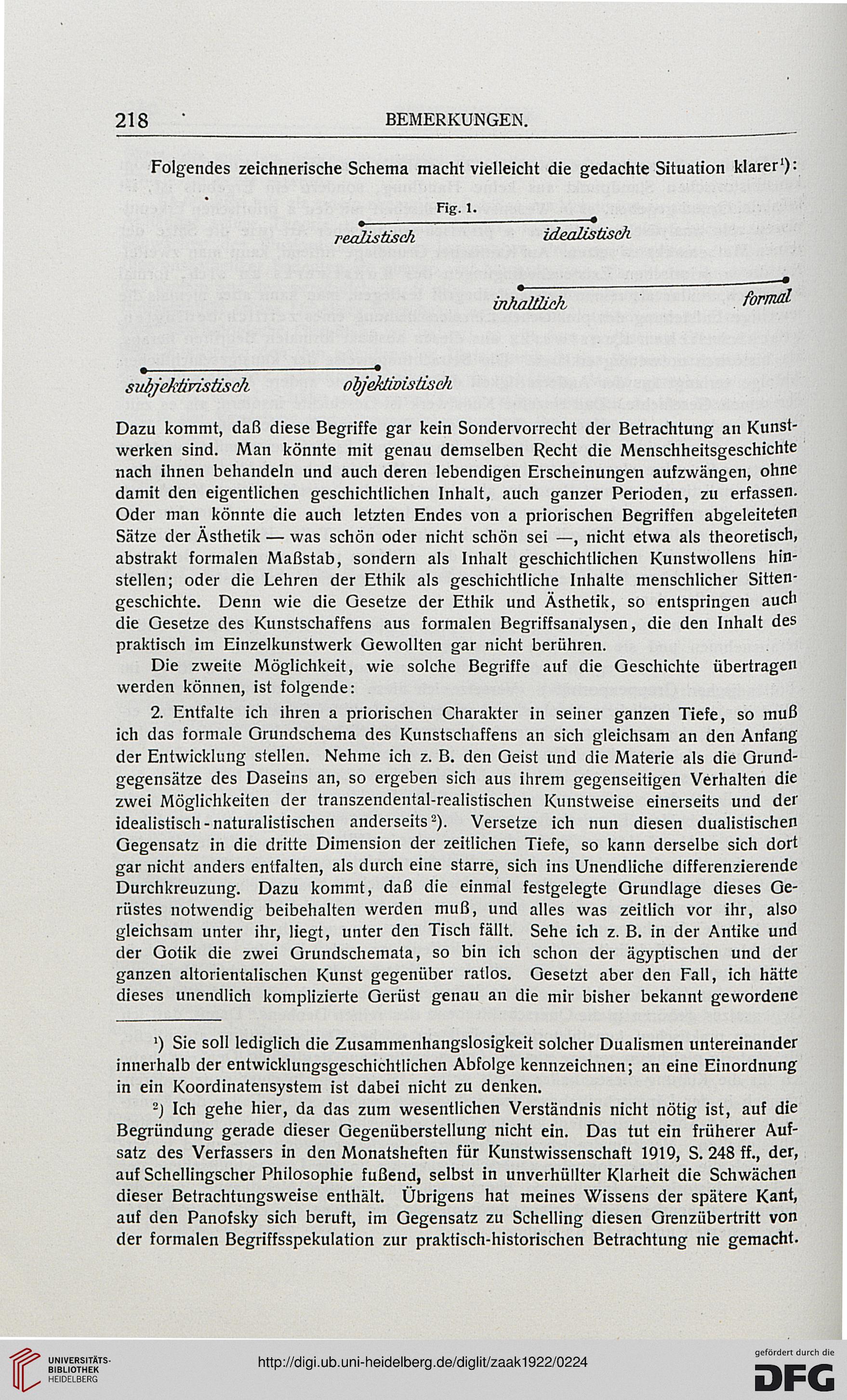218 ' BEMERKUNGEN.
Folgendes zeichnerische Schema macht vielleicht die gedachte Situation klarer1):
Fig. 1.
reallstisc/i idealisüscli
inhaltlich formal
svbjeküvistisch objektivistisch
Dazu kommt, daß diese Begriffe gar kein Sondervorrecht der Betrachtung an Kunst-
werken sind. Man könnte mit genau demselben Recht die Menschheitsgeschichte
nach ihnen behandeln und auch deren lebendigen Erscheinungen aufzwangen, ohne
damit den eigentlichen geschichtlichen Inhalt, auch ganzer Perioden, zu erfassen.
Oder man könnte die auch letzten Endes von a priorischen Begriffen abgeleiteten
Sätze der Ästhetik — was schön oder nicht schön sei —, nicht etwa als theoretisch,
abstrakt formalen Maßstab, sondern als Inhalt geschichtlichen Kunstwollens hin-
stellen; oder die Lehren der Ethik als geschichtliche Inhalte menschlicher Sitten-
geschichte. Denn wie die Gesetze der Ethik und Ästhetik, so entspringen auch
die Gesetze des Kunstschaffens aus formalen Begriffsanalysen, die den Inhalt des
praktisch im Einzelkunstwerk Gewollten gar nicht berühren.
Die zweite Möglichkeit, wie solche Begriffe auf die Geschichte übertragen
werden können, ist folgende:
2. Entfalte ich ihren a priorischen Charakter in seiner ganzen Tiefe, so muß
ich das formale Grundschema des Kunstschaffens an sich gleichsam an den Anfang
der Entwicklung stellen. Nehme ich z. B. den Geist und die Materie als die Grund-
gegensätze des Daseins an, so ergeben sich aus ihrem gegenseitigen Verhalten die
zwei Möglichkeiten der transzendental-realistischen Kunstweise einerseits und der
idealistisch-naturalistischen anderseits2). Versetze ich nun diesen dualistischen
Gegensatz in die dritte Dimension der zeitlichen Tiefe, so kann derselbe sich dort
gar nicht anders entfalten, als durch eine starre, sich ins Unendliche differenzierende
Durchkreuzung. Dazu kommt, daß die einmal festgelegte Grundlage dieses Ge-
rüstes notwendig beibehalten werden muß, und alles was zeitlich vor ihr, also
gleichsam unter ihr, liegt, unter den Tisch fällt. Sehe ich z. B. in der Antike und
der Gotik die zwei Grundschemata, so bin ich schon der ägyptischen und der
ganzen altorientalischen Kunst gegenüber ratlos. Gesetzt aber den Fall, ich hätte
dieses unendlich komplizierte Gerüst genau an die mir bisher bekannt gewordene
') Sie soll lediglich die Zusammenhangslosigkeit solcher Dualismen untereinander
innerhalb der entwicklungsgeschichtlichen Abfolge kennzeichnen; an eine Einordnung
in ein Koordinatensystem ist dabei nicht zu denken.
-) Ich gehe hier, da das zum wesentlichen Verständnis nicht nötig ist, auf die
Begründung gerade dieser Gegenüberstellung nicht ein. Das tut ein früherer Auf-
satz des Verfassers in den Monatsheften für Kunstwissenschaft 1919, S. 248 ff., der,
auf Schellingscher Philosophie fußend, selbst in unverhüllter Klarheit die Schwächen
dieser Betrachtungsweise enthält. Übrigens hat meines Wissens der spätere Kant,
auf den Panofsky sich beruft, im Gegensatz zu Schelling diesen Grenzübertritt von
der formalen Begriffsspekulation zur praktisch-historischen Betrachtung nie gemacht.
Folgendes zeichnerische Schema macht vielleicht die gedachte Situation klarer1):
Fig. 1.
reallstisc/i idealisüscli
inhaltlich formal
svbjeküvistisch objektivistisch
Dazu kommt, daß diese Begriffe gar kein Sondervorrecht der Betrachtung an Kunst-
werken sind. Man könnte mit genau demselben Recht die Menschheitsgeschichte
nach ihnen behandeln und auch deren lebendigen Erscheinungen aufzwangen, ohne
damit den eigentlichen geschichtlichen Inhalt, auch ganzer Perioden, zu erfassen.
Oder man könnte die auch letzten Endes von a priorischen Begriffen abgeleiteten
Sätze der Ästhetik — was schön oder nicht schön sei —, nicht etwa als theoretisch,
abstrakt formalen Maßstab, sondern als Inhalt geschichtlichen Kunstwollens hin-
stellen; oder die Lehren der Ethik als geschichtliche Inhalte menschlicher Sitten-
geschichte. Denn wie die Gesetze der Ethik und Ästhetik, so entspringen auch
die Gesetze des Kunstschaffens aus formalen Begriffsanalysen, die den Inhalt des
praktisch im Einzelkunstwerk Gewollten gar nicht berühren.
Die zweite Möglichkeit, wie solche Begriffe auf die Geschichte übertragen
werden können, ist folgende:
2. Entfalte ich ihren a priorischen Charakter in seiner ganzen Tiefe, so muß
ich das formale Grundschema des Kunstschaffens an sich gleichsam an den Anfang
der Entwicklung stellen. Nehme ich z. B. den Geist und die Materie als die Grund-
gegensätze des Daseins an, so ergeben sich aus ihrem gegenseitigen Verhalten die
zwei Möglichkeiten der transzendental-realistischen Kunstweise einerseits und der
idealistisch-naturalistischen anderseits2). Versetze ich nun diesen dualistischen
Gegensatz in die dritte Dimension der zeitlichen Tiefe, so kann derselbe sich dort
gar nicht anders entfalten, als durch eine starre, sich ins Unendliche differenzierende
Durchkreuzung. Dazu kommt, daß die einmal festgelegte Grundlage dieses Ge-
rüstes notwendig beibehalten werden muß, und alles was zeitlich vor ihr, also
gleichsam unter ihr, liegt, unter den Tisch fällt. Sehe ich z. B. in der Antike und
der Gotik die zwei Grundschemata, so bin ich schon der ägyptischen und der
ganzen altorientalischen Kunst gegenüber ratlos. Gesetzt aber den Fall, ich hätte
dieses unendlich komplizierte Gerüst genau an die mir bisher bekannt gewordene
') Sie soll lediglich die Zusammenhangslosigkeit solcher Dualismen untereinander
innerhalb der entwicklungsgeschichtlichen Abfolge kennzeichnen; an eine Einordnung
in ein Koordinatensystem ist dabei nicht zu denken.
-) Ich gehe hier, da das zum wesentlichen Verständnis nicht nötig ist, auf die
Begründung gerade dieser Gegenüberstellung nicht ein. Das tut ein früherer Auf-
satz des Verfassers in den Monatsheften für Kunstwissenschaft 1919, S. 248 ff., der,
auf Schellingscher Philosophie fußend, selbst in unverhüllter Klarheit die Schwächen
dieser Betrachtungsweise enthält. Übrigens hat meines Wissens der spätere Kant,
auf den Panofsky sich beruft, im Gegensatz zu Schelling diesen Grenzübertritt von
der formalen Begriffsspekulation zur praktisch-historischen Betrachtung nie gemacht.