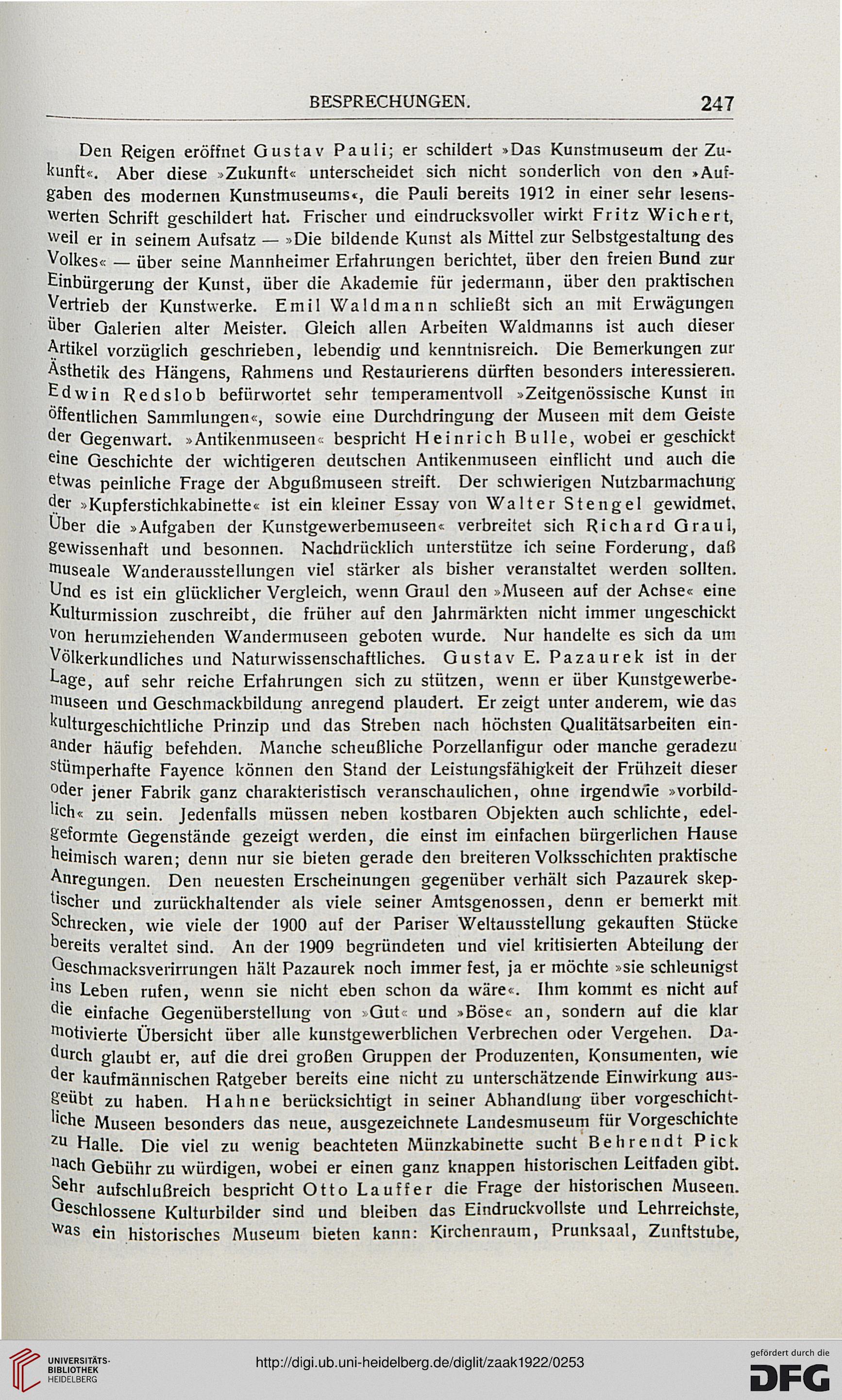BESPRECHUNGEN. 247
Den Reigen eröffnet Gustav Pauli; er schildert »Das Kunstmuseum der Zu-
kunft«. Aber diese »Zukunft« unterscheidet sich nicht sonderlich von den »Auf-
gaben des modernen Kunstmuseums«, die Pauli bereits 1912 in einer sehr lesens-
werten Schrift geschildert hat. Frischer und eindrucksvoller wirkt Fritz Wiehert,
weil er in seinem Aufsatz — »Die bildende Kunst als Mittel zur Selbstgestaltung des
Volkes« — über seine Mannheimer Erfahrungen berichtet, über den freien Bund zur
Einbürgerung der Kunst, über die Akademie für jedermann, über den praktischen
Vertrieb der Kunstwerke. Emil Wald mann schließt sich an mit Erwägungen
uber Galerien alter Meister. Gleich allen Arbeiten Waldmanns ist auch dieser
Artikel vorzüglich geschrieben, lebendig und kenntnisreich. Die Bemerkungen zur
Ästhetik des Hängens, Rahmens und Restaurierens dürften besonders interessieren.
Edwin Redslob befürwortet sehr temperamentvoll »Zeitgenössische Kunst in
öffentlichen Sammlungen«, sowie eine Durchdringung der Museen mit dem Geiste
Qer Gegenwart. »Antikenmuseen« bespricht Heinrich Bulle, wobei er geschickt
eine Geschichte der wichtigeren deutschen Antikenmuseen einflicht und auch die
etwas peinliche Frage der Abgußmuseen streift. Der schwierigen Nutzbarmachung
der »Kupferstichkabinette« ist ein kleiner Essay von Walter Stengel gewidmet.
Über die »Aufgaben der Kunstgewerbemuseen« verbreitet sich Richard Graul,
gewissenhaft und besonnen. Nachdrücklich unterstütze ich seine Forderung, daß
museale Wanderausstellungen viel stärker als bisher veranstaltet werden sollten.
Und es ist ein glücklicher Vergleich, wenn Graul den »Museen auf der Achse« eine
Kultumiission zuschreibt, die früher auf den Jahrmärkten nicht immer ungeschickt
von herumziehenden Wandermuseen geboten wurde. Nur handelte es sich da um
Völkerkundliches und Naturwissenschaftliches. Gustav E. Pazaurek ist in der
Eage, auf sehr reiche Erfahrungen sich zu stützen, wenn er über Kunstgewerbe-
museen und Geschmackbildung anregend plaudert. Er zeigt unter anderem, wie das
kulturgeschichtliche Prinzip und das Streben nach höchsten Qualitätsarbeiten ein-
ander häufig befehden. Manche scheußliche Porzellanfigur oder manche geradezu
stümperhafte Fayence können den Stand der Leistungsfähigkeit der Frühzeit dieser
°der jener Fabrik ganz charakteristisch veranschaulichen, ohne irgendwie »vorbild-
hch« zu sein. Jedenfalls müssen neben kostbaren Objekten auch schlichte, edel-
geformte Gegenstände gezeigt werden, die einst im einfachen bürgerlichen Hause
heimisch waren; denn nur sie bieten gerade den breiteren Volksschichten praktische
Anregungen. Den neuesten Erscheinungen gegenüber verhält sich Pazaurek skep-
tischer und zurückhaltender als viele seiner Amtsgenossen, denn er bemerkt mit
Schrecken, wie viele der 1900 auf der Pariser Weltausstellung gekauften Stücke
bereits veraltet sind. An der 1909 begründeten und viel kritisierten Abteilung der
Geschmacksverirrungen hält Pazaurek noch immer fest, ja er möchte »sie schleunigst
"'s Leben rufen, wenn sie nicht eben schon da wäre«. Ihm kommt es nicht auf
"'e einfache Gegenüberstellung von »Gut« und »Böse« an, sondern auf die klar
Motivierte Übersicht über alle kunstgewerblichen Verbrechen oder Vergehen. Da-
durch glaubt er, auf die drei großen Gruppen der Produzenten, Konsumenten, wie
der kaufmännischen Ratgeber bereits eine nicht zu unterschätzende Einwirkung aus-
geübt zu haben. Hahne berücksichtigt in seiner Abhandlung über vorgeschicht-
uche Museen besonders das neue, ausgezeichnete Landesmuseum für Vorgeschichte
*u Halle. Die viel zu wenig beachteten Münzkabinette sucht Behrendt Pick
"ach Gebühr zu würdigen, wobei er einen ganz knappen historischen Leitfaden gibt.
^ehr aufschlußreich bespricht Otto Lauffer die Frage der historischen Museen.
Geschlossene Kulturbilder sind und bleiben das Eindruckvollste und Lehrreichste,
Was ein historisches Museum bieten kann: Kirchenraum, Prunksaal, Zunftstube,
Den Reigen eröffnet Gustav Pauli; er schildert »Das Kunstmuseum der Zu-
kunft«. Aber diese »Zukunft« unterscheidet sich nicht sonderlich von den »Auf-
gaben des modernen Kunstmuseums«, die Pauli bereits 1912 in einer sehr lesens-
werten Schrift geschildert hat. Frischer und eindrucksvoller wirkt Fritz Wiehert,
weil er in seinem Aufsatz — »Die bildende Kunst als Mittel zur Selbstgestaltung des
Volkes« — über seine Mannheimer Erfahrungen berichtet, über den freien Bund zur
Einbürgerung der Kunst, über die Akademie für jedermann, über den praktischen
Vertrieb der Kunstwerke. Emil Wald mann schließt sich an mit Erwägungen
uber Galerien alter Meister. Gleich allen Arbeiten Waldmanns ist auch dieser
Artikel vorzüglich geschrieben, lebendig und kenntnisreich. Die Bemerkungen zur
Ästhetik des Hängens, Rahmens und Restaurierens dürften besonders interessieren.
Edwin Redslob befürwortet sehr temperamentvoll »Zeitgenössische Kunst in
öffentlichen Sammlungen«, sowie eine Durchdringung der Museen mit dem Geiste
Qer Gegenwart. »Antikenmuseen« bespricht Heinrich Bulle, wobei er geschickt
eine Geschichte der wichtigeren deutschen Antikenmuseen einflicht und auch die
etwas peinliche Frage der Abgußmuseen streift. Der schwierigen Nutzbarmachung
der »Kupferstichkabinette« ist ein kleiner Essay von Walter Stengel gewidmet.
Über die »Aufgaben der Kunstgewerbemuseen« verbreitet sich Richard Graul,
gewissenhaft und besonnen. Nachdrücklich unterstütze ich seine Forderung, daß
museale Wanderausstellungen viel stärker als bisher veranstaltet werden sollten.
Und es ist ein glücklicher Vergleich, wenn Graul den »Museen auf der Achse« eine
Kultumiission zuschreibt, die früher auf den Jahrmärkten nicht immer ungeschickt
von herumziehenden Wandermuseen geboten wurde. Nur handelte es sich da um
Völkerkundliches und Naturwissenschaftliches. Gustav E. Pazaurek ist in der
Eage, auf sehr reiche Erfahrungen sich zu stützen, wenn er über Kunstgewerbe-
museen und Geschmackbildung anregend plaudert. Er zeigt unter anderem, wie das
kulturgeschichtliche Prinzip und das Streben nach höchsten Qualitätsarbeiten ein-
ander häufig befehden. Manche scheußliche Porzellanfigur oder manche geradezu
stümperhafte Fayence können den Stand der Leistungsfähigkeit der Frühzeit dieser
°der jener Fabrik ganz charakteristisch veranschaulichen, ohne irgendwie »vorbild-
hch« zu sein. Jedenfalls müssen neben kostbaren Objekten auch schlichte, edel-
geformte Gegenstände gezeigt werden, die einst im einfachen bürgerlichen Hause
heimisch waren; denn nur sie bieten gerade den breiteren Volksschichten praktische
Anregungen. Den neuesten Erscheinungen gegenüber verhält sich Pazaurek skep-
tischer und zurückhaltender als viele seiner Amtsgenossen, denn er bemerkt mit
Schrecken, wie viele der 1900 auf der Pariser Weltausstellung gekauften Stücke
bereits veraltet sind. An der 1909 begründeten und viel kritisierten Abteilung der
Geschmacksverirrungen hält Pazaurek noch immer fest, ja er möchte »sie schleunigst
"'s Leben rufen, wenn sie nicht eben schon da wäre«. Ihm kommt es nicht auf
"'e einfache Gegenüberstellung von »Gut« und »Böse« an, sondern auf die klar
Motivierte Übersicht über alle kunstgewerblichen Verbrechen oder Vergehen. Da-
durch glaubt er, auf die drei großen Gruppen der Produzenten, Konsumenten, wie
der kaufmännischen Ratgeber bereits eine nicht zu unterschätzende Einwirkung aus-
geübt zu haben. Hahne berücksichtigt in seiner Abhandlung über vorgeschicht-
uche Museen besonders das neue, ausgezeichnete Landesmuseum für Vorgeschichte
*u Halle. Die viel zu wenig beachteten Münzkabinette sucht Behrendt Pick
"ach Gebühr zu würdigen, wobei er einen ganz knappen historischen Leitfaden gibt.
^ehr aufschlußreich bespricht Otto Lauffer die Frage der historischen Museen.
Geschlossene Kulturbilder sind und bleiben das Eindruckvollste und Lehrreichste,
Was ein historisches Museum bieten kann: Kirchenraum, Prunksaal, Zunftstube,