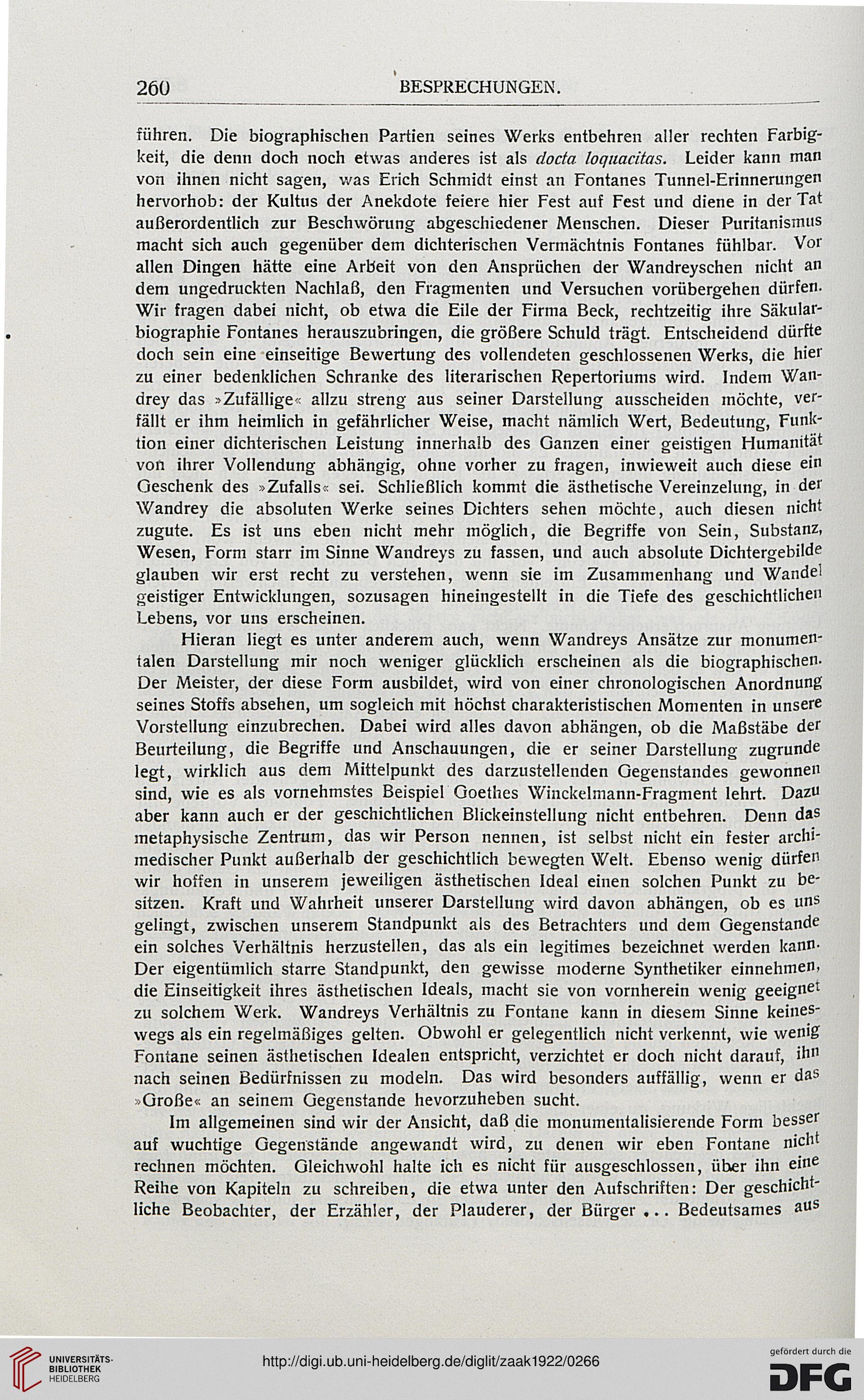26Ü BESPRECHUNGEN.
führen. Die biographischen Partien seines Werks entbehren aller rechten Farbig-
keit, die denn doch noch etwas anderes ist als docta loquacitas. Leider kann man
von ihnen nicht sagen, was Erich Schmidt einst an Fontanes Tunnel-Erinnerungen
hervorhob: der Kultus der Anekdote feiere hier Fest auf Fest und diene in der Tat
außerordentlich zur Beschwörung abgeschiedener Menschen. Dieser Puritanismus
macht sich auch gegenüber dem dichterischen Vermächtnis Fontanes fühlbar. Vor
allen Dingen hätte eine Arbeit von den Ansprüchen der Wandreyschen nicht an
dem ungedruckten Nachlaß, den Fragmenten und Versuchen vorübergehen dürfen.
Wir fragen dabei nicht, ob etwa die Eile der Firma Beck, rechtzeitig ihre Säkular-
biographie Fontanes herauszubringen, die größere Schuld trägt. Entscheidend dürfte
doch sein eine einseitige Bewertung des vollendeten geschlossenen Werks, die hier
zu einer bedenklichen Schranke des literarischen Repertoriums wird. Indem Wau-
drey das »Zufälligem allzu streng aus seiner Darstellung ausscheiden möchte, ver-
fällt er ihm heimlich in gefährlicher Weise, macht nämlich Wert, Bedeutung, Funk-
tion einer dichterischen Leistung innerhalb des Ganzen einer geistigen Humanität
von ihrer Vollendung abhängig, ohne vorher zu fragen, inwieweit auch diese ein
Geschenk des »Zufalls:: sei. Schließlich kommt die ästhetische Vereinzelung, in der
Wandrey die absoluten Werke seines Dichters sehen möchte, auch diesen nicht
zugute. Es ist uns eben nicht mehr möglich, die Begriffe von Sein, Substanz,
Wesen, Form starr im Sinne Wandreys zu fassen, und auch absolute Dichtergebilde
glauben wir erst recht zu verstehen, wenn sie im Zusammenhang und Wandel
geistiger Entwicklungen, sozusagen hineingestellt in die Tiefe des geschichtlichen
Lebens, vor uns erscheinen.
Hieran liegt es unter anderem auch, wenn Wandreys Ansätze zur monumen-
talen Darstellung mir noch weniger glücklich erscheinen als die biographischen-
Der Meister, der diese Form ausbildet, wird von einer chronologischen Anordnung
seines Stoffs absehen, um sogleich mit höchst charakteristischen Momenten in unsere
Vorstellung einzubrechen. Dabei wird alles davon abhängen, ob die Maßstäbe der
Beurteilung, die Begriffe und Anschauungen, die er seiner Darstellung zugrunde
legt, wirklich aus dem Mittelpunkt des darzustellenden Gegenstandes gewonnen
sind, wie es als vornehmstes Beispiel Goethes Winckelmann-Fragment lehrt. Dazu
aber kann auch er der geschichtlichen Blickeinstellung nicht entbehren. Denn das
metaphysische Zentrum, das wir Person nennen, ist selbst nicht ein fester archi-
medischer Punkt außerhalb der geschichtlich bewegten Welt. Ebenso wenig dürfen
wir hoffen in unserem jeweiligen ästhetischen Ideal einen solchen Punkt zu be-
sitzen. Kraft und Wahrheit unserer Darstellung wird davon abhängen, ob es uns
gelingt, zwischen unserem Standpunkt als des Betrachters und dem Gegenstande
ein solches Verhältnis herzustellen, das als ein legitimes bezeichnet werden kann-
Der eigentümlich starre Standpunkt, den gewisse moderne Synthetiker einnehmen,
die Einseitigkeit ihres ästhetischen Ideals, macht sie von vornherein wenig geeignet
zu solchem Werk. Wandreys Verhältnis zu Fontane kann in diesem Sinne keines-
wegs als ein regelmäßiges gelten. Obwohl er gelegentlich nicht verkennt, wie wenig
Fontane seinen ästhetischen Idealen entspricht, verzichtet er doch nicht darauf, ih"
nach seinen Bedürfnissen zu modeln. Das wird besonders auffällig, wenn er das
»Große« an seinem Gegenstande hevorzuheben sucht.
Im allgemeinen sind wir der Ansicht, daß die monumentalisierende Form besser
auf wuchtige Gegenstände angewandt wird, zu denen wir eben Fontane nicht
rechnen möchten. Gleichwohl halte ich es nicht für ausgeschlossen, über ihn eine
Reihe von Kapiteln zu schreiben, die etwa unter den Aufschriften: Der geschicht-
liche Beobachter, der Erzähler, der Plauderer, der Bürger... Bedeutsames aus
führen. Die biographischen Partien seines Werks entbehren aller rechten Farbig-
keit, die denn doch noch etwas anderes ist als docta loquacitas. Leider kann man
von ihnen nicht sagen, was Erich Schmidt einst an Fontanes Tunnel-Erinnerungen
hervorhob: der Kultus der Anekdote feiere hier Fest auf Fest und diene in der Tat
außerordentlich zur Beschwörung abgeschiedener Menschen. Dieser Puritanismus
macht sich auch gegenüber dem dichterischen Vermächtnis Fontanes fühlbar. Vor
allen Dingen hätte eine Arbeit von den Ansprüchen der Wandreyschen nicht an
dem ungedruckten Nachlaß, den Fragmenten und Versuchen vorübergehen dürfen.
Wir fragen dabei nicht, ob etwa die Eile der Firma Beck, rechtzeitig ihre Säkular-
biographie Fontanes herauszubringen, die größere Schuld trägt. Entscheidend dürfte
doch sein eine einseitige Bewertung des vollendeten geschlossenen Werks, die hier
zu einer bedenklichen Schranke des literarischen Repertoriums wird. Indem Wau-
drey das »Zufälligem allzu streng aus seiner Darstellung ausscheiden möchte, ver-
fällt er ihm heimlich in gefährlicher Weise, macht nämlich Wert, Bedeutung, Funk-
tion einer dichterischen Leistung innerhalb des Ganzen einer geistigen Humanität
von ihrer Vollendung abhängig, ohne vorher zu fragen, inwieweit auch diese ein
Geschenk des »Zufalls:: sei. Schließlich kommt die ästhetische Vereinzelung, in der
Wandrey die absoluten Werke seines Dichters sehen möchte, auch diesen nicht
zugute. Es ist uns eben nicht mehr möglich, die Begriffe von Sein, Substanz,
Wesen, Form starr im Sinne Wandreys zu fassen, und auch absolute Dichtergebilde
glauben wir erst recht zu verstehen, wenn sie im Zusammenhang und Wandel
geistiger Entwicklungen, sozusagen hineingestellt in die Tiefe des geschichtlichen
Lebens, vor uns erscheinen.
Hieran liegt es unter anderem auch, wenn Wandreys Ansätze zur monumen-
talen Darstellung mir noch weniger glücklich erscheinen als die biographischen-
Der Meister, der diese Form ausbildet, wird von einer chronologischen Anordnung
seines Stoffs absehen, um sogleich mit höchst charakteristischen Momenten in unsere
Vorstellung einzubrechen. Dabei wird alles davon abhängen, ob die Maßstäbe der
Beurteilung, die Begriffe und Anschauungen, die er seiner Darstellung zugrunde
legt, wirklich aus dem Mittelpunkt des darzustellenden Gegenstandes gewonnen
sind, wie es als vornehmstes Beispiel Goethes Winckelmann-Fragment lehrt. Dazu
aber kann auch er der geschichtlichen Blickeinstellung nicht entbehren. Denn das
metaphysische Zentrum, das wir Person nennen, ist selbst nicht ein fester archi-
medischer Punkt außerhalb der geschichtlich bewegten Welt. Ebenso wenig dürfen
wir hoffen in unserem jeweiligen ästhetischen Ideal einen solchen Punkt zu be-
sitzen. Kraft und Wahrheit unserer Darstellung wird davon abhängen, ob es uns
gelingt, zwischen unserem Standpunkt als des Betrachters und dem Gegenstande
ein solches Verhältnis herzustellen, das als ein legitimes bezeichnet werden kann-
Der eigentümlich starre Standpunkt, den gewisse moderne Synthetiker einnehmen,
die Einseitigkeit ihres ästhetischen Ideals, macht sie von vornherein wenig geeignet
zu solchem Werk. Wandreys Verhältnis zu Fontane kann in diesem Sinne keines-
wegs als ein regelmäßiges gelten. Obwohl er gelegentlich nicht verkennt, wie wenig
Fontane seinen ästhetischen Idealen entspricht, verzichtet er doch nicht darauf, ih"
nach seinen Bedürfnissen zu modeln. Das wird besonders auffällig, wenn er das
»Große« an seinem Gegenstande hevorzuheben sucht.
Im allgemeinen sind wir der Ansicht, daß die monumentalisierende Form besser
auf wuchtige Gegenstände angewandt wird, zu denen wir eben Fontane nicht
rechnen möchten. Gleichwohl halte ich es nicht für ausgeschlossen, über ihn eine
Reihe von Kapiteln zu schreiben, die etwa unter den Aufschriften: Der geschicht-
liche Beobachter, der Erzähler, der Plauderer, der Bürger... Bedeutsames aus