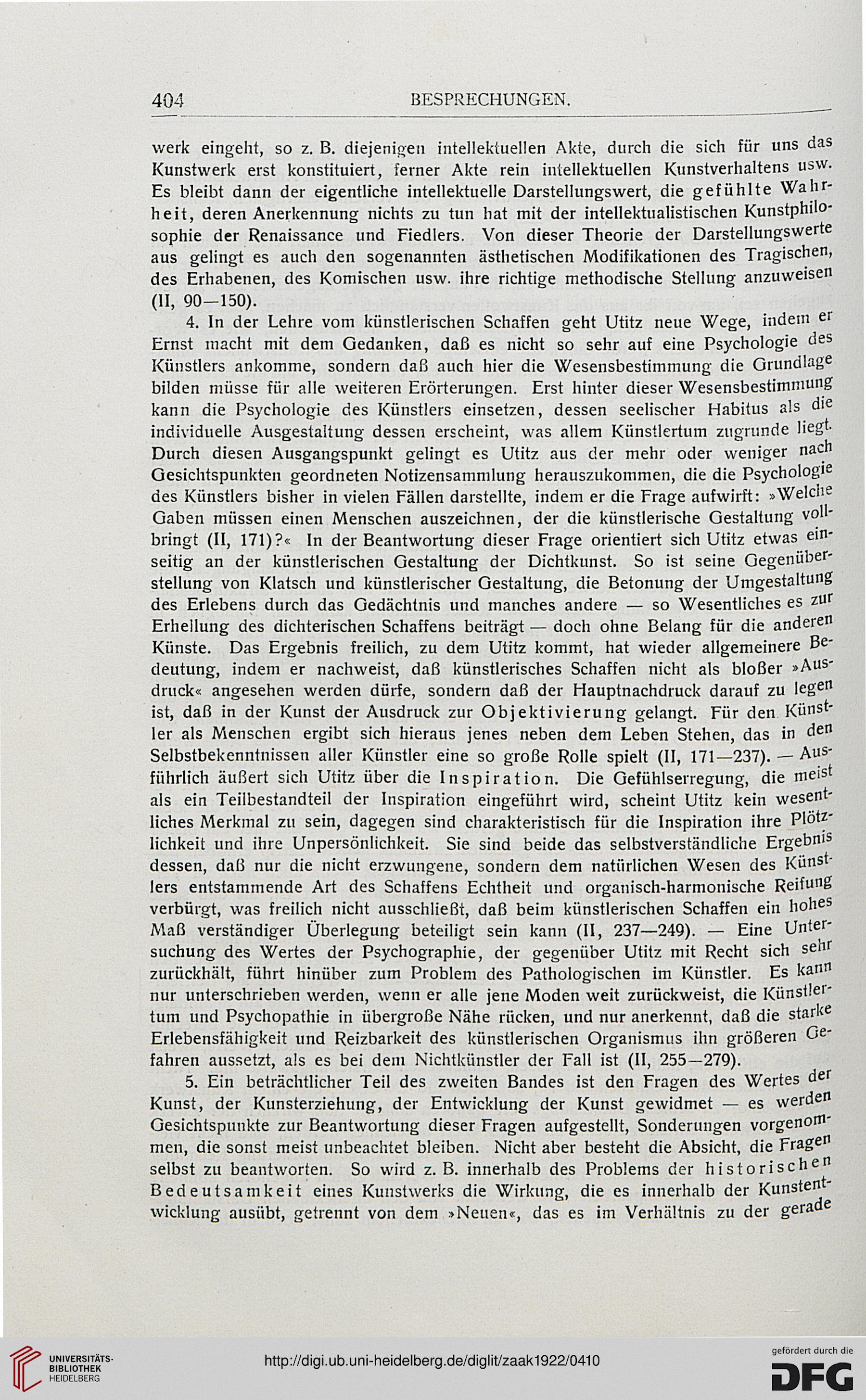404 BESPRECHUNGEN.
werk eingeht, so z. B. diejenigen intellektuellen Akte, durch die sich für uns das
Kunstwerk erst konstituiert, ferner Akte rein intellektuellen Kunstverhaltens usw.
Es bleibt dann der eigentliche intellektuelle Darstellungswert, die gefühlte Wahr-
heit, deren Anerkennung nichts zu tun hat mit der intellektualistischen Kunstphilo-
sophie der Renaissance und Fiedlers. Von dieser Theorie der Darstellungswerte
aus gelingt es auch den sogenannten ästhetischen Modifikationen des Tragischen,
des Erhabenen, des Komischen usw. ihre richtige methodische Stellung anzuweisen
(II, 90-150).
4. In der Lehre vom künstlerischen Schaffen geht Utitz neue Wege, indem er
Ernst macht mit dem Gedanken, daß es nicht so sehr auf eine Psychologie des
Künstlers ankomme, sondern daß auch hier die Wesensbestimmung die Grundlage
bilden müsse für alle weiteren Erörterungen. Erst hinter dieser Wesensbestimniung
kann die Psychologie des Künstlers einsetzen, dessen seelischer Habitus als die
individuelle Ausgestaltung dessen erscheint, was allem Künstlertum zugrunde Hegt.
Durch diesen Ausgangspunkt gelingt es Utitz aus der mehr oder weniger nach
Gesichtspunkten geordneten Notizensammlung herauszukommen, die die Psychologie
des Künstlers bisher in vielen Fällen darstellte, indem er die Frage aufwirft: »Welche
Gaben müssen einen Menschen auszeichnen, der die künstlerische Gestaltung v°"'
bringt (II, 171)?« In der Beantwortung dieser Frage orientiert sich Utitz etwas ein-
seitig an der künstlerischen Gestaltung der Dichtkunst. So ist seine Gegenüber-
stellung von Klatsch und künstlerischer Gestaltung, die Betonung der Umgestaltung
des Erlebens durch das Gedächtnis und manches andere — so Wesentliches es zur
Erhellung des dichterischen Schaffens beiträgt — doch ohne Belang für die anderen
Künste. Das Ergebnis freilich, zu dem Utitz kommt, hat wieder allgemeinere Be-
deutung, indem er nachweist, daß künstlerisches Schaffen nicht als bloßer »Aus-
druck« angesehen werden dürfe, sondern daß der Hauptnachdruck darauf zu lege'1
ist, daß in der Kunst der Ausdruck zur Objektivierung gelangt. Für den Künst-
ler als Menschen ergibt sich hieraus jenes neben dem Leben Stehen, das in den
Selbstbekenntnissen aller Künstler eine so große Rolle spielt (II, 171—237). — Aus-
führlich äußert sich Utitz über die Inspiration. Die Gefühlserregung, die meis'
als ein Teilbestandteil der Inspiration eingeführt wird, scheint Utitz kein wesent-
liches Merkmal zu sein, dagegen sind charakteristisch für die Inspiration ihre Plötz-
lichkeit und ihre Unpersönlichkeit. Sie sind beide das selbstverständliche Ergebnis
dessen, daß nur die nicht erzwungene, sondern dem natürlichen Wesen des Künst-
lers entstammende Art des Schaffens Echtheit und organisch-harmonische Reifung
verbürgt, was freilich nicht ausschließt, daß beim künstlerischen Schaffen ein hohes
Maß verständiger Überlegung beteiligt sein kann (II, 237—249). — Eine Unter-
suchung des Wertes der Psychographie, der gegenüber Utitz mit Recht sich sehr
zurückhält, führt hinüber zum Problem des Pathologischen im Künstler. Es kann
nur unterschrieben werden, wenn er alle jene Moden weit zurückweist, die Künstler-
tum und Psychopathie in übergroße Nähe rücken, und nur anerkennt, daß die starke
Erlebensfähigkeit und Reizbarkeit des künstlerischen Organismus ihn größeren Ce'
fahren aussetzt, als es bei dem Nichtkünstler der Fall ist (II, 255—279).
5. Ein beträchtlicher Teil des zweiten Bandes ist den Fragen des Wertes der
Kunst, der Kunsterziehung, der Entwicklung der Kunst gewidmet — es werden
Gesichtspunkte zur Beantwortung dieser Fragen aufgestellt, Sonderlingen vorgenom-
men, die sonst meist unbeachtet bleiben. Nicht aber besteht die Absicht, die Fragen
selbst zu beantworten. So wird z.B. innerhalb des Problems der historische
Bedeutsamkeit eines Kunstwerks die Wirkung, die es innerhalb der Künsten
wicklung ausübt, getrennt von dem »Neuen«, das es im Verhältnis zu der gera"
werk eingeht, so z. B. diejenigen intellektuellen Akte, durch die sich für uns das
Kunstwerk erst konstituiert, ferner Akte rein intellektuellen Kunstverhaltens usw.
Es bleibt dann der eigentliche intellektuelle Darstellungswert, die gefühlte Wahr-
heit, deren Anerkennung nichts zu tun hat mit der intellektualistischen Kunstphilo-
sophie der Renaissance und Fiedlers. Von dieser Theorie der Darstellungswerte
aus gelingt es auch den sogenannten ästhetischen Modifikationen des Tragischen,
des Erhabenen, des Komischen usw. ihre richtige methodische Stellung anzuweisen
(II, 90-150).
4. In der Lehre vom künstlerischen Schaffen geht Utitz neue Wege, indem er
Ernst macht mit dem Gedanken, daß es nicht so sehr auf eine Psychologie des
Künstlers ankomme, sondern daß auch hier die Wesensbestimmung die Grundlage
bilden müsse für alle weiteren Erörterungen. Erst hinter dieser Wesensbestimniung
kann die Psychologie des Künstlers einsetzen, dessen seelischer Habitus als die
individuelle Ausgestaltung dessen erscheint, was allem Künstlertum zugrunde Hegt.
Durch diesen Ausgangspunkt gelingt es Utitz aus der mehr oder weniger nach
Gesichtspunkten geordneten Notizensammlung herauszukommen, die die Psychologie
des Künstlers bisher in vielen Fällen darstellte, indem er die Frage aufwirft: »Welche
Gaben müssen einen Menschen auszeichnen, der die künstlerische Gestaltung v°"'
bringt (II, 171)?« In der Beantwortung dieser Frage orientiert sich Utitz etwas ein-
seitig an der künstlerischen Gestaltung der Dichtkunst. So ist seine Gegenüber-
stellung von Klatsch und künstlerischer Gestaltung, die Betonung der Umgestaltung
des Erlebens durch das Gedächtnis und manches andere — so Wesentliches es zur
Erhellung des dichterischen Schaffens beiträgt — doch ohne Belang für die anderen
Künste. Das Ergebnis freilich, zu dem Utitz kommt, hat wieder allgemeinere Be-
deutung, indem er nachweist, daß künstlerisches Schaffen nicht als bloßer »Aus-
druck« angesehen werden dürfe, sondern daß der Hauptnachdruck darauf zu lege'1
ist, daß in der Kunst der Ausdruck zur Objektivierung gelangt. Für den Künst-
ler als Menschen ergibt sich hieraus jenes neben dem Leben Stehen, das in den
Selbstbekenntnissen aller Künstler eine so große Rolle spielt (II, 171—237). — Aus-
führlich äußert sich Utitz über die Inspiration. Die Gefühlserregung, die meis'
als ein Teilbestandteil der Inspiration eingeführt wird, scheint Utitz kein wesent-
liches Merkmal zu sein, dagegen sind charakteristisch für die Inspiration ihre Plötz-
lichkeit und ihre Unpersönlichkeit. Sie sind beide das selbstverständliche Ergebnis
dessen, daß nur die nicht erzwungene, sondern dem natürlichen Wesen des Künst-
lers entstammende Art des Schaffens Echtheit und organisch-harmonische Reifung
verbürgt, was freilich nicht ausschließt, daß beim künstlerischen Schaffen ein hohes
Maß verständiger Überlegung beteiligt sein kann (II, 237—249). — Eine Unter-
suchung des Wertes der Psychographie, der gegenüber Utitz mit Recht sich sehr
zurückhält, führt hinüber zum Problem des Pathologischen im Künstler. Es kann
nur unterschrieben werden, wenn er alle jene Moden weit zurückweist, die Künstler-
tum und Psychopathie in übergroße Nähe rücken, und nur anerkennt, daß die starke
Erlebensfähigkeit und Reizbarkeit des künstlerischen Organismus ihn größeren Ce'
fahren aussetzt, als es bei dem Nichtkünstler der Fall ist (II, 255—279).
5. Ein beträchtlicher Teil des zweiten Bandes ist den Fragen des Wertes der
Kunst, der Kunsterziehung, der Entwicklung der Kunst gewidmet — es werden
Gesichtspunkte zur Beantwortung dieser Fragen aufgestellt, Sonderlingen vorgenom-
men, die sonst meist unbeachtet bleiben. Nicht aber besteht die Absicht, die Fragen
selbst zu beantworten. So wird z.B. innerhalb des Problems der historische
Bedeutsamkeit eines Kunstwerks die Wirkung, die es innerhalb der Künsten
wicklung ausübt, getrennt von dem »Neuen«, das es im Verhältnis zu der gera"