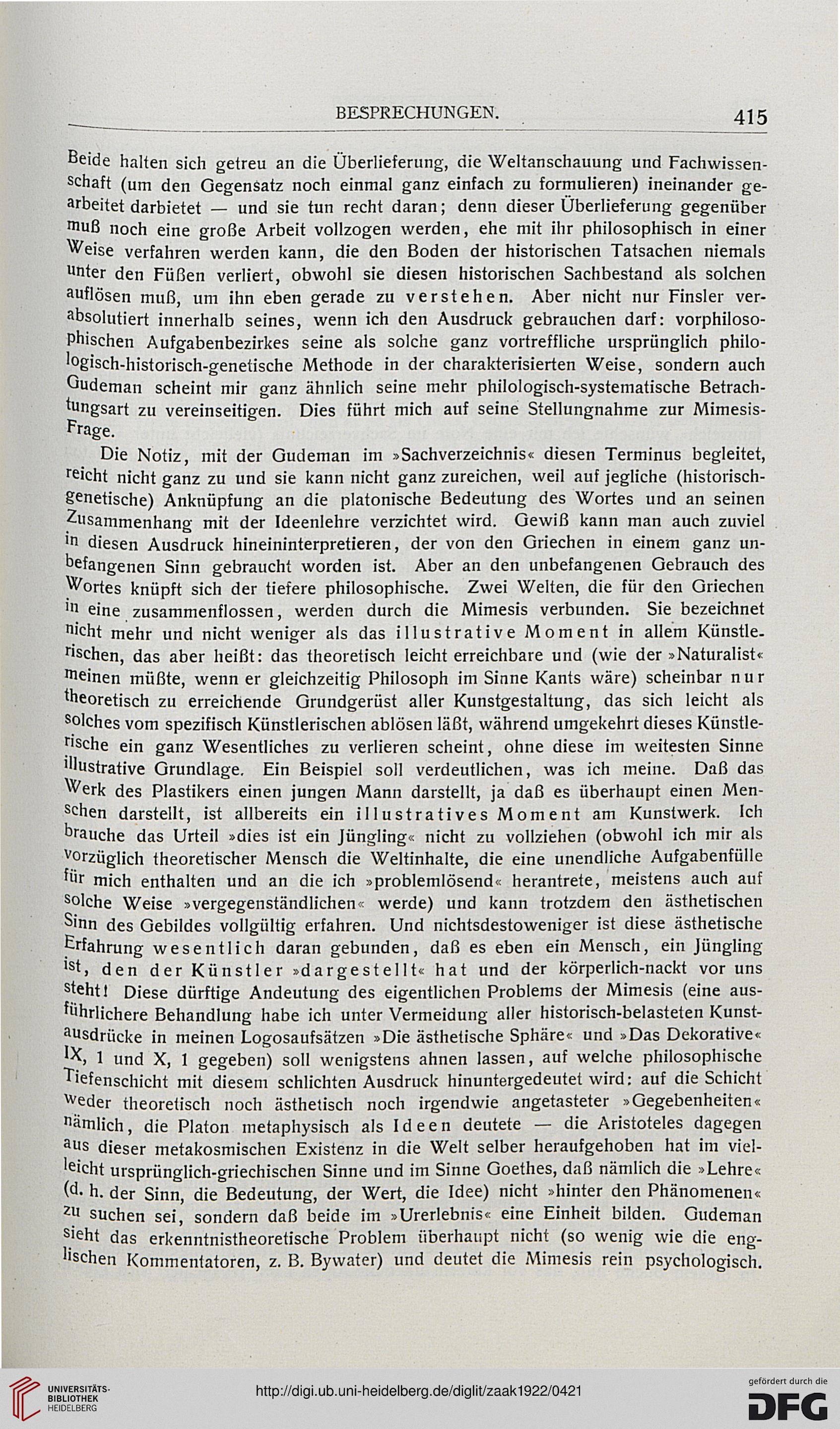BESPRECHUNGEN. 4 1 5
Beide halten sich getreu an die Überlieferung, die Weltanschauung und Fachwissen-
schaft (um den Gegensatz noch einmal ganz einfach zu formulieren) ineinander ge-
arbeitet darbietet — und sie tun recht daran; denn dieser Überlieferung gegenüber
muß noch eine große Arbeit vollzogen werden, ehe mit ihr philosophisch in einer
Weise verfahren werden kann, die den Boden der historischen Tatsachen niemals
unter den Füßen verliert, obwohl sie diesen historischen Sachbestand als solchen
auflösen muß, um ihn eben gerade zu verstehen. Aber nicht nur Finsler ver-
absolutiert innerhalb seines, wenn ich den Ausdruck gebrauchen darf: vorphiloso-
Phischen Aufgabenbezirkes seine als solche ganz vortreffliche ursprünglich philo-
'Ogisch-historisch-genetische Methode in der charakterisierten Weise, sondern auch
uudeman scheint mir ganz ähnlich seine mehr philologisch-systematische Betrach-
tungsart zu vereinseitigen. Dies führt mich auf seine Stellungnahme zur Mimesis-
Frage.
Die Notiz, mit der Qudeman im »Sachverzeichnis« diesen Terminus begleitet,
reicht nicht ganz zu und sie kann nicht ganz zureichen, weil auf jegliche (historisch-
Senetische) Anknüpfung an die platonische Bedeutung des Wortes und an seinen
Zusammenhang mit der Ideenlehre verzichtet wird. Gewiß kann man auch zuviel
,n diesen Ausdruck hineininterpretieren, der von den Griechen in einem ganz un-
befangenen Sinn gebraucht worden ist. Aber an den unbefangenen Gebrauch des
Wortes knüpft sich der tiefere philosophische. Zwei Welten, die für den Griechen
111 eine zusammenflössen, werden durch die Mimesis verbunden. Sie bezeichnet
nicht mehr und nicht weniger als das illustrative Moment in allem Künstle-
rischen, das aber heißt: das theoretisch leicht erreichbare und (wie der »Naturalist«
meinen müßte, wenn er gleichzeitig Philosoph im Sinne Kants wäre) scheinbar nur
theoretisch zu erreichende Grundgerüst aller Kunstgestaltung, das sich leicht als
s°lches vom spezifisch Künstlerischen ablösen läßt, während umgekehrt dieses Künstle-
rische ein ganz Wesentliches zu verlieren scheint, ohne diese im weitesten Sinne
'"üstrative Grundlage. Ein Beispiel soll verdeutlichen, was ich meine. Daß das
Werk des Plastikers einen jungen Mann darstellt, ja daß es überhaupt einen Men-
schen darstellt, ist allbereits ein illustratives Moment am Kunstwerk. Ich
brauche das Urteil »dies ist ein Jüngling« nicht zu vollziehen (obwohl ich mir als
v°rzüglich theoretischer Mensch die Weltinhalte, die eine unendliche Aufgabenfülle
"'r mich enthalten und an die ich »problemlösend« herantrete, meistens auch auf
solche Weise »vergegenständlichen werde) und kann trotzdem den ästhetischen
Sinn des Gebildes vollgültig erfahren. Und nichtsdestoweniger ist diese ästhetische
Erfahrung wesentlich daran gebunden, daß es eben ein Mensch, ein Jüngling
lst) den der Künstler »dargestellt« hat und der körperlich-nackt vor uns
steht! Diese dürftige Andeutung des eigentlichen Problems der Mimesis (eine aus-
führlichere Behandlung habe ich unter Vermeidung aller historisch-belastelen Kunst-
ausdrücke in meinen Logosaufsätzen »Die ästhetische Sphäre« und »Das Dekorative«
'X, 1 und X, 1 gegeben) soll wenigstens ahnen lassen, auf welche philosophische
'■efenschicht mit diesem schlichten Ausdruck hinuntergedeutet wird; auf die Schicht
weder theoretisch noch ästhetisch noch irgendwie angetasteter »Gegebenheiten«
"ämlich, die Piaton metaphysisch als Ideen deutete — die Aristoteles dagegen
ans dieser metakosmischen Existenz in die Welt selber heraufgehoben hat im viel-
leicht ursprünglich-griechischen Sinne und im Sinne Goethes, daß nämlich die »Lehre«
(d. h. der Sinn, die Bedeutung, der Wert, die Idee) nicht »hinter den Phänomenen«
2U suchen sei, sondern daß beide im »Urerlebnis« eine Einheit bilden. Gudeman
Sleht das erkenntnistheoretische Problem überhaupt nicht (so wenig wie die eng-
lischen Kommentatoren, z. B. Bywater) und deutet die Mimesis rein psychologisch.
Beide halten sich getreu an die Überlieferung, die Weltanschauung und Fachwissen-
schaft (um den Gegensatz noch einmal ganz einfach zu formulieren) ineinander ge-
arbeitet darbietet — und sie tun recht daran; denn dieser Überlieferung gegenüber
muß noch eine große Arbeit vollzogen werden, ehe mit ihr philosophisch in einer
Weise verfahren werden kann, die den Boden der historischen Tatsachen niemals
unter den Füßen verliert, obwohl sie diesen historischen Sachbestand als solchen
auflösen muß, um ihn eben gerade zu verstehen. Aber nicht nur Finsler ver-
absolutiert innerhalb seines, wenn ich den Ausdruck gebrauchen darf: vorphiloso-
Phischen Aufgabenbezirkes seine als solche ganz vortreffliche ursprünglich philo-
'Ogisch-historisch-genetische Methode in der charakterisierten Weise, sondern auch
uudeman scheint mir ganz ähnlich seine mehr philologisch-systematische Betrach-
tungsart zu vereinseitigen. Dies führt mich auf seine Stellungnahme zur Mimesis-
Frage.
Die Notiz, mit der Qudeman im »Sachverzeichnis« diesen Terminus begleitet,
reicht nicht ganz zu und sie kann nicht ganz zureichen, weil auf jegliche (historisch-
Senetische) Anknüpfung an die platonische Bedeutung des Wortes und an seinen
Zusammenhang mit der Ideenlehre verzichtet wird. Gewiß kann man auch zuviel
,n diesen Ausdruck hineininterpretieren, der von den Griechen in einem ganz un-
befangenen Sinn gebraucht worden ist. Aber an den unbefangenen Gebrauch des
Wortes knüpft sich der tiefere philosophische. Zwei Welten, die für den Griechen
111 eine zusammenflössen, werden durch die Mimesis verbunden. Sie bezeichnet
nicht mehr und nicht weniger als das illustrative Moment in allem Künstle-
rischen, das aber heißt: das theoretisch leicht erreichbare und (wie der »Naturalist«
meinen müßte, wenn er gleichzeitig Philosoph im Sinne Kants wäre) scheinbar nur
theoretisch zu erreichende Grundgerüst aller Kunstgestaltung, das sich leicht als
s°lches vom spezifisch Künstlerischen ablösen läßt, während umgekehrt dieses Künstle-
rische ein ganz Wesentliches zu verlieren scheint, ohne diese im weitesten Sinne
'"üstrative Grundlage. Ein Beispiel soll verdeutlichen, was ich meine. Daß das
Werk des Plastikers einen jungen Mann darstellt, ja daß es überhaupt einen Men-
schen darstellt, ist allbereits ein illustratives Moment am Kunstwerk. Ich
brauche das Urteil »dies ist ein Jüngling« nicht zu vollziehen (obwohl ich mir als
v°rzüglich theoretischer Mensch die Weltinhalte, die eine unendliche Aufgabenfülle
"'r mich enthalten und an die ich »problemlösend« herantrete, meistens auch auf
solche Weise »vergegenständlichen werde) und kann trotzdem den ästhetischen
Sinn des Gebildes vollgültig erfahren. Und nichtsdestoweniger ist diese ästhetische
Erfahrung wesentlich daran gebunden, daß es eben ein Mensch, ein Jüngling
lst) den der Künstler »dargestellt« hat und der körperlich-nackt vor uns
steht! Diese dürftige Andeutung des eigentlichen Problems der Mimesis (eine aus-
führlichere Behandlung habe ich unter Vermeidung aller historisch-belastelen Kunst-
ausdrücke in meinen Logosaufsätzen »Die ästhetische Sphäre« und »Das Dekorative«
'X, 1 und X, 1 gegeben) soll wenigstens ahnen lassen, auf welche philosophische
'■efenschicht mit diesem schlichten Ausdruck hinuntergedeutet wird; auf die Schicht
weder theoretisch noch ästhetisch noch irgendwie angetasteter »Gegebenheiten«
"ämlich, die Piaton metaphysisch als Ideen deutete — die Aristoteles dagegen
ans dieser metakosmischen Existenz in die Welt selber heraufgehoben hat im viel-
leicht ursprünglich-griechischen Sinne und im Sinne Goethes, daß nämlich die »Lehre«
(d. h. der Sinn, die Bedeutung, der Wert, die Idee) nicht »hinter den Phänomenen«
2U suchen sei, sondern daß beide im »Urerlebnis« eine Einheit bilden. Gudeman
Sleht das erkenntnistheoretische Problem überhaupt nicht (so wenig wie die eng-
lischen Kommentatoren, z. B. Bywater) und deutet die Mimesis rein psychologisch.