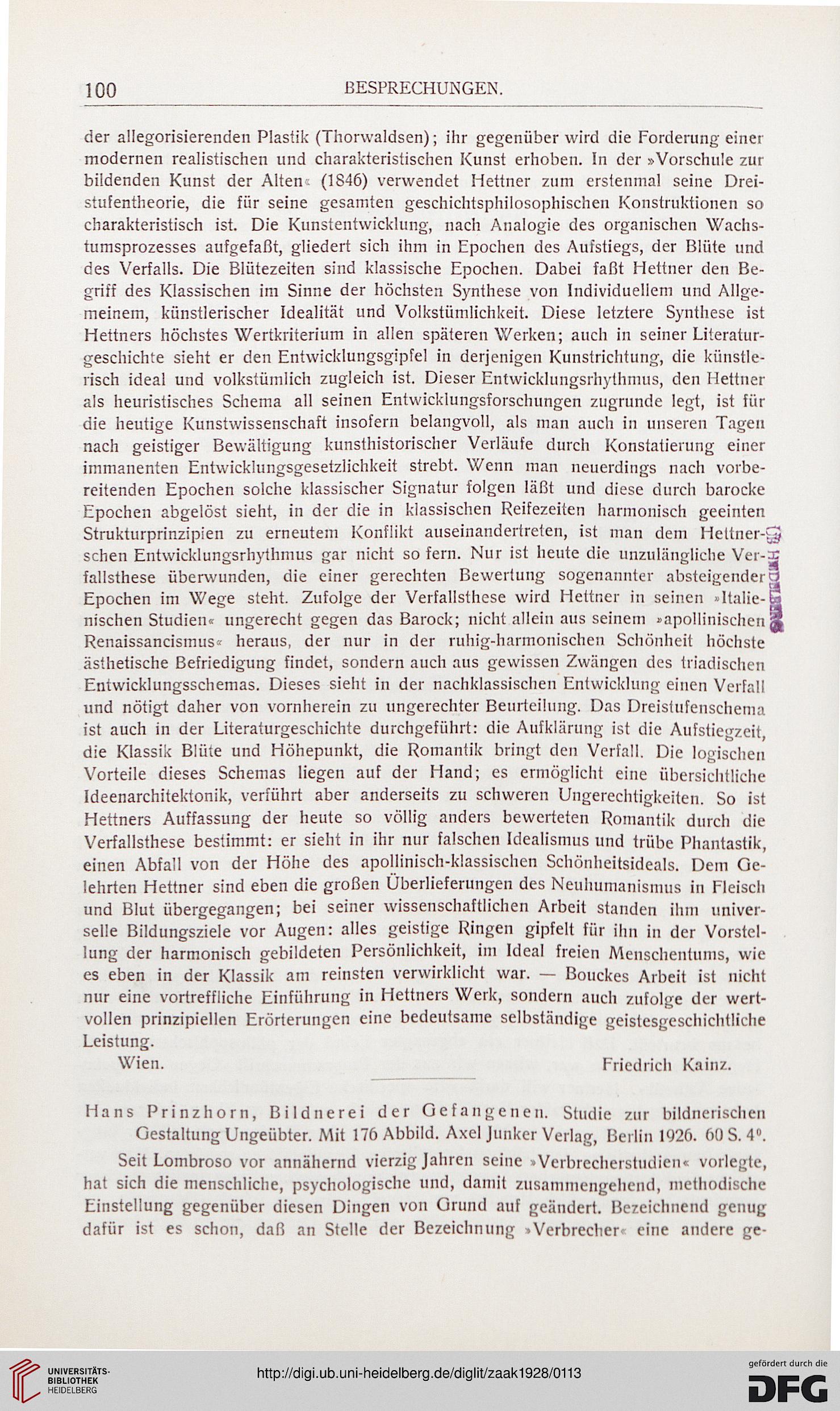100
BESPRECHUNGEN.
der allegorisierenden Plastik (Thorwaldsen); ihr gegenüber wird die Forderung einer
modernen realistischen und charakteristischen Kunst erhoben. In der »Vorschule zur
bildenden Kunst der Alten (1846) verwendet Hettner zum erstenmal seine Drei-
sttifentheorie, die für seine gesamten geschichtsphilosophischen Konstruktionen so
charakteristisch ist. Die Kunstentwicklung, nach Analogie des organischen Wachs-
tumsprozesses aufgefaßt, gliedert sich ihm in Epochen des Aufstiegs, der Blüte und
des Verfalls. Die Blütezeiten sind klassische Epochen. Dabei faßt Hettner den Be-
griff des Klassischen im Sinne der höchsten Synthese von Individuellem und Allge-
meinem, künstlerischer Idealität und Volkstümlichkeit. Diese letztere Synthese ist
Hettners höchstes Wertkriterium in allen späteren Werken; auch in seiner Literatur-
geschichte sieht er den Entwicklungsgipfel in derjenigen Kunstrichtung, die künstle-
risch ideal und volkstümlich zugleich ist. Dieser Entwicklungsrhythmus, den Hettner
als heuristisches Schema all seinen Entwicklungsforschungen zugrunde legt, ist für
die heutige Kunstwissenschaft insofern belangvoll, als man auch in unseren Tagen
nach geistiger Bewältigung kunsthistorischer Verläufe durch Konstatierung einer
immanenten Entwicklungsgesetzlichkeit strebt. Wenn man neuerdings nach vorbe-
reitenden Epochen solche klassischer Signatur folgen läßt und diese durch barocke
Epochen abgelöst sieht, in der die in klassischen Reifezeiten harmonisch geeinten
Strukturprinzipien zu erneutem Konflikt auseinandertreten, ist man dem Hettner-^
sehen Entwicklungsrhythmus gar nicht so fern. Nur ist heute die unzulängliche Ver-
fallsthese überwunden, die einer gerechten Bewertung sogenannter absteigender
Epochen im Wege steht. Zufolge der Verfallsthcse wird Hettner in seinen »Italie-
nischen Studien« ungerecht gegen das Barock; nicht allein aus seinem »apollinischen
Renaissancismus heraus, der nur in der ruhig-harmonischen Schönheit höchste
ästhetische Befriedigung findet, sondern auch aus gewissen Zwängen des triadischen
Eiuwicklungsschemas. Dieses sieht in der nachklassischen Entwicklung einen Verfall
und nötigt daher von vornherein zu ungerechter Beurteilung. Das Dreistufenschema
ist auch in der Literaturgeschichte durchgeführt: die Aufklärung ist die Aufsticzeit
die Klassik Blüte und Höhepunkt, die Romantik bringt den Verfall. Die logischen
Vorteile dieses Schemas liegen auf der Hand; es ermöglicht eine übersichtliche
Ideenarchitektonik, verführt aber anderseits zu schweren Ungerechtigkeiten. So ist
Hettners Auffassung der heute so völlig anders bewerteten Romantik durch die
Verfallsthese bestimmt: er sieht in ihr nur falschen Idealismus und trübe Phantastik,
einen Abfall von der Höhe des apollinisch-klassischen Schönheitsideals. Dem Ge-
lehrten Hettner sind eben die großen Überlieferungen des Neuhumanismus in Fleisch
und Blut übergegangen; bei seiner wissenschaftlichen Arbeit standen ihm univer-
selle Bildungsziele vor Augen: alles geistige Ringen gipfelt für ihn in der Vorstel-
lung der harmonisch gebildeten Persönlichkeit, im Ideal freien Menschentums, wie
es eben in der Klassik am reinsten verwirklicht war. — Bouckes Arbeit ist nicht
nur eine vortreffliche Einführung in Hettners Werk, sondern auch zufolge der wert-
vollen prinzipiellen Erörterungen eine bedeutsame selbständige geislesgeschichtliche
Leistung.
Wien. Friedrich Kainz.
Hans Prinzhorn, Bildnerei der Gefangenen. Studie zur bildnerischen
Gestaltung Ungeübter. Mit 176 Abbild. Axel Junker Verlag, Berlin 1926. 60 S. 4°.
Seit Lombroso vor annähernd vierzig Jahren seine »Verbrecherstudien« vorlegte,
hat sich die menschliche, psychologische und, damit zusammengehend, methodische
Einstellung gegenüber diesen Dingen von Grund auf geändert. Bezeichnend genug
dafür ist es schon, daß an Stelle der Bezeichnung »Verbrecher' eine andere ge-
BESPRECHUNGEN.
der allegorisierenden Plastik (Thorwaldsen); ihr gegenüber wird die Forderung einer
modernen realistischen und charakteristischen Kunst erhoben. In der »Vorschule zur
bildenden Kunst der Alten (1846) verwendet Hettner zum erstenmal seine Drei-
sttifentheorie, die für seine gesamten geschichtsphilosophischen Konstruktionen so
charakteristisch ist. Die Kunstentwicklung, nach Analogie des organischen Wachs-
tumsprozesses aufgefaßt, gliedert sich ihm in Epochen des Aufstiegs, der Blüte und
des Verfalls. Die Blütezeiten sind klassische Epochen. Dabei faßt Hettner den Be-
griff des Klassischen im Sinne der höchsten Synthese von Individuellem und Allge-
meinem, künstlerischer Idealität und Volkstümlichkeit. Diese letztere Synthese ist
Hettners höchstes Wertkriterium in allen späteren Werken; auch in seiner Literatur-
geschichte sieht er den Entwicklungsgipfel in derjenigen Kunstrichtung, die künstle-
risch ideal und volkstümlich zugleich ist. Dieser Entwicklungsrhythmus, den Hettner
als heuristisches Schema all seinen Entwicklungsforschungen zugrunde legt, ist für
die heutige Kunstwissenschaft insofern belangvoll, als man auch in unseren Tagen
nach geistiger Bewältigung kunsthistorischer Verläufe durch Konstatierung einer
immanenten Entwicklungsgesetzlichkeit strebt. Wenn man neuerdings nach vorbe-
reitenden Epochen solche klassischer Signatur folgen läßt und diese durch barocke
Epochen abgelöst sieht, in der die in klassischen Reifezeiten harmonisch geeinten
Strukturprinzipien zu erneutem Konflikt auseinandertreten, ist man dem Hettner-^
sehen Entwicklungsrhythmus gar nicht so fern. Nur ist heute die unzulängliche Ver-
fallsthese überwunden, die einer gerechten Bewertung sogenannter absteigender
Epochen im Wege steht. Zufolge der Verfallsthcse wird Hettner in seinen »Italie-
nischen Studien« ungerecht gegen das Barock; nicht allein aus seinem »apollinischen
Renaissancismus heraus, der nur in der ruhig-harmonischen Schönheit höchste
ästhetische Befriedigung findet, sondern auch aus gewissen Zwängen des triadischen
Eiuwicklungsschemas. Dieses sieht in der nachklassischen Entwicklung einen Verfall
und nötigt daher von vornherein zu ungerechter Beurteilung. Das Dreistufenschema
ist auch in der Literaturgeschichte durchgeführt: die Aufklärung ist die Aufsticzeit
die Klassik Blüte und Höhepunkt, die Romantik bringt den Verfall. Die logischen
Vorteile dieses Schemas liegen auf der Hand; es ermöglicht eine übersichtliche
Ideenarchitektonik, verführt aber anderseits zu schweren Ungerechtigkeiten. So ist
Hettners Auffassung der heute so völlig anders bewerteten Romantik durch die
Verfallsthese bestimmt: er sieht in ihr nur falschen Idealismus und trübe Phantastik,
einen Abfall von der Höhe des apollinisch-klassischen Schönheitsideals. Dem Ge-
lehrten Hettner sind eben die großen Überlieferungen des Neuhumanismus in Fleisch
und Blut übergegangen; bei seiner wissenschaftlichen Arbeit standen ihm univer-
selle Bildungsziele vor Augen: alles geistige Ringen gipfelt für ihn in der Vorstel-
lung der harmonisch gebildeten Persönlichkeit, im Ideal freien Menschentums, wie
es eben in der Klassik am reinsten verwirklicht war. — Bouckes Arbeit ist nicht
nur eine vortreffliche Einführung in Hettners Werk, sondern auch zufolge der wert-
vollen prinzipiellen Erörterungen eine bedeutsame selbständige geislesgeschichtliche
Leistung.
Wien. Friedrich Kainz.
Hans Prinzhorn, Bildnerei der Gefangenen. Studie zur bildnerischen
Gestaltung Ungeübter. Mit 176 Abbild. Axel Junker Verlag, Berlin 1926. 60 S. 4°.
Seit Lombroso vor annähernd vierzig Jahren seine »Verbrecherstudien« vorlegte,
hat sich die menschliche, psychologische und, damit zusammengehend, methodische
Einstellung gegenüber diesen Dingen von Grund auf geändert. Bezeichnend genug
dafür ist es schon, daß an Stelle der Bezeichnung »Verbrecher' eine andere ge-