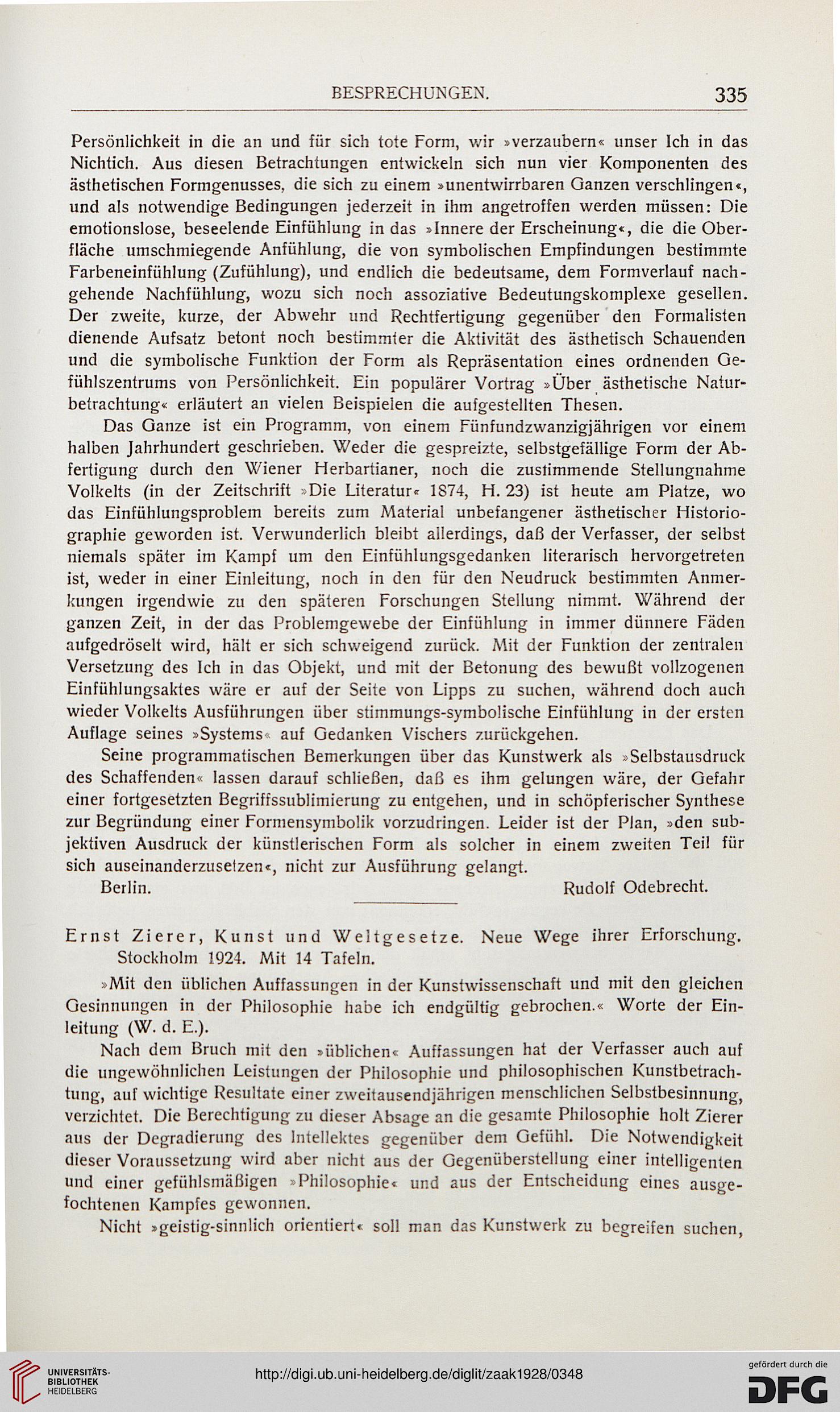BESPRECHUNGEN.
335
Persönlichkeit in die an und für sich tote Form, wir »verzaubern« unser Ich in das
Nichtich. Aus diesen Betrachtungen entwickeln sich nun vier Komponenten des
ästhetischen Formgenusses, die sich zu einem »unentwirrbaren Ganzen verschlingen«,
und als notwendige Bedingungen jederzeit in ihm angetroffen werden müssen: Die
emotionslose, beseelende Einfühlung in das »Innere der Erscheinung«, die die Ober-
fläche umschmiegende Anfühlung, die von symbolischen Empfindungen bestimmte
Farbeneinfühlung (Zufühlung), und endlich die bedeutsame, dem Formverlauf nach-
gehende Nachfühlung, wozu sich noch assoziative Bedeutungskomplexe gesellen.
Der zweite, kurze, der Abwehr und Rechtfertigung gegenüber den Formalisten
dienende Aufsatz betont noch bestimmter die Aktivität des ästhetisch Schauenden
und die symbolische Funktion der Form als Repräsentation eines ordnenden Ge-
fühlszentrums von Persönlichkeit. Ein populärer Vortrag »Über ästhetische Natur-
betrachtung« erläutert an vielen Beispielen die aufgestellten Thesen.
Das Ganze ist ein Programm, von einem Fünfundzwanzigjährigen vor einem
halben Jahrhundert geschrieben. Weder die gespreizte, selbstgefällige Form der Ab-
fertigung durch den Wiener Herbartianer, noch die zustimmende Stellungnahme
Volkelts (in der Zeitschrift Die Literatur« 1874, H. 23) ist heute am Platze, wo
das Einfühlungsproblem bereits zum Material unbefangener ästhetischer Historio-
graphie geworden ist. Verwunderlich bleibt allerdings, daß der Verfasser, der selbst
niemals später im Kampf um den Einfühlungsgedanken literarisch hervorgetreten
ist, weder in einer Einleitung, noch in den für den Neudruck bestimmten Anmer-
kungen irgendwie zu den späteren Forschungen Stellung nimmt. Während der
ganzen Zeit, in der das Problemgewebe der Einfühlung in immer dünnere Fäden
aufgedröselt wird, hält er sich schweigend zurück. Mit der Funktion der zentralen
Versetzung des Ich in das Objekt, und mit der Betonung des bewußt vollzogenen
Einfühlungsakles wäre er auf der Seite von Lipps zu suchen, während doch auch
wieder Volkelts Ausführungen über stimmungs-symboüsche Einfühlung in der ersten
Auflage seines »Systems auf Gedanken Vischers zurückgehen.
Seine programmatischen Bemerkungen über das Kunstwerk als »Selbstausdruck
des Schaffenden« lassen darauf schließen, daß es ihm gelungen wäre, der Gefahr
einer fortgesetzten Begriffssublimierung zu entgehen, und in schöpferischer Synthese
zur Begründung einer Formensymbolik vorzudringen. Leider ist der Plan, »den sub-
jektiven Ausdruck der künstlerischen Form als solcher in einem zweiten Teil für
sich auseinanderzusetzen«, nicht zur Ausführung gelangt.
Berlin. Rudolf Odebrecht.
Ernst Zierer, Kunst und Weltgesetze. Neue Wege ihrer Erforschung.
Stockholm 1924. Mit 14 Tafeln.
»Mit den üblichen Auffassungen in der Kunstwissenschaft und mit den gleichen
Gesinnungen in der Philosophie habe ich endgültig gebrochen.« Worte der Ein-
leitung (W. d. E.).
Nach dem Bruch mit den »üblichen« Auffassungen hat der Verfasser auch auf
die ungewöhnlichen Leistungen der Philosophie und philosophischen Kunstbetrach-
tung, auf wichtige Resultate einer zweitausendjährigen menschlichen Selbstbesinnung,
verzichtet. Die Berechtigung zu dieser Absage an die gesamte Philosophie holt Zierer
aus der Degradierung des Intellektes gegenüber dem Gefühl. Die Notwendigkeit
dieser Voraussetzung wird aber nicht aus der Gegenüberstellung einer intelligenten
und einer gefühlsmäßigen »Philosophie« und aus der Entscheidung eines ausge-
fochtcnen Kampfes gewonnen.
Nicht »geistig-sinnlich orientiert« soll man das Kunstwerk zu begreifen suchen,
335
Persönlichkeit in die an und für sich tote Form, wir »verzaubern« unser Ich in das
Nichtich. Aus diesen Betrachtungen entwickeln sich nun vier Komponenten des
ästhetischen Formgenusses, die sich zu einem »unentwirrbaren Ganzen verschlingen«,
und als notwendige Bedingungen jederzeit in ihm angetroffen werden müssen: Die
emotionslose, beseelende Einfühlung in das »Innere der Erscheinung«, die die Ober-
fläche umschmiegende Anfühlung, die von symbolischen Empfindungen bestimmte
Farbeneinfühlung (Zufühlung), und endlich die bedeutsame, dem Formverlauf nach-
gehende Nachfühlung, wozu sich noch assoziative Bedeutungskomplexe gesellen.
Der zweite, kurze, der Abwehr und Rechtfertigung gegenüber den Formalisten
dienende Aufsatz betont noch bestimmter die Aktivität des ästhetisch Schauenden
und die symbolische Funktion der Form als Repräsentation eines ordnenden Ge-
fühlszentrums von Persönlichkeit. Ein populärer Vortrag »Über ästhetische Natur-
betrachtung« erläutert an vielen Beispielen die aufgestellten Thesen.
Das Ganze ist ein Programm, von einem Fünfundzwanzigjährigen vor einem
halben Jahrhundert geschrieben. Weder die gespreizte, selbstgefällige Form der Ab-
fertigung durch den Wiener Herbartianer, noch die zustimmende Stellungnahme
Volkelts (in der Zeitschrift Die Literatur« 1874, H. 23) ist heute am Platze, wo
das Einfühlungsproblem bereits zum Material unbefangener ästhetischer Historio-
graphie geworden ist. Verwunderlich bleibt allerdings, daß der Verfasser, der selbst
niemals später im Kampf um den Einfühlungsgedanken literarisch hervorgetreten
ist, weder in einer Einleitung, noch in den für den Neudruck bestimmten Anmer-
kungen irgendwie zu den späteren Forschungen Stellung nimmt. Während der
ganzen Zeit, in der das Problemgewebe der Einfühlung in immer dünnere Fäden
aufgedröselt wird, hält er sich schweigend zurück. Mit der Funktion der zentralen
Versetzung des Ich in das Objekt, und mit der Betonung des bewußt vollzogenen
Einfühlungsakles wäre er auf der Seite von Lipps zu suchen, während doch auch
wieder Volkelts Ausführungen über stimmungs-symboüsche Einfühlung in der ersten
Auflage seines »Systems auf Gedanken Vischers zurückgehen.
Seine programmatischen Bemerkungen über das Kunstwerk als »Selbstausdruck
des Schaffenden« lassen darauf schließen, daß es ihm gelungen wäre, der Gefahr
einer fortgesetzten Begriffssublimierung zu entgehen, und in schöpferischer Synthese
zur Begründung einer Formensymbolik vorzudringen. Leider ist der Plan, »den sub-
jektiven Ausdruck der künstlerischen Form als solcher in einem zweiten Teil für
sich auseinanderzusetzen«, nicht zur Ausführung gelangt.
Berlin. Rudolf Odebrecht.
Ernst Zierer, Kunst und Weltgesetze. Neue Wege ihrer Erforschung.
Stockholm 1924. Mit 14 Tafeln.
»Mit den üblichen Auffassungen in der Kunstwissenschaft und mit den gleichen
Gesinnungen in der Philosophie habe ich endgültig gebrochen.« Worte der Ein-
leitung (W. d. E.).
Nach dem Bruch mit den »üblichen« Auffassungen hat der Verfasser auch auf
die ungewöhnlichen Leistungen der Philosophie und philosophischen Kunstbetrach-
tung, auf wichtige Resultate einer zweitausendjährigen menschlichen Selbstbesinnung,
verzichtet. Die Berechtigung zu dieser Absage an die gesamte Philosophie holt Zierer
aus der Degradierung des Intellektes gegenüber dem Gefühl. Die Notwendigkeit
dieser Voraussetzung wird aber nicht aus der Gegenüberstellung einer intelligenten
und einer gefühlsmäßigen »Philosophie« und aus der Entscheidung eines ausge-
fochtcnen Kampfes gewonnen.
Nicht »geistig-sinnlich orientiert« soll man das Kunstwerk zu begreifen suchen,