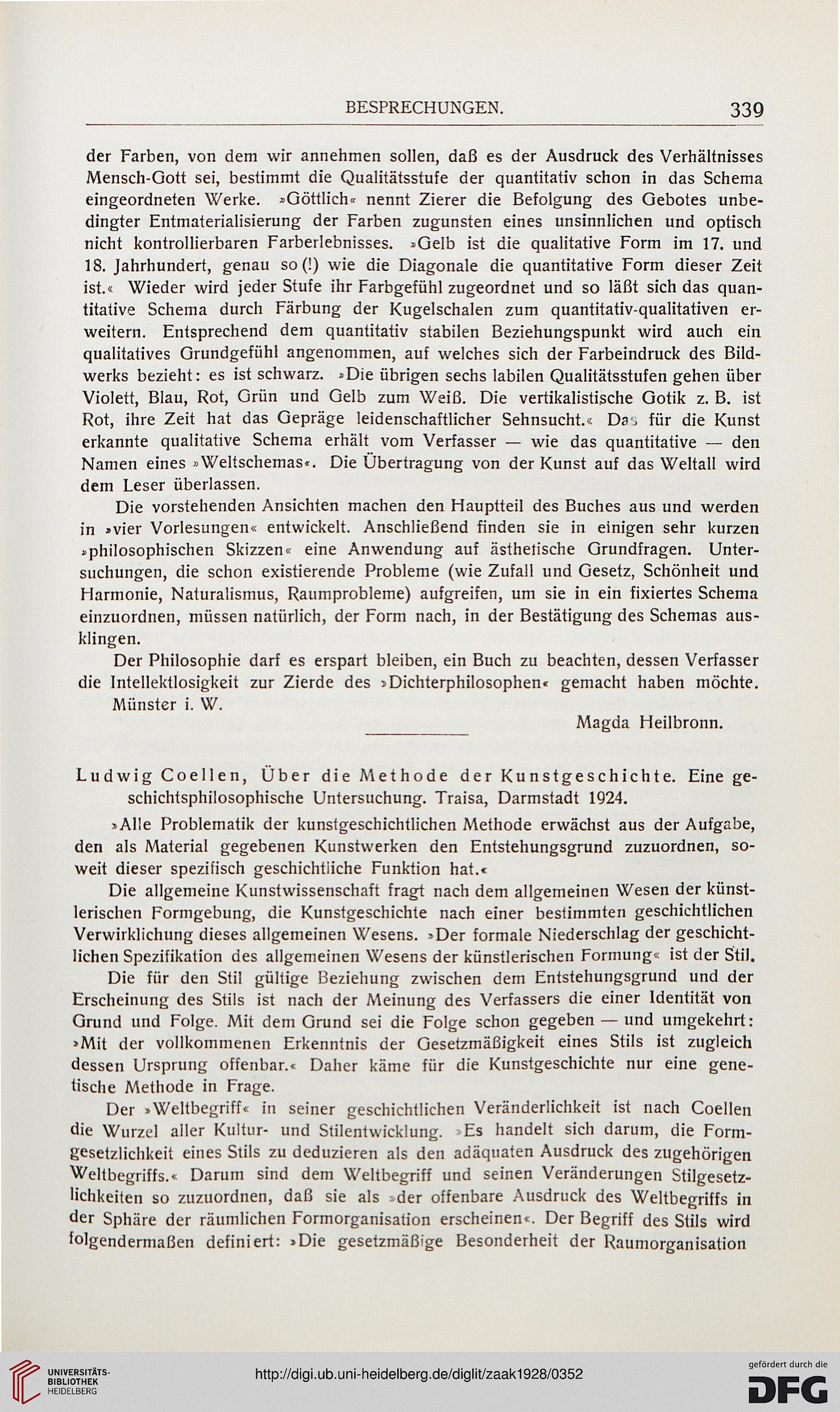BESPRECHUNGEN.
339
der Farben, von dem wir annehmen sollen, daß es der Ausdruck des Verhältnisses
Mensch-Gott sei, bestimmt die Qualitätsstufe der quantitativ schon in das Schema
eingeordneten Werke. »Göttlich« nennt Zierer die Befolgung des Gebotes unbe-
dingter Entmaterialisierung der Farben zugunsten eines unsinnlichen und optisch
nicht kontrollierbaren Farberlebnisses. »Gelb ist die qualitative Form im 17. und
18. Jahrhundert, genau so(!) wie die Diagonale die quantitative Form dieser Zeit
ist.« Wieder wird jeder Stufe ihr Farbgefühl zugeordnet und so läßt sich das quan-
titative Schema durch Färbung der Kugelschalen zum quantitativ-qualitativen er-
weitern. Entsprechend dem quantitativ stabilen Beziehungspunkt wird auch ein
qualitatives Grundgefühl angenommen, auf welches sich der Farbeindruck des Bild-
werks bezieht: es ist schwarz. »Die übrigen sechs labilen Qualitätsstufen gehen über
Violett, Blau, Rot, Grün und Gelb zum Weiß. Die vertikalistische Gotik z. B. ist
Rot, ihre Zeit hat das Gepräge leidenschaftlicher Sehnsucht.« Da , für die Kunst
erkannte qualitative Schema erhält vom Verfasser — wie das quantitative — den
Namen eines »Weltschemas«. Die Übertragung von der Kunst auf das Weltall wird
dem Leser überlassen.
Die vorstehenden Ansichten machen den Hauptteil des Buches aus und werden
in »vier Vorlesungen« entwickelt. Anschließend finden sie in einigen sehr kurzen
»philosophischen Skizzen« eine Anwendung auf ästhetische Grundfragen. Unter-
suchungen, die schon existierende Probleme (wie Zufall und Gesetz, Schönheit und
Harmonie, Naturalismus, Raumprobleme) aufgreifen, um sie in ein fixiertes Schema
einzuordnen, müssen natürlich, der Form nach, in der Bestätigung des Schemas aus-
klingen.
Der Philosophie darf es erspart bleiben, ein Buch zu beachten, dessen Verfasser
die Intellektlosigkeit zur Zierde des »Dichterphilosophen« gemacht haben möchte.
Münster i. W.
A^agda Heilbronn.
Ludwig Coellen, Über die Methode der Kunstgeschichte. Eine ge-
schichtsphilosophische Untersuchung. Traisa, Darmstadt 1924.
»Alle Problematik der kunstgeschichtlichen Methode erwächst aus der Aufgabe,
den als Material gegebenen Kunstwerken den Entstehungsgrund zuzuordnen, so-
weit dieser spezifisch geschichtliche Funktion hat.«
Die allgemeine Kunstwissenschaft fragt nach dem allgemeinen Wesen der künst-
lerischen Formgebung, die Kunstgeschichte nach einer bestimmten geschichtlichen
Verwirklichung dieses allgemeinen Wesens. »Der formale Niederschlag der geschicht-
lichen Spezifikation des allgemeinen Wesens der künstlerischen Formung« ist der Stil.
Die für den Stil gültige Beziehung zwischen dem Entstehungsgrund und der
Erscheinung des Stils ist nach der Meinung des Verfassers die einer Identität von
Grund und Folge. Mit dem Grund sei die Folge schon gegeben — und umgekehrt:
»Mit der vollkommenen Erkenntnis der Gesetzmäßigkeit eines Stils ist zugleich
dessen Ursprung offenbar.« Daher käme für die Kunstgeschichte nur eine gene-
tische Methode in Frage.
Der »Weltbegriff« in seiner geschichtlichen Veränderlichkeit ist nach Coellen
die Wurzel aller Kultur- und Stilentwicklung. »Es handelt sich darum, die Form-
gesetzlichkeit eines Stils zu deduzieren als den adäquaten Ausdruck des zugehörigen
Weltbegriffs.« Darum sind dem Weltbegriff und seinen Veränderungen Stilgesetz-
lichkeiten so zuzuordnen, daß sie als »der offenbare Ausdruck des Weltbegriffs in
der Sphäre der räumlichen Formorganisation erscheinen«. Der Begriff des Stils wird
folgendermaßen definiert: »Die gesetzmäßige Besonderheit der Raumorganisation
339
der Farben, von dem wir annehmen sollen, daß es der Ausdruck des Verhältnisses
Mensch-Gott sei, bestimmt die Qualitätsstufe der quantitativ schon in das Schema
eingeordneten Werke. »Göttlich« nennt Zierer die Befolgung des Gebotes unbe-
dingter Entmaterialisierung der Farben zugunsten eines unsinnlichen und optisch
nicht kontrollierbaren Farberlebnisses. »Gelb ist die qualitative Form im 17. und
18. Jahrhundert, genau so(!) wie die Diagonale die quantitative Form dieser Zeit
ist.« Wieder wird jeder Stufe ihr Farbgefühl zugeordnet und so läßt sich das quan-
titative Schema durch Färbung der Kugelschalen zum quantitativ-qualitativen er-
weitern. Entsprechend dem quantitativ stabilen Beziehungspunkt wird auch ein
qualitatives Grundgefühl angenommen, auf welches sich der Farbeindruck des Bild-
werks bezieht: es ist schwarz. »Die übrigen sechs labilen Qualitätsstufen gehen über
Violett, Blau, Rot, Grün und Gelb zum Weiß. Die vertikalistische Gotik z. B. ist
Rot, ihre Zeit hat das Gepräge leidenschaftlicher Sehnsucht.« Da , für die Kunst
erkannte qualitative Schema erhält vom Verfasser — wie das quantitative — den
Namen eines »Weltschemas«. Die Übertragung von der Kunst auf das Weltall wird
dem Leser überlassen.
Die vorstehenden Ansichten machen den Hauptteil des Buches aus und werden
in »vier Vorlesungen« entwickelt. Anschließend finden sie in einigen sehr kurzen
»philosophischen Skizzen« eine Anwendung auf ästhetische Grundfragen. Unter-
suchungen, die schon existierende Probleme (wie Zufall und Gesetz, Schönheit und
Harmonie, Naturalismus, Raumprobleme) aufgreifen, um sie in ein fixiertes Schema
einzuordnen, müssen natürlich, der Form nach, in der Bestätigung des Schemas aus-
klingen.
Der Philosophie darf es erspart bleiben, ein Buch zu beachten, dessen Verfasser
die Intellektlosigkeit zur Zierde des »Dichterphilosophen« gemacht haben möchte.
Münster i. W.
A^agda Heilbronn.
Ludwig Coellen, Über die Methode der Kunstgeschichte. Eine ge-
schichtsphilosophische Untersuchung. Traisa, Darmstadt 1924.
»Alle Problematik der kunstgeschichtlichen Methode erwächst aus der Aufgabe,
den als Material gegebenen Kunstwerken den Entstehungsgrund zuzuordnen, so-
weit dieser spezifisch geschichtliche Funktion hat.«
Die allgemeine Kunstwissenschaft fragt nach dem allgemeinen Wesen der künst-
lerischen Formgebung, die Kunstgeschichte nach einer bestimmten geschichtlichen
Verwirklichung dieses allgemeinen Wesens. »Der formale Niederschlag der geschicht-
lichen Spezifikation des allgemeinen Wesens der künstlerischen Formung« ist der Stil.
Die für den Stil gültige Beziehung zwischen dem Entstehungsgrund und der
Erscheinung des Stils ist nach der Meinung des Verfassers die einer Identität von
Grund und Folge. Mit dem Grund sei die Folge schon gegeben — und umgekehrt:
»Mit der vollkommenen Erkenntnis der Gesetzmäßigkeit eines Stils ist zugleich
dessen Ursprung offenbar.« Daher käme für die Kunstgeschichte nur eine gene-
tische Methode in Frage.
Der »Weltbegriff« in seiner geschichtlichen Veränderlichkeit ist nach Coellen
die Wurzel aller Kultur- und Stilentwicklung. »Es handelt sich darum, die Form-
gesetzlichkeit eines Stils zu deduzieren als den adäquaten Ausdruck des zugehörigen
Weltbegriffs.« Darum sind dem Weltbegriff und seinen Veränderungen Stilgesetz-
lichkeiten so zuzuordnen, daß sie als »der offenbare Ausdruck des Weltbegriffs in
der Sphäre der räumlichen Formorganisation erscheinen«. Der Begriff des Stils wird
folgendermaßen definiert: »Die gesetzmäßige Besonderheit der Raumorganisation