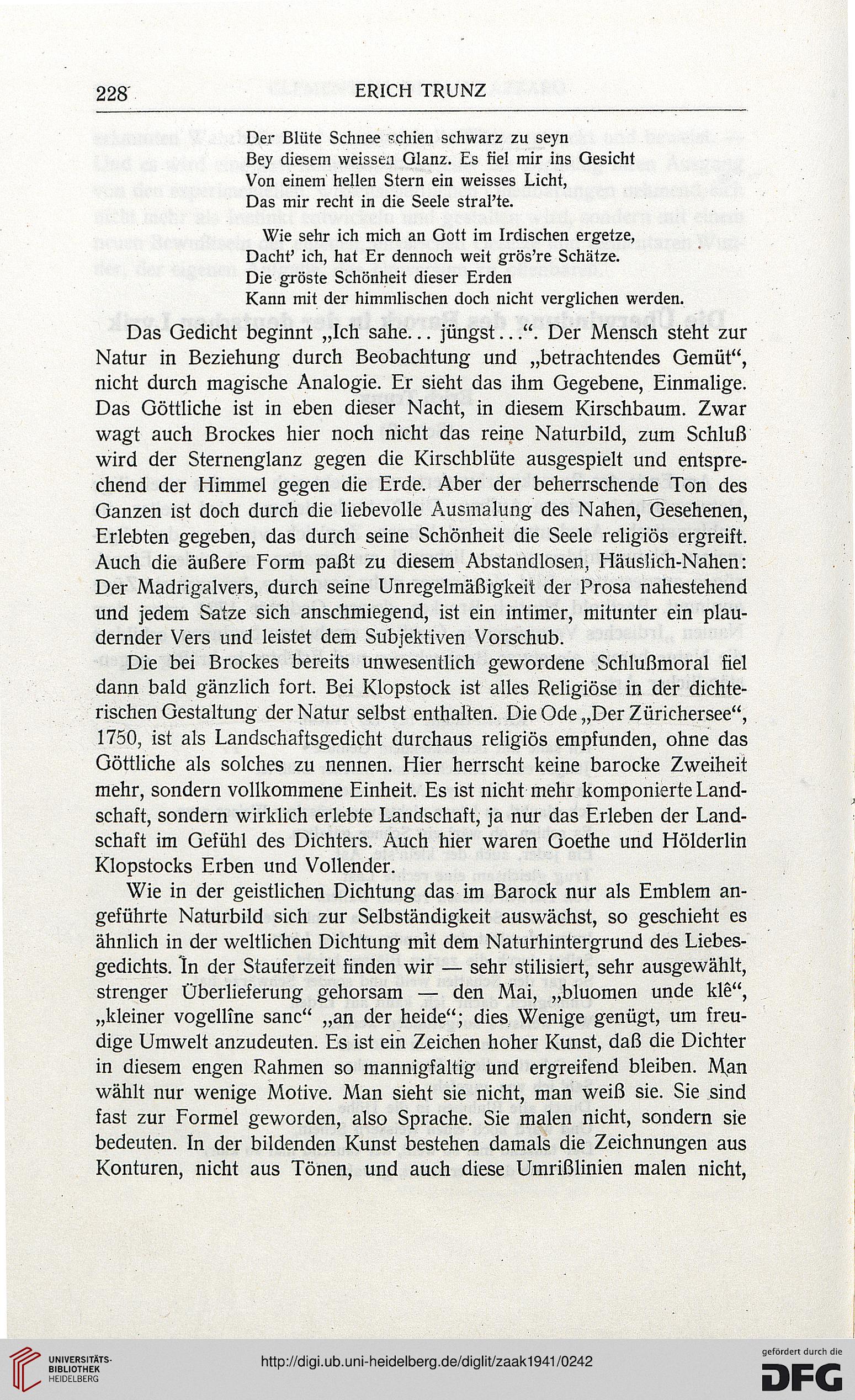228
ERICH TRUNZ
Der Blüte Schnee schien schwarz zu seyn
Bey diesem weissen Glanz. Es fiel mir ins Gesicht
Von einem hellen Stern ein weisses Licht,
Das mir recht in die Seele stral'te.
Wie sehr ich mich an Gott im Irdischen ergetze,
Dacht' ich, hat Er dennoch weit grös're Schätze.
Die gröste Schönheit dieser Erden
Kann mit der himmlischen doch nicht verglichen werden.
Das Gedicht beginnt „Ich sähe... jüngst...". Der Mensch steht zur
Natur in Beziehung durch Beobachtung und „betrachtendes Gemüt",
nicht durch magische Analogie. Er sieht das ihm Gegebene, Einmalige.
Das Göttliche ist in eben dieser Nacht, in diesem Kirschbaum. Zwar
wagt auch Brockes hier noch nicht das reine Naturbild, zum Schluß
wird der Sternenglanz gegen die Kirschblüte ausgespielt und entspre-
chend der Himmel gegen die Erde. Aber der beherrschende Ton des
Ganzen ist doch durch die liebevolle Ausmalung des Nahen, Gesehenen,
Erlebten gegeben, das durch seine Schönheit die Seele religiös ergreift.
Auch die äußere Form paßt zu diesem Abstandlosen, Häuslich-Nahen:
Der Madrigalvers, durch seine Unregelmäßigkeit der Prosa nahestehend
und jedem Satze sich anschmiegend, ist ein intimer, mitunter ein plau-
dernder Vers und leistet dem Subjektiven Vorschub.
Die bei Brockes bereits unwesentlich gewordene Schlußmoral fiel
dann bald gänzlich fort. Bei Klopstock ist alles Religiöse in der dichte-
rischen Gestaltung der Natur selbst enthalten. Die Ode „Der Zürichersee",
1750, ist als Landschaftsgedicht durchaus religiös empfunden, ohne das
Göttliche als solches zu nennen. Hier herrscht keine barocke Zweiheit
mehr, sondern vollkommene Einheit. Es ist nicht mehr komponierte Land-
schaft, sondern wirklich erlebte Landschaft, ja nur das Erleben der Land-
schaft im Gefühl des Dichters. Auch hier waren Goethe und Hölderlin
Klopstocks Erben und Vollender.
Wie in der geistlichen Dichtung das im Barock nur als Emblem an-
geführte Naturbild sich zur Selbständigkeit auswächst, so geschieht es
ähnlich in der weltlichen Dichtung mit dem Naturhintergrund des Liebes-
gedichts. In der Stauferzeit finden wir — sehr stilisiert, sehr ausgewählt,
strenger Überlieferung gehorsam — den Mai, „bluomen unde kle",
„kleiner vogelline sanc" „an der heide"; dies Wenige genügt, um freu-
dige Umwelt anzudeuten. Es ist ein Zeichen hoher Kunst, daß die Dichter
in diesem engen Rahmen so mannigfaltig und ergreifend bleiben. Man
wählt nur wenige Motive. Man sieht sie nicht, man weiß sie. Sie sind
fast zur Formel geworden, also Sprache. Sie malen nicht, sondern sie
bedeuten. In der bildenden Kunst bestehen damals die Zeichnungen aus
Konturen, nicht aus Tönen, und auch diese Umrißlinien malen nicht,
ERICH TRUNZ
Der Blüte Schnee schien schwarz zu seyn
Bey diesem weissen Glanz. Es fiel mir ins Gesicht
Von einem hellen Stern ein weisses Licht,
Das mir recht in die Seele stral'te.
Wie sehr ich mich an Gott im Irdischen ergetze,
Dacht' ich, hat Er dennoch weit grös're Schätze.
Die gröste Schönheit dieser Erden
Kann mit der himmlischen doch nicht verglichen werden.
Das Gedicht beginnt „Ich sähe... jüngst...". Der Mensch steht zur
Natur in Beziehung durch Beobachtung und „betrachtendes Gemüt",
nicht durch magische Analogie. Er sieht das ihm Gegebene, Einmalige.
Das Göttliche ist in eben dieser Nacht, in diesem Kirschbaum. Zwar
wagt auch Brockes hier noch nicht das reine Naturbild, zum Schluß
wird der Sternenglanz gegen die Kirschblüte ausgespielt und entspre-
chend der Himmel gegen die Erde. Aber der beherrschende Ton des
Ganzen ist doch durch die liebevolle Ausmalung des Nahen, Gesehenen,
Erlebten gegeben, das durch seine Schönheit die Seele religiös ergreift.
Auch die äußere Form paßt zu diesem Abstandlosen, Häuslich-Nahen:
Der Madrigalvers, durch seine Unregelmäßigkeit der Prosa nahestehend
und jedem Satze sich anschmiegend, ist ein intimer, mitunter ein plau-
dernder Vers und leistet dem Subjektiven Vorschub.
Die bei Brockes bereits unwesentlich gewordene Schlußmoral fiel
dann bald gänzlich fort. Bei Klopstock ist alles Religiöse in der dichte-
rischen Gestaltung der Natur selbst enthalten. Die Ode „Der Zürichersee",
1750, ist als Landschaftsgedicht durchaus religiös empfunden, ohne das
Göttliche als solches zu nennen. Hier herrscht keine barocke Zweiheit
mehr, sondern vollkommene Einheit. Es ist nicht mehr komponierte Land-
schaft, sondern wirklich erlebte Landschaft, ja nur das Erleben der Land-
schaft im Gefühl des Dichters. Auch hier waren Goethe und Hölderlin
Klopstocks Erben und Vollender.
Wie in der geistlichen Dichtung das im Barock nur als Emblem an-
geführte Naturbild sich zur Selbständigkeit auswächst, so geschieht es
ähnlich in der weltlichen Dichtung mit dem Naturhintergrund des Liebes-
gedichts. In der Stauferzeit finden wir — sehr stilisiert, sehr ausgewählt,
strenger Überlieferung gehorsam — den Mai, „bluomen unde kle",
„kleiner vogelline sanc" „an der heide"; dies Wenige genügt, um freu-
dige Umwelt anzudeuten. Es ist ein Zeichen hoher Kunst, daß die Dichter
in diesem engen Rahmen so mannigfaltig und ergreifend bleiben. Man
wählt nur wenige Motive. Man sieht sie nicht, man weiß sie. Sie sind
fast zur Formel geworden, also Sprache. Sie malen nicht, sondern sie
bedeuten. In der bildenden Kunst bestehen damals die Zeichnungen aus
Konturen, nicht aus Tönen, und auch diese Umrißlinien malen nicht,