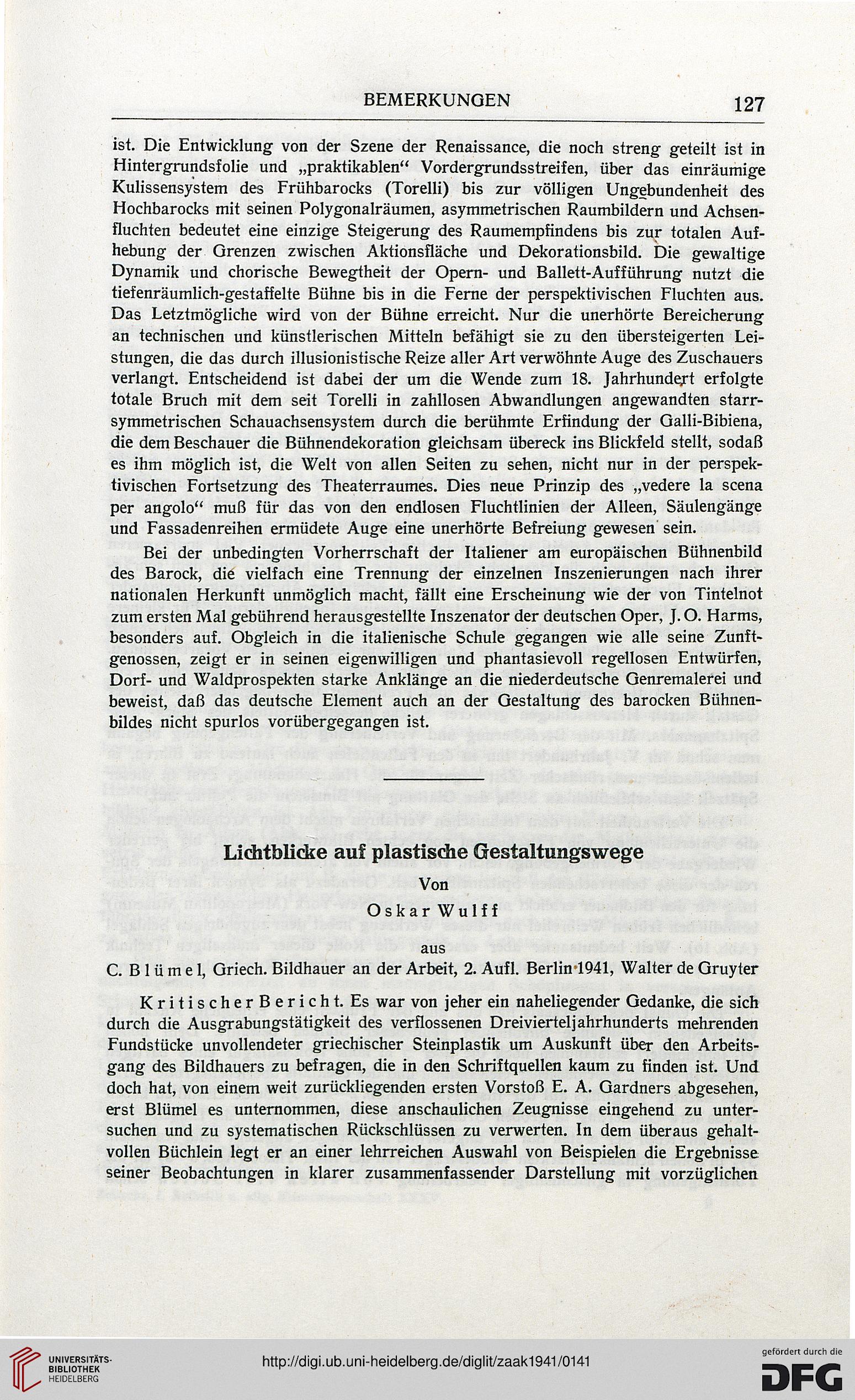BEMERKUNGEN
127
ist. Die Entwicklung von der Szene der Renaissance, die noch streng- geteilt ist in
Hintergrundsfolie und „praktikablen" Vordergrundsstreifen, über das einräumige
Kulissensystem des Frühbarocks (Torelli) bis zur völligen Ungebundenheit des
Hochbarocks mit seinen Polygonalräumen, asymmetrischen Raumbildern und Achsen-
fluchten bedeutet eine einzige Steigerung des Raumempfindens bis zur totalen Auf-
hebung der Grenzen zwischen Aktionsfläche und Dekorationsbild. Die gewaltige
Dynamik und chorische Bewegtheit der Opern- und Ballett-Aufführung nutzt die
tiefenräumlich-gestaffelte Bühne bis in die Ferne der perspektivischen Fluchten aus.
Das Letztmögliche wird von der Bühne erreicht. Nur die unerhörte Bereicherung
an technischen und künstlerischen Mitteln befähigt sie zu den übersteigerten Lei-
stungen, die das durch illusionistische Reize aller Art verwöhnte Auge des Zuschauers
verlangt. Entscheidend ist dabei der um die Wende zum 18. Jahrhundert erfolgte
totale Bruch mit dem seit Torelli in zahllosen Abwandlungen angewandten starr-
symmetrischen Schauachsensystem durch die berühmte Erfindung der Galli-Bibiena,
die dem Beschauer die Bühnendekoration gleichsam übereck ins Blickfeld stellt, sodaß
es ihm möglich ist, die Welt von allen Seiten zu sehen, nicht nur in der perspek-
tivischen Fortsetzung des Theaterraumes. Dies neue Prinzip des „vedere la scena
per angolo" muß für das von den endlosen Fluchtlinien der Alleen, Säulengänge
und Fassadenreihen ermüdete Auge eine unerhörte Befreiung gewesen sein.
Bei der unbedingten Vorherrschaft der Italiener am europäischen Bühnenbild
des Barock, die vielfach eine Trennung der einzelnen Inszenierungen nach ihrer
nationalen Herkunft unmöglich macht, fällt eine Erscheinung wie der von Tintelnot
zum ersten Mal gebührend herausgestellte Inszenator der deutschen Oper, J. O. Harms,
besonders auf. Obgleich in die italienische Schule gegangen wie alle seine Zunft-
genossen, zeigt er in seinen eigenwilligen und phantasievoll regellosen Entwürfen,
Dorf- und Waldprospekten starke Anklänge an die niederdeutsche Genremalerei und
beweist, daß das deutsche Element auch an der Gestaltung des barocken Bühnen-
bildes nicht spurlos vorübergegangen ist.
Lichtblicke auf plastische Gestaltungswege
Von
Oskar Wulf f
aus
C. B 1 ü tn e 1, Griech. Bildhauer an der Arbeit, 2. Aufl. Berlin 1941, Walter de Gruyter
KritischerBericht. Es war von jeher ein naheliegender Gedanke, die sich
durch die Ausgrabungstätigkeit des verflossenen Dreivierteljahrhunderts mehrenden
Fundstücke unvollendeter griechischer Steinplastik um Auskunft über den Arbeits-
gang des Bildhauers zu befragen, die in den Schriftquellen kaum zu finden ist. Und
doch hat, von einem weit zurückliegenden ersten Vorstoß E. A. Gardners abgesehen,
erst Blümel es unternommen, diese anschaulichen Zeugnisse eingehend zu unter-
suchen und zu systematischen Rückschlüssen zu verwerten. In dem überaus gehalt-
vollen Büchlein legt er an einer lehrreichen Auswahl von Beispielen die Ergebnisse
seiner Beobachtungen in klarer zusammenfassender Darstellung mit vorzüglichen
127
ist. Die Entwicklung von der Szene der Renaissance, die noch streng- geteilt ist in
Hintergrundsfolie und „praktikablen" Vordergrundsstreifen, über das einräumige
Kulissensystem des Frühbarocks (Torelli) bis zur völligen Ungebundenheit des
Hochbarocks mit seinen Polygonalräumen, asymmetrischen Raumbildern und Achsen-
fluchten bedeutet eine einzige Steigerung des Raumempfindens bis zur totalen Auf-
hebung der Grenzen zwischen Aktionsfläche und Dekorationsbild. Die gewaltige
Dynamik und chorische Bewegtheit der Opern- und Ballett-Aufführung nutzt die
tiefenräumlich-gestaffelte Bühne bis in die Ferne der perspektivischen Fluchten aus.
Das Letztmögliche wird von der Bühne erreicht. Nur die unerhörte Bereicherung
an technischen und künstlerischen Mitteln befähigt sie zu den übersteigerten Lei-
stungen, die das durch illusionistische Reize aller Art verwöhnte Auge des Zuschauers
verlangt. Entscheidend ist dabei der um die Wende zum 18. Jahrhundert erfolgte
totale Bruch mit dem seit Torelli in zahllosen Abwandlungen angewandten starr-
symmetrischen Schauachsensystem durch die berühmte Erfindung der Galli-Bibiena,
die dem Beschauer die Bühnendekoration gleichsam übereck ins Blickfeld stellt, sodaß
es ihm möglich ist, die Welt von allen Seiten zu sehen, nicht nur in der perspek-
tivischen Fortsetzung des Theaterraumes. Dies neue Prinzip des „vedere la scena
per angolo" muß für das von den endlosen Fluchtlinien der Alleen, Säulengänge
und Fassadenreihen ermüdete Auge eine unerhörte Befreiung gewesen sein.
Bei der unbedingten Vorherrschaft der Italiener am europäischen Bühnenbild
des Barock, die vielfach eine Trennung der einzelnen Inszenierungen nach ihrer
nationalen Herkunft unmöglich macht, fällt eine Erscheinung wie der von Tintelnot
zum ersten Mal gebührend herausgestellte Inszenator der deutschen Oper, J. O. Harms,
besonders auf. Obgleich in die italienische Schule gegangen wie alle seine Zunft-
genossen, zeigt er in seinen eigenwilligen und phantasievoll regellosen Entwürfen,
Dorf- und Waldprospekten starke Anklänge an die niederdeutsche Genremalerei und
beweist, daß das deutsche Element auch an der Gestaltung des barocken Bühnen-
bildes nicht spurlos vorübergegangen ist.
Lichtblicke auf plastische Gestaltungswege
Von
Oskar Wulf f
aus
C. B 1 ü tn e 1, Griech. Bildhauer an der Arbeit, 2. Aufl. Berlin 1941, Walter de Gruyter
KritischerBericht. Es war von jeher ein naheliegender Gedanke, die sich
durch die Ausgrabungstätigkeit des verflossenen Dreivierteljahrhunderts mehrenden
Fundstücke unvollendeter griechischer Steinplastik um Auskunft über den Arbeits-
gang des Bildhauers zu befragen, die in den Schriftquellen kaum zu finden ist. Und
doch hat, von einem weit zurückliegenden ersten Vorstoß E. A. Gardners abgesehen,
erst Blümel es unternommen, diese anschaulichen Zeugnisse eingehend zu unter-
suchen und zu systematischen Rückschlüssen zu verwerten. In dem überaus gehalt-
vollen Büchlein legt er an einer lehrreichen Auswahl von Beispielen die Ergebnisse
seiner Beobachtungen in klarer zusammenfassender Darstellung mit vorzüglichen