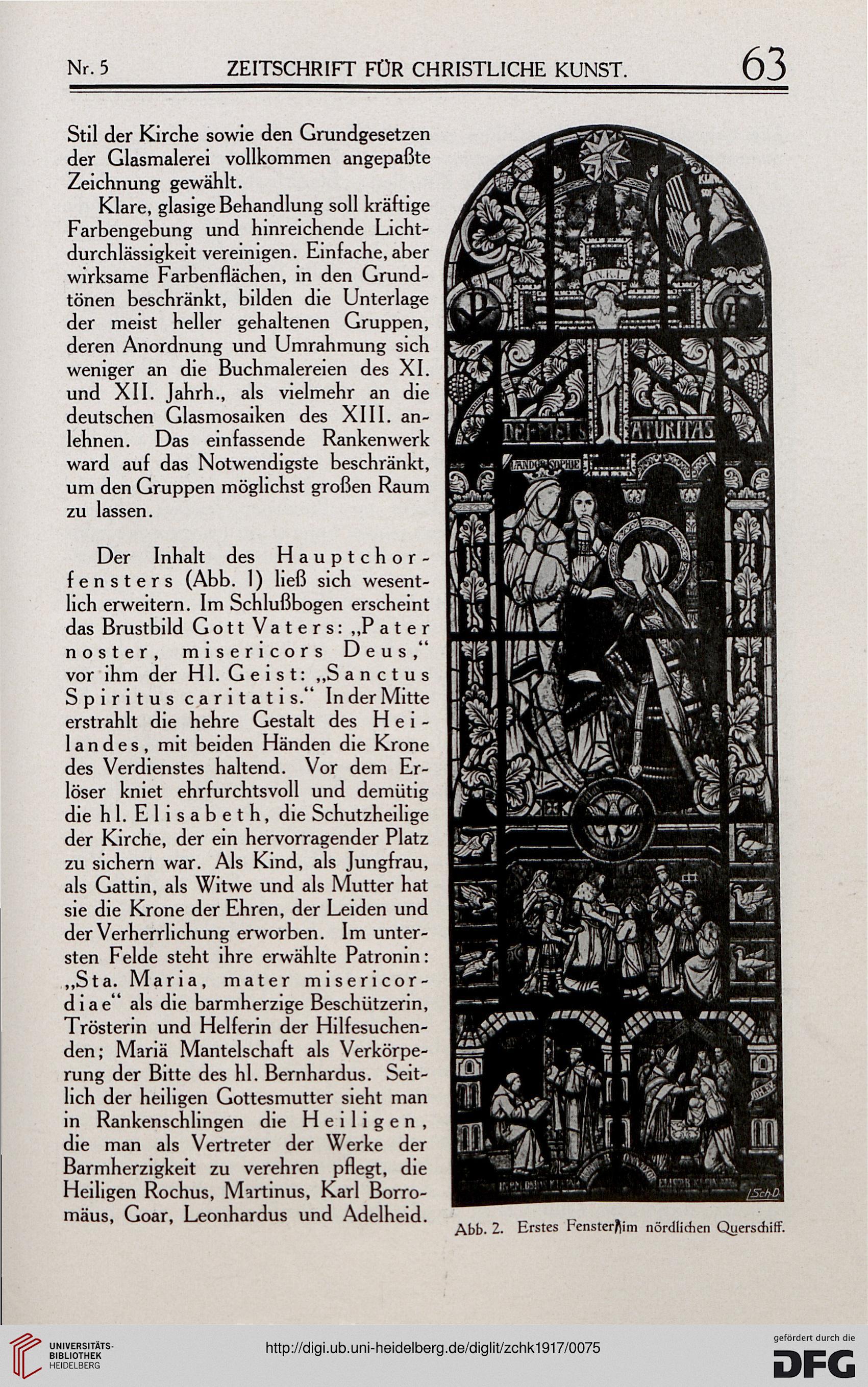Nr. 5
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
63
Stil der Kirche sowie den Grundgesetzen
der Glasmalerei vollkommen angepaßte
Zeichnung gewählt.
Klare, glasige Behandlung soll kräftige
Farbengebung und hinreichende Licht-
durchlässigkeit vereinigen. Einfache, aber
wirksame Farbenflächen, in den Grund-
tönen beschränkt, bilden die Unterlage
der meist heller gehaltenen Gruppen,
deren Anordnung und Umrahmung sich
weniger an die Buchmalereien des XI.
und XII. Jahrh., als vielmehr an die
deutschen Glasmosaiken des XIII. an-
lehnen. Das einfassende Rankenwerk
ward auf das Notwendigste beschränkt,
um den Gruppen möglichst großen Raum
zu lassen.
Der Inhalt des Hauptchor-
fensters (Abb. 1) ließ sich wesent-
lich erweitern. Im Schlußbogen erscheint
das Brustbild Gott Vaters: „Pater
noster, misericors Deus,"
vor ihm der Hl. Geist: „Sanctus
Spiritus caritati s." In der Mitte
erstrahlt die hehre Gestalt des Hei-
landes, mit beiden Händen die Krone
des Verdienstes haltend. Vor dem Er-
löser kniet ehrfurchtsvoll und demütig
die hl. Elisabeth, die Schutzheilige
der Kirche, der ein hervorragender Platz
zu sichern war. Als Kind, als Jungfrau,
als Gattin, als Witwe und als Mutter hat
sie die Krone der Ehren, der Leiden und
der Verherrlichung erworben. Im unter-
sten Felde steht ihre erwählte Patronin:
,,Sta. Maria, mater misericor-
diae" als die barmherzige Beschützerin,
Trösterin und Helferin der Hilfesuchen-
den; Maria Mantelschaft als Verkörpe-
rung der Bitte des hl. Bernhardus. Seit-
lich der heiligen Gottesmutter sieht man
in Rankenschlingen die Heiligen,
die man als Vertreter der Werke der
Barmherzigkeit zu verehren pflegt, die
Heiligen Rochus, Martinus, Karl Borro-
mäus, Goar, Leonhardus und Adelheid.
Abb. 2. Erstes Fensterflim nördlichen Quersdiiff.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
63
Stil der Kirche sowie den Grundgesetzen
der Glasmalerei vollkommen angepaßte
Zeichnung gewählt.
Klare, glasige Behandlung soll kräftige
Farbengebung und hinreichende Licht-
durchlässigkeit vereinigen. Einfache, aber
wirksame Farbenflächen, in den Grund-
tönen beschränkt, bilden die Unterlage
der meist heller gehaltenen Gruppen,
deren Anordnung und Umrahmung sich
weniger an die Buchmalereien des XI.
und XII. Jahrh., als vielmehr an die
deutschen Glasmosaiken des XIII. an-
lehnen. Das einfassende Rankenwerk
ward auf das Notwendigste beschränkt,
um den Gruppen möglichst großen Raum
zu lassen.
Der Inhalt des Hauptchor-
fensters (Abb. 1) ließ sich wesent-
lich erweitern. Im Schlußbogen erscheint
das Brustbild Gott Vaters: „Pater
noster, misericors Deus,"
vor ihm der Hl. Geist: „Sanctus
Spiritus caritati s." In der Mitte
erstrahlt die hehre Gestalt des Hei-
landes, mit beiden Händen die Krone
des Verdienstes haltend. Vor dem Er-
löser kniet ehrfurchtsvoll und demütig
die hl. Elisabeth, die Schutzheilige
der Kirche, der ein hervorragender Platz
zu sichern war. Als Kind, als Jungfrau,
als Gattin, als Witwe und als Mutter hat
sie die Krone der Ehren, der Leiden und
der Verherrlichung erworben. Im unter-
sten Felde steht ihre erwählte Patronin:
,,Sta. Maria, mater misericor-
diae" als die barmherzige Beschützerin,
Trösterin und Helferin der Hilfesuchen-
den; Maria Mantelschaft als Verkörpe-
rung der Bitte des hl. Bernhardus. Seit-
lich der heiligen Gottesmutter sieht man
in Rankenschlingen die Heiligen,
die man als Vertreter der Werke der
Barmherzigkeit zu verehren pflegt, die
Heiligen Rochus, Martinus, Karl Borro-
mäus, Goar, Leonhardus und Adelheid.
Abb. 2. Erstes Fensterflim nördlichen Quersdiiff.