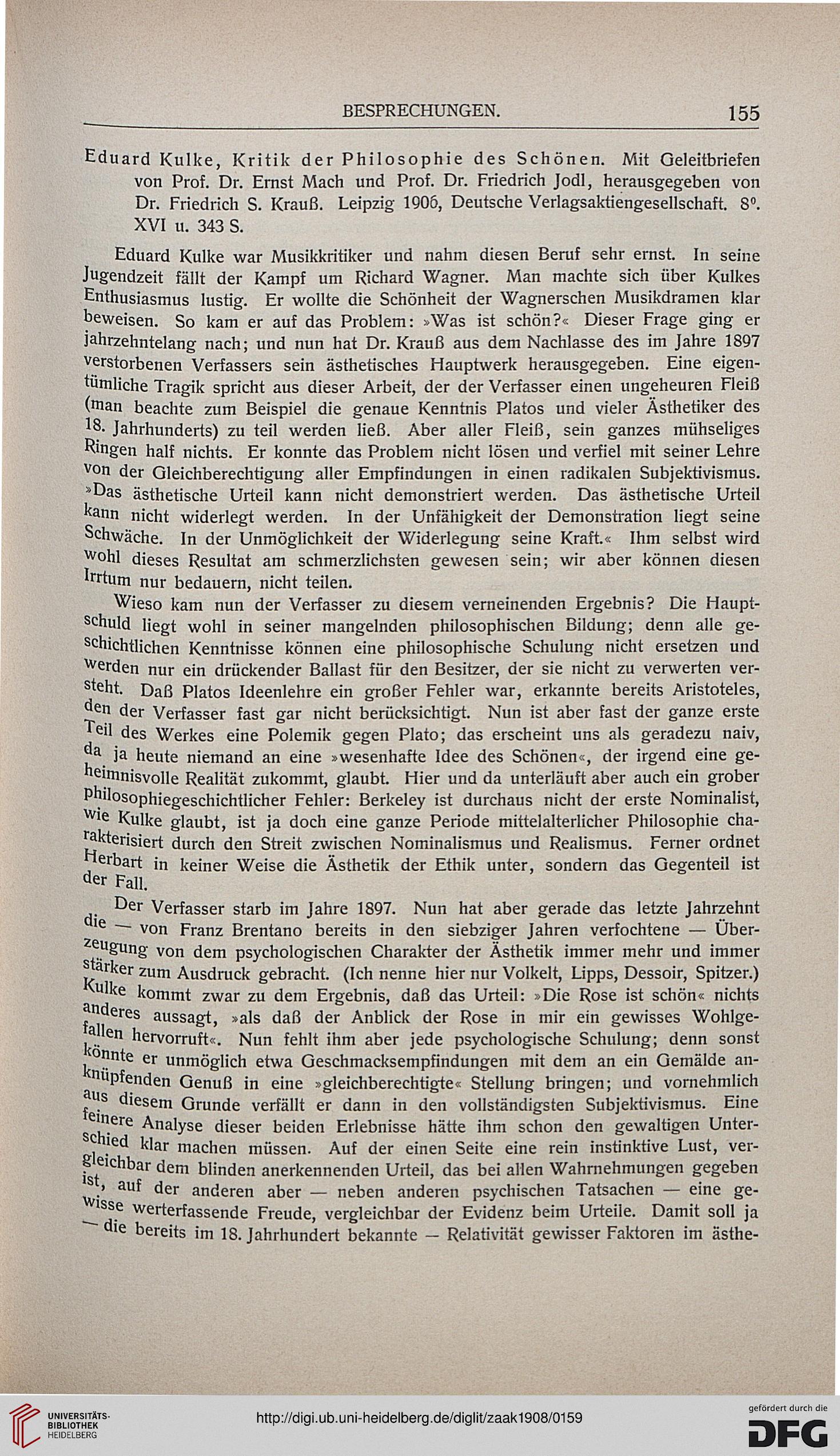BESPRECHUNGEN.
155
Eduard Kulke, Kritik der Philosophie des Schönen. Mit Geleitbriefen
von Prof. Dr. Ernst Mach und Prof. Dr. Friedrich Jodl, herausgegeben von
Dr. Friedrich S. Krauß. Leipzig 1906, Deutsche Verlagsaktiengesellschaft. 8°.
XVI u. 343 S.
Eduard Kulke war Musikkritiker und nahm diesen Beruf sehr ernst. In seine
Jugendzeit fällt der Kampf um Richard Wagner. Man machte sich über Kulkes
Enthusiasmus lustig. Er wollte die Schönheit der Wagnerschen Musikdramen klar
beweisen. So kam er auf das Problem: »Was ist schön?« Dieser Frage ging er
Jahrzehntelang nach; und nun hat Dr. Krauß aus dem Nachlasse des im Jahre 1897
verstorbenen Verfassers sein ästhetisches Hauptwerk herausgegeben. Eine eigen-
tümliche Tragik spricht aus dieser Arbeit, der der Verfasser einen ungeheuren Fleiß
(man beachte zum Beispiel die genaue Kenntnis Piatos und vieler Ästhetiker des
!°- Jahrhunderts) zu teil werden ließ. Aber aller Fleiß, sein ganzes mühseliges
^•ngen half nichts. Er konnte das Problem nicht lösen und verfiel mit seiner Lehre
von der Gleichberechtigung aller Empfindungen in einen radikalen Subjektivismus.
"Das ästhetische Urteil kann nicht demonstriert werden. Das ästhetische Urteil
kann nicht widerlegt werden. In der Unfähigkeit der Demonstration liegt seine
Schwäche. In der Unmöglichkeit der Widerlegung seine Kraft.« Ihm selbst wird
Wohl dieses Resultat am schmerzlichsten gewesen sein; wir aber können diesen
Irrtum nur bedauern, nicht teilen.
Wieso kam nun der Verfasser zu diesem verneinenden Ergebnis? Die Haupt-
schuld liegt wohl in seiner mangelnden philosophischen Bildung; denn alle ge-
schichtlichen Kenntnisse können eine philosophische Schulung nicht ersetzen und
werden nur ein drückender Ballast für den Besitzer, der sie nicht zu verwerten ver-
geht. Daß Piatos Ideenlehre ein großer Fehler war, erkannte bereits Aristoteles,
uen der Verfasser fast gar nicht berücksichtigt. Nun ist aber fast der ganze erste
eil des Werkes eine Polemik gegen Plato; das erscheint uns als geradezu naiv,
,a ja heute niemand an eine »wesenhafte Idee des Schönen«, der irgend eine ge-
heimnisvolle Realität zukommt, glaubt. Hier und da unterläuft aber auch ein grober
Philosophiegeschichtlicher Fehler: Berkeley ist durchaus nicht der erste Nominalist,
le Kulke glaubt, ist ja doch eine ganze Periode mittelalterlicher Philosophie cha-
Jjkterisiert durch den Streit zwischen Nominalismus und Realismus. Ferner ordnet
erbart in keiner Weise die Ästhetik der Ethik unter, sondern das Gegenteil ist
der Fan.
Der Verfasser starb im Jahre 1897. Nun hat aber gerade das letzte Jahrzehnt
—' von Franz Brentano bereits in den siebziger Jahren verfochtene — Über-
ugung von dem psychologischen Charakter der Ästhetik immer mehr und immer
arker zum Ausdruck gebracht. (Ich nenne hier nur Volkelt, Lipps, Dessoir, Spitzer.)
'ke kommt zwar zu dem Ergebnis, daß das Urteil: »Die Rose ist schön« nichts
«eres aussagt, »als daß der Anblick der Rose in mir ein gewisses Wohlge-
en hervorruft«. Nun fehlt ihm aber jede psychologische Schulung; denn sonst
nnte er unmöglich etwa Geschmacksempfindungen mit dem an ein Gemälde an-
upfenden Genuß in eine »gleichberechtigte« Stellung bringen; und vornehmlich
s diesem Grunde verfällt er dann in den vollständigsten Subjektivismus. Eine
"Tiere Analyse dieser beiden Erlebnisse hätte ihm schon den gewaltigen Unter-
led klar machen müssen. Auf der einen Seite eine rein instinktive Lust, ver-
is,eicnbar dem blinden anerkennenden Urteil, das bei allen Wahrnehmungen gegeben
> auf der anderen aber — neben anderen psychischen Tatsachen — eine ge-
^jsse werterfassende Freude, vergleichbar der Evidenz beim Urteile. Damit soll ja
le bereits im 18. Jahrhundert bekannte — Relativität gewisser Faktoren im ästhe-
155
Eduard Kulke, Kritik der Philosophie des Schönen. Mit Geleitbriefen
von Prof. Dr. Ernst Mach und Prof. Dr. Friedrich Jodl, herausgegeben von
Dr. Friedrich S. Krauß. Leipzig 1906, Deutsche Verlagsaktiengesellschaft. 8°.
XVI u. 343 S.
Eduard Kulke war Musikkritiker und nahm diesen Beruf sehr ernst. In seine
Jugendzeit fällt der Kampf um Richard Wagner. Man machte sich über Kulkes
Enthusiasmus lustig. Er wollte die Schönheit der Wagnerschen Musikdramen klar
beweisen. So kam er auf das Problem: »Was ist schön?« Dieser Frage ging er
Jahrzehntelang nach; und nun hat Dr. Krauß aus dem Nachlasse des im Jahre 1897
verstorbenen Verfassers sein ästhetisches Hauptwerk herausgegeben. Eine eigen-
tümliche Tragik spricht aus dieser Arbeit, der der Verfasser einen ungeheuren Fleiß
(man beachte zum Beispiel die genaue Kenntnis Piatos und vieler Ästhetiker des
!°- Jahrhunderts) zu teil werden ließ. Aber aller Fleiß, sein ganzes mühseliges
^•ngen half nichts. Er konnte das Problem nicht lösen und verfiel mit seiner Lehre
von der Gleichberechtigung aller Empfindungen in einen radikalen Subjektivismus.
"Das ästhetische Urteil kann nicht demonstriert werden. Das ästhetische Urteil
kann nicht widerlegt werden. In der Unfähigkeit der Demonstration liegt seine
Schwäche. In der Unmöglichkeit der Widerlegung seine Kraft.« Ihm selbst wird
Wohl dieses Resultat am schmerzlichsten gewesen sein; wir aber können diesen
Irrtum nur bedauern, nicht teilen.
Wieso kam nun der Verfasser zu diesem verneinenden Ergebnis? Die Haupt-
schuld liegt wohl in seiner mangelnden philosophischen Bildung; denn alle ge-
schichtlichen Kenntnisse können eine philosophische Schulung nicht ersetzen und
werden nur ein drückender Ballast für den Besitzer, der sie nicht zu verwerten ver-
geht. Daß Piatos Ideenlehre ein großer Fehler war, erkannte bereits Aristoteles,
uen der Verfasser fast gar nicht berücksichtigt. Nun ist aber fast der ganze erste
eil des Werkes eine Polemik gegen Plato; das erscheint uns als geradezu naiv,
,a ja heute niemand an eine »wesenhafte Idee des Schönen«, der irgend eine ge-
heimnisvolle Realität zukommt, glaubt. Hier und da unterläuft aber auch ein grober
Philosophiegeschichtlicher Fehler: Berkeley ist durchaus nicht der erste Nominalist,
le Kulke glaubt, ist ja doch eine ganze Periode mittelalterlicher Philosophie cha-
Jjkterisiert durch den Streit zwischen Nominalismus und Realismus. Ferner ordnet
erbart in keiner Weise die Ästhetik der Ethik unter, sondern das Gegenteil ist
der Fan.
Der Verfasser starb im Jahre 1897. Nun hat aber gerade das letzte Jahrzehnt
—' von Franz Brentano bereits in den siebziger Jahren verfochtene — Über-
ugung von dem psychologischen Charakter der Ästhetik immer mehr und immer
arker zum Ausdruck gebracht. (Ich nenne hier nur Volkelt, Lipps, Dessoir, Spitzer.)
'ke kommt zwar zu dem Ergebnis, daß das Urteil: »Die Rose ist schön« nichts
«eres aussagt, »als daß der Anblick der Rose in mir ein gewisses Wohlge-
en hervorruft«. Nun fehlt ihm aber jede psychologische Schulung; denn sonst
nnte er unmöglich etwa Geschmacksempfindungen mit dem an ein Gemälde an-
upfenden Genuß in eine »gleichberechtigte« Stellung bringen; und vornehmlich
s diesem Grunde verfällt er dann in den vollständigsten Subjektivismus. Eine
"Tiere Analyse dieser beiden Erlebnisse hätte ihm schon den gewaltigen Unter-
led klar machen müssen. Auf der einen Seite eine rein instinktive Lust, ver-
is,eicnbar dem blinden anerkennenden Urteil, das bei allen Wahrnehmungen gegeben
> auf der anderen aber — neben anderen psychischen Tatsachen — eine ge-
^jsse werterfassende Freude, vergleichbar der Evidenz beim Urteile. Damit soll ja
le bereits im 18. Jahrhundert bekannte — Relativität gewisser Faktoren im ästhe-