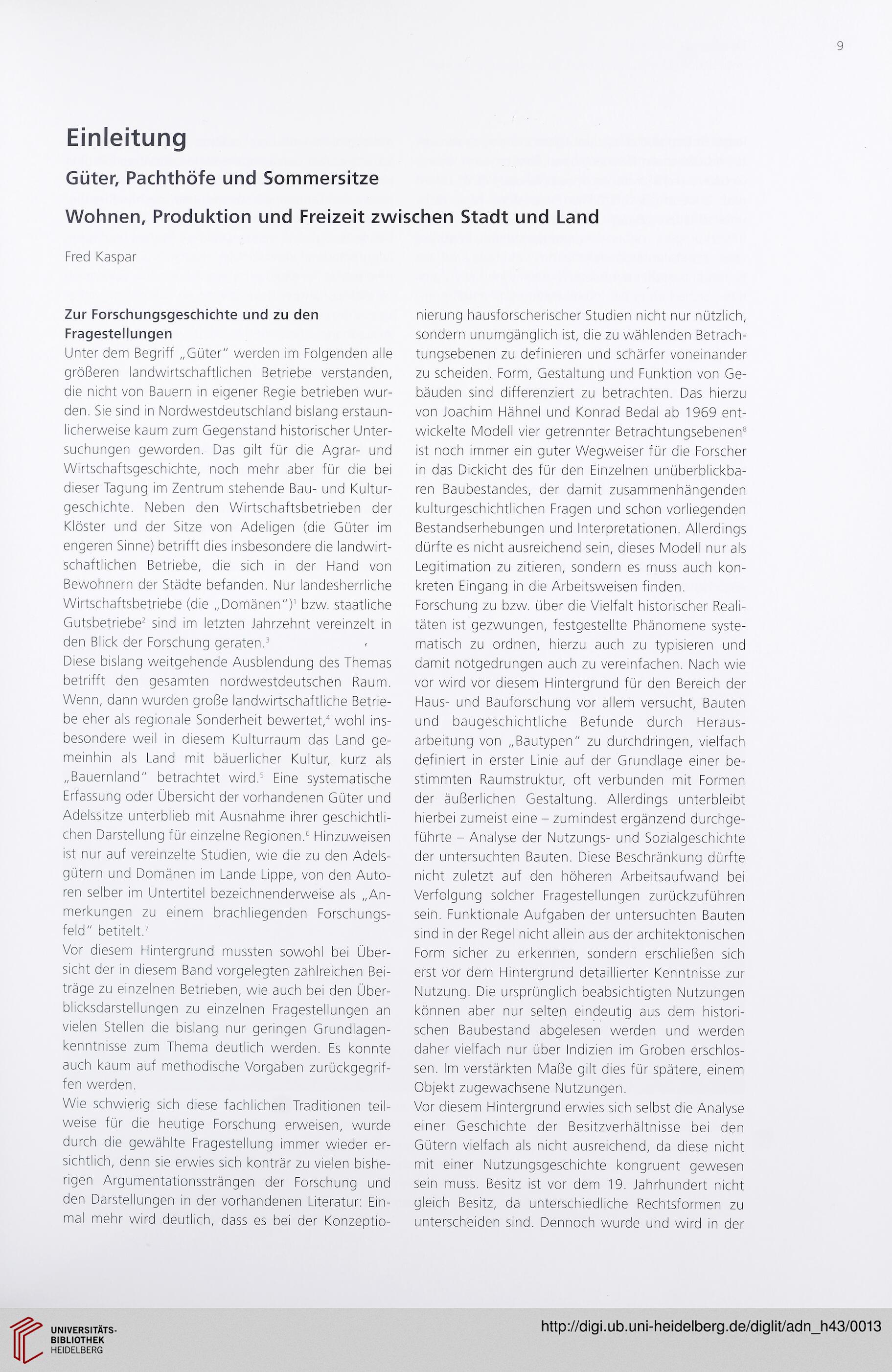9
Einleitung
Güter, Pachthöfe und Sommersitze
Wohnen, Produktion und Freizeit zwischen Stadt und Land
Fred Kaspar
Zur Forschungsgeschichte und zu den
Fragestellungen
Unter dem Begriff „Güter" werden im Folgenden alle
größeren landwirtschaftlichen Betriebe verstanden,
die nicht von Bauern in eigener Regie betrieben wur-
den. Sie sind in Nordwestdeutschland bislang erstaun-
licherweise kaum zum Gegenstand historischer Unter-
suchungen geworden. Das gilt für die Agrar- und
Wirtschaftsgeschichte, noch mehr aber für die bei
dieser Tagung im Zentrum stehende Bau- und Kultur-
geschichte. Neben den Wirtschaftsbetrieben der
Klöster und der Sitze von Adeligen (die Güter im
engeren Sinne) betrifft dies insbesondere die landwirt-
schaftlichen Betriebe, die sich in der Hand von
Bewohnern der Städte befanden. Nur landesherrliche
Wirtschaftsbetriebe (die „Domänen")1 bzw. staatliche
Gutsbetriebe2 sind im letzten Jahrzehnt vereinzelt in
den Blick der Forschung geraten.3
Diese bislang weitgehende Ausblendung des Themas
betrifft den gesamten nordwestdeutschen Raum.
Wenn, dann wurden große landwirtschaftliche Betrie-
be eher als regionale Sonderheit bewertet,4 wohl ins-
besondere weil in diesem Kulturraum das Land ge-
meinhin als Land mit bäuerlicher Kultur, kurz als
„Bauernland" betrachtet wird.5 Eine systematische
Erfassung oder Übersicht der vorhandenen Güter und
Adelssitze unterblieb mit Ausnahme ihrer geschichtli-
chen Darstellung für einzelne Regionen.6 Hinzuweisen
ist nur auf vereinzelte Studien, wie die zu den Adels-
gütern und Domänen im Lande Lippe, von den Auto-
ren selber im Untertitel bezeichnenderweise als „An-
merkungen zu einem brachliegenden Forschungs-
feld" betitelt.7
Vor diesem Hintergrund mussten sowohl bei Über-
sicht der in diesem Band vorgelegten zahlreichen Bei-
träge zu einzelnen Betrieben, wie auch bei den Über-
blicksdarstellungen zu einzelnen Fragestellungen an
vielen Stellen die bislang nur geringen Grundlagen-
kenntnisse zum Thema deutlich werden. Es konnte
auch kaum auf methodische Vorgaben zurückgegrif-
fen werden.
Wie schwierig sich diese fachlichen Traditionen teil-
weise für die heutige Forschung erweisen, wurde
durch die gewählte Fragestellung immer wieder er-
sichtlich, denn sie erwies sich konträr zu vielen bishe-
rigen Argumentationssträngen der Forschung und
den Darstellungen in der vorhandenen Literatur: Ein-
mal mehr wird deutlich, dass es bei der Konzeptio-
nierung hausforscherischer Studien nicht nur nützlich,
sondern unumgänglich ist, die zu wählenden Betrach-
tungsebenen zu definieren und schärfer voneinander
zu scheiden. Form, Gestaltung und Funktion von Ge-
bäuden sind differenziert zu betrachten. Das hierzu
von Joachim Hähnel und Konrad Bedal ab 1969 ent-
wickelte Modell vier getrennter Betrachtungsebenen8
ist noch immer ein guter Wegweiser für die Forscher
in das Dickicht des für den Einzelnen unüberblickba-
ren Baubestandes, der damit zusammenhängenden
kulturgeschichtlichen Fragen und schon vorliegenden
Bestandserhebungen und Interpretationen. Allerdings
dürfte es nicht ausreichend sein, dieses Modell nur als
Legitimation zu zitieren, sondern es muss auch kon-
kreten Eingang in die Arbeitsweisen finden.
Forschung zu bzw. über die Vielfalt historischer Reali-
täten ist gezwungen, festgestellte Phänomene syste-
matisch zu ordnen, hierzu auch zu typisieren und
damit notgedrungen auch zu vereinfachen. Nach wie
vor wird vor diesem Hintergrund für den Bereich der
Haus- und Bauforschung vor allem versucht, Bauten
und baugeschichtliche Befunde durch Heraus-
arbeitung von „Bautypen" zu durchdringen, vielfach
definiert in erster Linie auf der Grundlage einer be-
stimmten Raumstruktur, oft verbunden mit Formen
der äußerlichen Gestaltung. Allerdings unterbleibt
hierbei zumeist eine - zumindest ergänzend durchge-
führte - Analyse der Nutzungs- und Sozialgeschichte
der untersuchten Bauten. Diese Beschränkung dürfte
nicht zuletzt auf den höheren Arbeitsaufwand bei
Verfolgung solcher Fragestellungen zurückzuführen
sein. Funktionale Aufgaben der untersuchten Bauten
sind in der Regel nicht allein aus der architektonischen
Form sicher zu erkennen, sondern erschließen sich
erst vor dem Hintergrund detaillierter Kenntnisse zur
Nutzung. Die ursprünglich beabsichtigten Nutzungen
können aber nur selten eindeutig aus dem histori-
schen Baubestand abgelesen werden und werden
daher vielfach nur über Indizien im Groben erschlos-
sen. Im verstärkten Maße gilt dies für spätere, einem
Objekt zugewachsene Nutzungen.
Vor diesem Hintergrund erwies sich selbst die Analyse
einer Geschichte der Besitzverhältnisse bei den
Gütern vielfach als nicht ausreichend, da diese nicht
mit einer Nutzungsgeschichte kongruent gewesen
sein muss. Besitz ist vor dem 19. Jahrhundert nicht
gleich Besitz, da unterschiedliche Rechtsformen zu
unterscheiden sind. Dennoch wurde und wird in der
Einleitung
Güter, Pachthöfe und Sommersitze
Wohnen, Produktion und Freizeit zwischen Stadt und Land
Fred Kaspar
Zur Forschungsgeschichte und zu den
Fragestellungen
Unter dem Begriff „Güter" werden im Folgenden alle
größeren landwirtschaftlichen Betriebe verstanden,
die nicht von Bauern in eigener Regie betrieben wur-
den. Sie sind in Nordwestdeutschland bislang erstaun-
licherweise kaum zum Gegenstand historischer Unter-
suchungen geworden. Das gilt für die Agrar- und
Wirtschaftsgeschichte, noch mehr aber für die bei
dieser Tagung im Zentrum stehende Bau- und Kultur-
geschichte. Neben den Wirtschaftsbetrieben der
Klöster und der Sitze von Adeligen (die Güter im
engeren Sinne) betrifft dies insbesondere die landwirt-
schaftlichen Betriebe, die sich in der Hand von
Bewohnern der Städte befanden. Nur landesherrliche
Wirtschaftsbetriebe (die „Domänen")1 bzw. staatliche
Gutsbetriebe2 sind im letzten Jahrzehnt vereinzelt in
den Blick der Forschung geraten.3
Diese bislang weitgehende Ausblendung des Themas
betrifft den gesamten nordwestdeutschen Raum.
Wenn, dann wurden große landwirtschaftliche Betrie-
be eher als regionale Sonderheit bewertet,4 wohl ins-
besondere weil in diesem Kulturraum das Land ge-
meinhin als Land mit bäuerlicher Kultur, kurz als
„Bauernland" betrachtet wird.5 Eine systematische
Erfassung oder Übersicht der vorhandenen Güter und
Adelssitze unterblieb mit Ausnahme ihrer geschichtli-
chen Darstellung für einzelne Regionen.6 Hinzuweisen
ist nur auf vereinzelte Studien, wie die zu den Adels-
gütern und Domänen im Lande Lippe, von den Auto-
ren selber im Untertitel bezeichnenderweise als „An-
merkungen zu einem brachliegenden Forschungs-
feld" betitelt.7
Vor diesem Hintergrund mussten sowohl bei Über-
sicht der in diesem Band vorgelegten zahlreichen Bei-
träge zu einzelnen Betrieben, wie auch bei den Über-
blicksdarstellungen zu einzelnen Fragestellungen an
vielen Stellen die bislang nur geringen Grundlagen-
kenntnisse zum Thema deutlich werden. Es konnte
auch kaum auf methodische Vorgaben zurückgegrif-
fen werden.
Wie schwierig sich diese fachlichen Traditionen teil-
weise für die heutige Forschung erweisen, wurde
durch die gewählte Fragestellung immer wieder er-
sichtlich, denn sie erwies sich konträr zu vielen bishe-
rigen Argumentationssträngen der Forschung und
den Darstellungen in der vorhandenen Literatur: Ein-
mal mehr wird deutlich, dass es bei der Konzeptio-
nierung hausforscherischer Studien nicht nur nützlich,
sondern unumgänglich ist, die zu wählenden Betrach-
tungsebenen zu definieren und schärfer voneinander
zu scheiden. Form, Gestaltung und Funktion von Ge-
bäuden sind differenziert zu betrachten. Das hierzu
von Joachim Hähnel und Konrad Bedal ab 1969 ent-
wickelte Modell vier getrennter Betrachtungsebenen8
ist noch immer ein guter Wegweiser für die Forscher
in das Dickicht des für den Einzelnen unüberblickba-
ren Baubestandes, der damit zusammenhängenden
kulturgeschichtlichen Fragen und schon vorliegenden
Bestandserhebungen und Interpretationen. Allerdings
dürfte es nicht ausreichend sein, dieses Modell nur als
Legitimation zu zitieren, sondern es muss auch kon-
kreten Eingang in die Arbeitsweisen finden.
Forschung zu bzw. über die Vielfalt historischer Reali-
täten ist gezwungen, festgestellte Phänomene syste-
matisch zu ordnen, hierzu auch zu typisieren und
damit notgedrungen auch zu vereinfachen. Nach wie
vor wird vor diesem Hintergrund für den Bereich der
Haus- und Bauforschung vor allem versucht, Bauten
und baugeschichtliche Befunde durch Heraus-
arbeitung von „Bautypen" zu durchdringen, vielfach
definiert in erster Linie auf der Grundlage einer be-
stimmten Raumstruktur, oft verbunden mit Formen
der äußerlichen Gestaltung. Allerdings unterbleibt
hierbei zumeist eine - zumindest ergänzend durchge-
führte - Analyse der Nutzungs- und Sozialgeschichte
der untersuchten Bauten. Diese Beschränkung dürfte
nicht zuletzt auf den höheren Arbeitsaufwand bei
Verfolgung solcher Fragestellungen zurückzuführen
sein. Funktionale Aufgaben der untersuchten Bauten
sind in der Regel nicht allein aus der architektonischen
Form sicher zu erkennen, sondern erschließen sich
erst vor dem Hintergrund detaillierter Kenntnisse zur
Nutzung. Die ursprünglich beabsichtigten Nutzungen
können aber nur selten eindeutig aus dem histori-
schen Baubestand abgelesen werden und werden
daher vielfach nur über Indizien im Groben erschlos-
sen. Im verstärkten Maße gilt dies für spätere, einem
Objekt zugewachsene Nutzungen.
Vor diesem Hintergrund erwies sich selbst die Analyse
einer Geschichte der Besitzverhältnisse bei den
Gütern vielfach als nicht ausreichend, da diese nicht
mit einer Nutzungsgeschichte kongruent gewesen
sein muss. Besitz ist vor dem 19. Jahrhundert nicht
gleich Besitz, da unterschiedliche Rechtsformen zu
unterscheiden sind. Dennoch wurde und wird in der