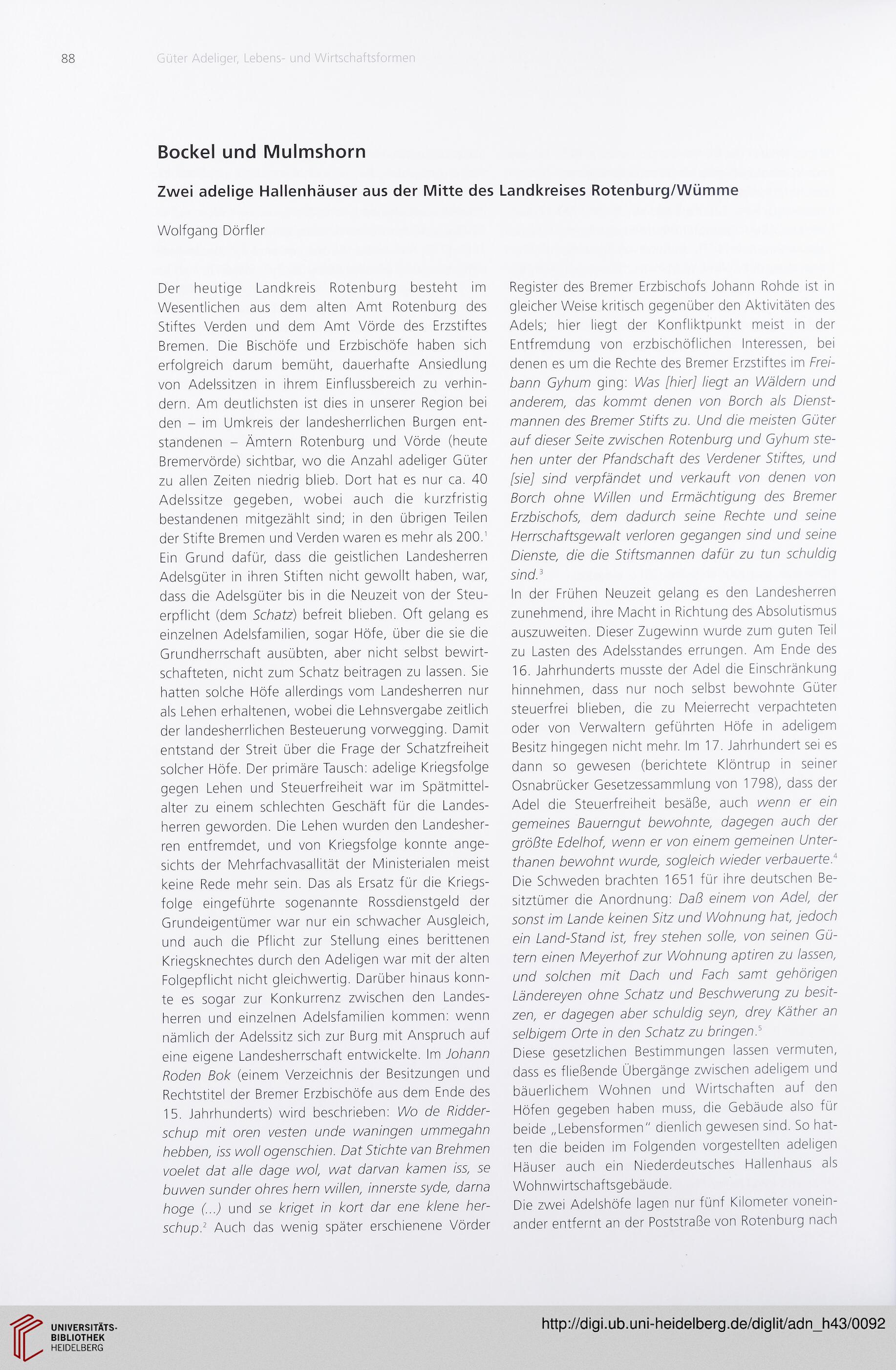88
Güter Adeliger, Lebens- und Wirtschaftsformen
Bockei und Mulmshorn
Zwei adelige Hallenhäuser aus der Mitte des Landkreises Rotenburg/Wümme
Wolfgang Dörfler
Der heutige Landkreis Rotenburg besteht im
Wesentlichen aus dem alten Amt Rotenburg des
Stiftes Verden und dem Amt Vörde des Erzstiftes
Bremen. Die Bischöfe und Erzbischöfe haben sich
erfolgreich darum bemüht, dauerhafte Ansiedlung
von Adelssitzen in ihrem Einflussbereich zu verhin-
dern. Am deutlichsten ist dies in unserer Region bei
den - im Umkreis der landesherrlichen Burgen ent-
standenen - Ämtern Rotenburg und Vörde (heute
Bremervörde) sichtbar, wo die Anzahl adeliger Güter
zu allen Zeiten niedrig blieb. Dort hat es nur ca. 40
Adelssitze gegeben, wobei auch die kurzfristig
bestandenen mitgezählt sind; in den übrigen Teilen
der Stifte Bremen und Verden waren es mehr als 200.'
Ein Grund dafür, dass die geistlichen Landesherren
Adelsgüter in ihren Stiften nicht gewollt haben, war,
dass die Adelsgüter bis in die Neuzeit von der Steu-
erpflicht (dem Schatz') befreit blieben. Oft gelang es
einzelnen Adelsfamilien, sogar Höfe, über die sie die
Grundherrschaft ausübten, aber nicht selbst bewirt-
schafteten, nicht zum Schatz beitragen zu lassen. Sie
hatten solche Höfe allerdings vom Landesherren nur
als Lehen erhaltenen, wobei die Lehnsvergabe zeitlich
der landesherrlichen Besteuerung vorwegging. Damit
entstand der Streit über die Frage der Schatzfreiheit
solcher Höfe. Der primäre Tausch: adelige Kriegsfolge
gegen Lehen und Steuerfreiheit war im Spätmittel-
alter zu einem schlechten Geschäft für die Landes-
herren geworden. Die Lehen wurden den Landesher-
ren entfremdet, und von Kriegsfolge konnte ange-
sichts der Mehrfachvasaliität der Ministerialen meist
keine Rede mehr sein. Das als Ersatz für die Kriegs-
folge eingeführte sogenannte Rossdienstgeld der
Grundeigentümer war nur ein schwacher Ausgleich,
und auch die Pflicht zur Stellung eines berittenen
Kriegsknechtes durch den Adeligen war mit der alten
Folgepflicht nicht gleichwertig. Darüber hinaus konn-
te es sogar zur Konkurrenz zwischen den Landes-
herren und einzelnen Adelsfamilien kommen: wenn
nämlich der Adelssitz sich zur Burg mit Anspruch auf
eine eigene Landesherrschaft entwickelte. Im Johann
Roden Bok (einem Verzeichnis der Besitzungen und
Rechtstitel der Bremer Erzbischöfe aus dem Ende des
15. Jahrhunderts) wird beschrieben: Wo de Ridder-
schup mit oren vesten unde waningen ummegahn
hebben, iss woll ogenschien. Dat Süchte van Brehmen
voelet dat alle dage wol, wat darvan kamen iss, se
buwen sunder ohres hem willen, innerste syde, darna
hoge (...) und se kriget in kort dar ene klene her-
schup.2 Auch das wenig später erschienene Vorder
Register des Bremer Erzbischofs Johann Rohde ist in
gleicher Weise kritisch gegenüber den Aktivitäten des
Adels; hier liegt der Konfliktpunkt meist in der
Entfremdung von erzbischöflichen Interessen, bei
denen es um die Rechte des Bremer Erzstiftes im Frei-
bann Gyhum ging: Was [hier] liegt an Wäldern und
anderem, das kommt denen von Borch als Dienst-
mannen des Bremer Stifts zu. Und die meisten Güter
auf dieser Seite zwischen Rotenburg und Gyhum ste-
hen unter der Pfandschaft des Verdener Stiftes, und
[sie] sind verpfändet und verkauft von denen von
Borch ohne Willen und Ermächtigung des Bremer
Erzbischofs, dem dadurch seine Rechte und seine
Herrschaftsgewalt verloren gegangen sind und seine
Dienste, die die Stiftsmannen dafür zu tun schuldig
sind.3
In der Frühen Neuzeit gelang es den Landesherren
zunehmend, ihre Macht in Richtung des Absolutismus
auszuweiten. Dieser Zugewinn wurde zum guten Teil
zu Lasten des Adelsstandes errungen. Am Ende des
16. Jahrhunderts musste der Adel die Einschränkung
hinnehmen, dass nur noch selbst bewohnte Güter
steuerfrei blieben, die zu Meierrecht verpachteten
oder von Verwaltern geführten Höfe in adeligem
Besitz hingegen nicht mehr. Im 17. Jahrhundertsei es
dann so gewesen (berichtete Klöntrup in seiner
Osnabrücker Gesetzessammlung von 1798), dass der
Adel die Steuerfreiheit besäße, auch wenn er ein
gemeines Bauerngut bewohnte, dagegen auch der
größte Edelhof, wenn er von einem gemeinen Unter-
thanen bewohnt wurde, sogleich wieder verbauerte.4
Die Schweden brachten 1651 für ihre deutschen Be-
sitztümer die Anordnung: Daß einem von Adel, der
sonst im Lande keinen Sitz und Wohnung hat, jedoch
ein Land-Stand ist, frey stehen solle, von seinen Gü-
tern einen Meyerhof zur Wohnung aptiren zu lassen,
und solchen mit Dach und Fach samt gehörigen
Ländereyen ohne Schatz und Beschwerung zu besit-
zen, er dagegen aber schuldig seyn, drey Käther an
selbigem Orte in den Schatz zu bringen.5
Diese gesetzlichen Bestimmungen lassen vermuten,
dass es fließende Übergänge zwischen adeligem und
bäuerlichem Wohnen und Wirtschaften auf den
Höfen gegeben haben muss, die Gebäude also für
beide „Lebensformen" dienlich gewesen sind. So hat-
ten die beiden im Folgenden vorgestellten adeligen
Häuser auch ein Niederdeutsches Hallenhaus als
Wohnwirtschaftsgebäude.
Die zwei Adelshöfe lagen nur fünf Kilometer vonein-
ander entfernt an der Poststraße von Rotenburg nach
Güter Adeliger, Lebens- und Wirtschaftsformen
Bockei und Mulmshorn
Zwei adelige Hallenhäuser aus der Mitte des Landkreises Rotenburg/Wümme
Wolfgang Dörfler
Der heutige Landkreis Rotenburg besteht im
Wesentlichen aus dem alten Amt Rotenburg des
Stiftes Verden und dem Amt Vörde des Erzstiftes
Bremen. Die Bischöfe und Erzbischöfe haben sich
erfolgreich darum bemüht, dauerhafte Ansiedlung
von Adelssitzen in ihrem Einflussbereich zu verhin-
dern. Am deutlichsten ist dies in unserer Region bei
den - im Umkreis der landesherrlichen Burgen ent-
standenen - Ämtern Rotenburg und Vörde (heute
Bremervörde) sichtbar, wo die Anzahl adeliger Güter
zu allen Zeiten niedrig blieb. Dort hat es nur ca. 40
Adelssitze gegeben, wobei auch die kurzfristig
bestandenen mitgezählt sind; in den übrigen Teilen
der Stifte Bremen und Verden waren es mehr als 200.'
Ein Grund dafür, dass die geistlichen Landesherren
Adelsgüter in ihren Stiften nicht gewollt haben, war,
dass die Adelsgüter bis in die Neuzeit von der Steu-
erpflicht (dem Schatz') befreit blieben. Oft gelang es
einzelnen Adelsfamilien, sogar Höfe, über die sie die
Grundherrschaft ausübten, aber nicht selbst bewirt-
schafteten, nicht zum Schatz beitragen zu lassen. Sie
hatten solche Höfe allerdings vom Landesherren nur
als Lehen erhaltenen, wobei die Lehnsvergabe zeitlich
der landesherrlichen Besteuerung vorwegging. Damit
entstand der Streit über die Frage der Schatzfreiheit
solcher Höfe. Der primäre Tausch: adelige Kriegsfolge
gegen Lehen und Steuerfreiheit war im Spätmittel-
alter zu einem schlechten Geschäft für die Landes-
herren geworden. Die Lehen wurden den Landesher-
ren entfremdet, und von Kriegsfolge konnte ange-
sichts der Mehrfachvasaliität der Ministerialen meist
keine Rede mehr sein. Das als Ersatz für die Kriegs-
folge eingeführte sogenannte Rossdienstgeld der
Grundeigentümer war nur ein schwacher Ausgleich,
und auch die Pflicht zur Stellung eines berittenen
Kriegsknechtes durch den Adeligen war mit der alten
Folgepflicht nicht gleichwertig. Darüber hinaus konn-
te es sogar zur Konkurrenz zwischen den Landes-
herren und einzelnen Adelsfamilien kommen: wenn
nämlich der Adelssitz sich zur Burg mit Anspruch auf
eine eigene Landesherrschaft entwickelte. Im Johann
Roden Bok (einem Verzeichnis der Besitzungen und
Rechtstitel der Bremer Erzbischöfe aus dem Ende des
15. Jahrhunderts) wird beschrieben: Wo de Ridder-
schup mit oren vesten unde waningen ummegahn
hebben, iss woll ogenschien. Dat Süchte van Brehmen
voelet dat alle dage wol, wat darvan kamen iss, se
buwen sunder ohres hem willen, innerste syde, darna
hoge (...) und se kriget in kort dar ene klene her-
schup.2 Auch das wenig später erschienene Vorder
Register des Bremer Erzbischofs Johann Rohde ist in
gleicher Weise kritisch gegenüber den Aktivitäten des
Adels; hier liegt der Konfliktpunkt meist in der
Entfremdung von erzbischöflichen Interessen, bei
denen es um die Rechte des Bremer Erzstiftes im Frei-
bann Gyhum ging: Was [hier] liegt an Wäldern und
anderem, das kommt denen von Borch als Dienst-
mannen des Bremer Stifts zu. Und die meisten Güter
auf dieser Seite zwischen Rotenburg und Gyhum ste-
hen unter der Pfandschaft des Verdener Stiftes, und
[sie] sind verpfändet und verkauft von denen von
Borch ohne Willen und Ermächtigung des Bremer
Erzbischofs, dem dadurch seine Rechte und seine
Herrschaftsgewalt verloren gegangen sind und seine
Dienste, die die Stiftsmannen dafür zu tun schuldig
sind.3
In der Frühen Neuzeit gelang es den Landesherren
zunehmend, ihre Macht in Richtung des Absolutismus
auszuweiten. Dieser Zugewinn wurde zum guten Teil
zu Lasten des Adelsstandes errungen. Am Ende des
16. Jahrhunderts musste der Adel die Einschränkung
hinnehmen, dass nur noch selbst bewohnte Güter
steuerfrei blieben, die zu Meierrecht verpachteten
oder von Verwaltern geführten Höfe in adeligem
Besitz hingegen nicht mehr. Im 17. Jahrhundertsei es
dann so gewesen (berichtete Klöntrup in seiner
Osnabrücker Gesetzessammlung von 1798), dass der
Adel die Steuerfreiheit besäße, auch wenn er ein
gemeines Bauerngut bewohnte, dagegen auch der
größte Edelhof, wenn er von einem gemeinen Unter-
thanen bewohnt wurde, sogleich wieder verbauerte.4
Die Schweden brachten 1651 für ihre deutschen Be-
sitztümer die Anordnung: Daß einem von Adel, der
sonst im Lande keinen Sitz und Wohnung hat, jedoch
ein Land-Stand ist, frey stehen solle, von seinen Gü-
tern einen Meyerhof zur Wohnung aptiren zu lassen,
und solchen mit Dach und Fach samt gehörigen
Ländereyen ohne Schatz und Beschwerung zu besit-
zen, er dagegen aber schuldig seyn, drey Käther an
selbigem Orte in den Schatz zu bringen.5
Diese gesetzlichen Bestimmungen lassen vermuten,
dass es fließende Übergänge zwischen adeligem und
bäuerlichem Wohnen und Wirtschaften auf den
Höfen gegeben haben muss, die Gebäude also für
beide „Lebensformen" dienlich gewesen sind. So hat-
ten die beiden im Folgenden vorgestellten adeligen
Häuser auch ein Niederdeutsches Hallenhaus als
Wohnwirtschaftsgebäude.
Die zwei Adelshöfe lagen nur fünf Kilometer vonein-
ander entfernt an der Poststraße von Rotenburg nach