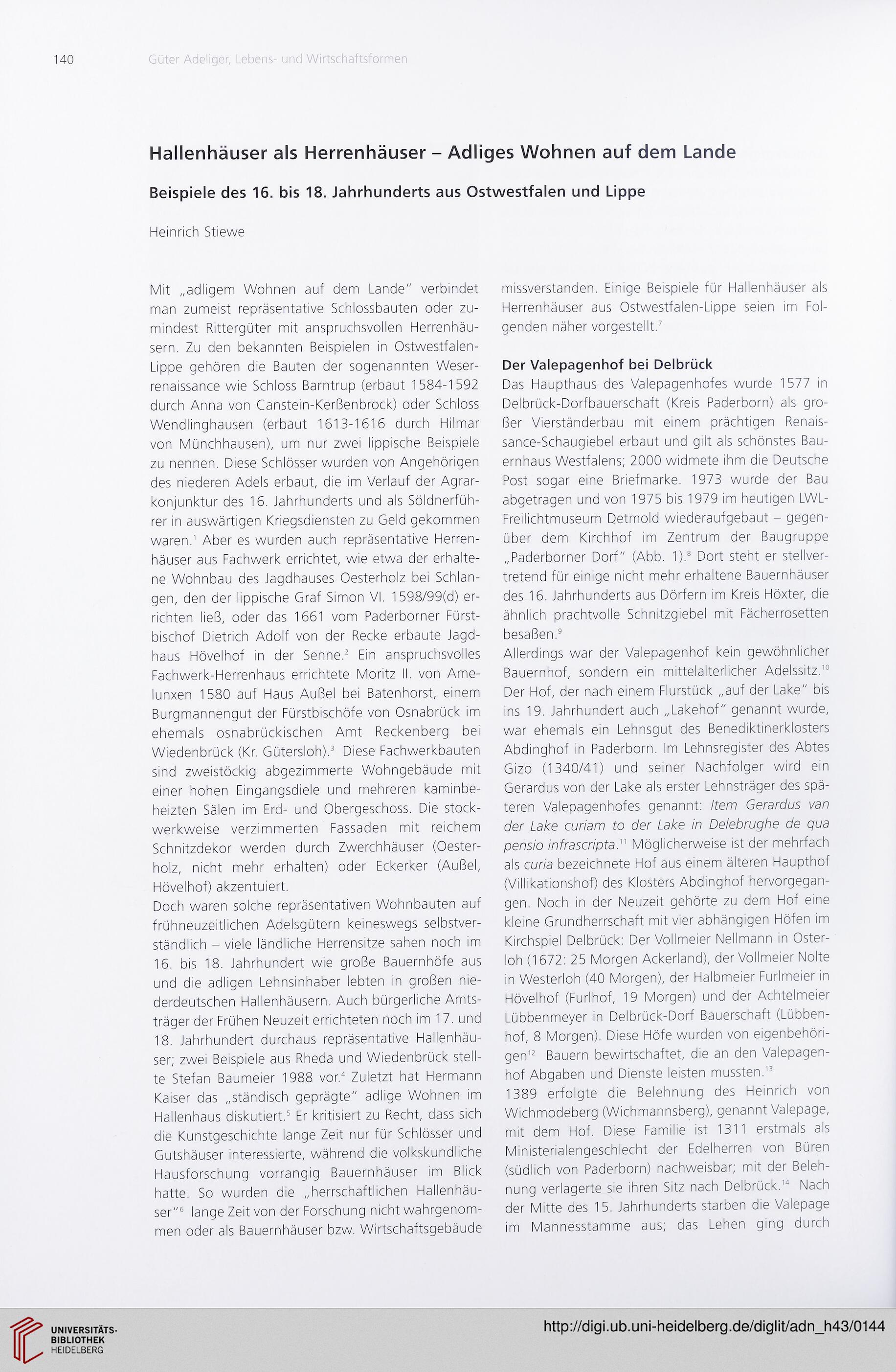140
Güter Adeliger, Lebens- und Wirtschaftsformen
Hallenhäuser als Herrenhäuser - Adliges Wohnen auf dem Lande
Beispiele des 16. bis 18. Jahrhunderts aus Ostwestfalen und Lippe
Heinrich Stiewe
Mit „adligem Wohnen auf dem Lande" verbindet
man zumeist repräsentative Schlossbauten oder zu-
mindest Rittergüter mit anspruchsvollen Herrenhäu-
sern. Zu den bekannten Beispielen in Ostwestfalen-
Lippe gehören die Bauten der sogenannten Weser-
renaissance wie Schloss Barntrup (erbaut 1584-1592
durch Anna von Canstein-Kerßenbrock) oder Schloss
Wendlinghausen (erbaut 1613-1616 durch Hilmar
von Münchhausen), um nur zwei lippische Beispiele
zu nennen. Diese Schlösser wurden von Angehörigen
des niederen Adels erbaut, die im Verlauf der Agrar-
konjunktur des 16. Jahrhunderts und als Söldnerfüh-
rer in auswärtigen Kriegsdiensten zu Geld gekommen
waren.1 Aber es wurden auch repräsentative Herren-
häuser aus Fachwerk errichtet, wie etwa der erhalte-
ne Wohnbau des Jagdhauses Oesterholz bei Schlan-
gen, den der lippische Graf Simon VI. 1598/99(d) er-
richten ließ, oder das 1661 vom Paderborner Fürst-
bischof Dietrich Adolf von der Recke erbaute Jagd-
haus Hövelhof in der Senne.2 Ein anspruchsvolles
Fachwerk-Herrenhaus errichtete Moritz II. von Ame-
lunxen 1580 auf Haus Außel bei Batenhorst, einem
Burgmannengut der Fürstbischöfe von Osnabrück im
ehemals osnabrückischen Amt Reckenberg bei
Wiedenbrück (Kr. Gütersloh).3 Diese Fachwerkbauten
sind zweistöckig abgezimmerte Wohngebäude mit
einer hohen Eingangsdiele und mehreren kaminbe-
heizten Sälen im Erd- und Obergeschoss. Die stock-
werkweise verzimmerten Fassaden mit reichem
Schnitzdekor werden durch Zwerchhäuser (Oester-
holz, nicht mehr erhalten) oder Eckerker (Außel,
Hövelhof) akzentuiert.
Doch waren solche repräsentativen Wohnbauten auf
frühneuzeitlichen Adelsgütern keineswegs selbstver-
ständlich - viele ländliche Herrensitze sahen noch im
16. bis 18. Jahrhundert wie große Bauernhöfe aus
und die adligen Lehnsinhaber lebten in großen nie-
derdeutschen Hallenhäusern. Auch bürgerliche Amts-
träger der Frühen Neuzeit errichteten noch im 17. und
18. Jahrhundert durchaus repräsentative Hallenhäu-
ser; zwei Beispiele aus Rheda und Wiedenbrück stell-
te Stefan Baumeier 1988 vor.4 Zuletzt hat Hermann
Kaiser das „ständisch geprägte" adlige Wohnen im
Hallenhaus diskutiert.5 Er kritisiert zu Recht, dass sich
die Kunstgeschichte lange Zeit nur für Schlösser und
Gutshäuser interessierte, während die volkskundliche
Hausforschung vorrangig Bauernhäuser im Blick
hatte. So wurden die „herrschaftlichen Hallenhäu-
ser"6 lange Zeit von der Forschung nicht wahrgenom-
men oder als Bauernhäuser bzw. Wirtschaftsgebäude
missverstanden. Einige Beispiele für Hallenhäuser als
Herrenhäuser aus Ostwestfalen-Lippe seien im Fol-
genden näher vorgestellt.7
Der Valepagenhof bei Delbrück
Das Haupthaus des Valepagenhofes wurde 1577 in
Delbrück-Dorfbauerschaft (Kreis Paderborn) als gro-
ßer Vierständerbau mit einem prächtigen Renais-
sance-Schaugiebel erbaut und gilt als schönstes Bau-
ernhaus Westfalens; 2000 widmete ihm die Deutsche
Post sogar eine Briefmarke. 1973 wurde der Bau
abgetragen und von 1975 bis 1979 im heutigen LWL-
Freilichtmuseum Detmold wiederaufgebaut - gegen-
über dem Kirchhof im Zentrum der Baugruppe
„Paderborner Dorf" (Abb. 1).8 Dort steht er stellver-
tretend für einige nicht mehr erhaltene Bauernhäuser
des 16. Jahrhunderts aus Dörfern im Kreis Höxter, die
ähnlich prachtvolle Schnitzgiebel mit Fächerrosetten
besaßen.9
Allerdings war der Valepagenhof kein gewöhnlicher
Bauernhof, sondern ein mittelalterlicher Adelssitz.10
Der Hof, der nach einem Flurstück „auf der Lake" bis
ins 19. Jahrhundert auch „Lakehof" genannt wurde,
war ehemals ein Lehnsgut des Benediktinerklosters
Abdinghof in Paderborn. Im Lehnsregister des Abtes
Gizo (1340/41) und seiner Nachfolger wird ein
Gerardus von der Lake als erster Lehnsträger des spä-
teren Valepagenhofes genannt: Item Gerardus van
der Lake curiam to der Lake in Delebrughe de qua
pensio infrascripta." Möglicherweise ist der mehrfach
als curia bezeichnete Hof aus einem älteren Haupthof
(Villikationshof) des Klosters Abdinghof hervorgegan-
gen. Noch in der Neuzeit gehörte zu dem Hof eine
kleine Grundherrschaft mit vier abhängigen Höfen im
Kirchspiel Delbrück: Der Vollmeier Nellmann in Oster-
loh (1672: 25 Morgen Ackerland), der Vollmeier Nolte
in Westerloh (40 Morgen), der Halbmeier Furlmeier in
Hövelhof (Furlhof, 19 Morgen) und der Achtelmeier
Lübbenmeyer in Delbrück-Dorf Bauerschaft (Lübben-
hof, 8 Morgen). Diese Höfe wurden von eigenbehöri-
gen12 Bauern bewirtschaftet, die an den Valepagen-
hof Abgaben und Dienste leisten mussten.13
1389 erfolgte die Belehnung des Heinrich von
Wichmodeberg (Wichmannsberg), genannt Valepage,
mit dem Hof. Diese Familie ist 1311 erstmals als
Ministerialengeschlecht der Edelherren von Büren
(südlich von Paderborn) nachweisbar; mit der Beleh-
nung verlagerte sie ihren Sitz nach Delbrück.14 Nach
der Mitte des 15. Jahrhunderts starben die Valepage
im Mannesstamme aus; das Lehen ging durch
Güter Adeliger, Lebens- und Wirtschaftsformen
Hallenhäuser als Herrenhäuser - Adliges Wohnen auf dem Lande
Beispiele des 16. bis 18. Jahrhunderts aus Ostwestfalen und Lippe
Heinrich Stiewe
Mit „adligem Wohnen auf dem Lande" verbindet
man zumeist repräsentative Schlossbauten oder zu-
mindest Rittergüter mit anspruchsvollen Herrenhäu-
sern. Zu den bekannten Beispielen in Ostwestfalen-
Lippe gehören die Bauten der sogenannten Weser-
renaissance wie Schloss Barntrup (erbaut 1584-1592
durch Anna von Canstein-Kerßenbrock) oder Schloss
Wendlinghausen (erbaut 1613-1616 durch Hilmar
von Münchhausen), um nur zwei lippische Beispiele
zu nennen. Diese Schlösser wurden von Angehörigen
des niederen Adels erbaut, die im Verlauf der Agrar-
konjunktur des 16. Jahrhunderts und als Söldnerfüh-
rer in auswärtigen Kriegsdiensten zu Geld gekommen
waren.1 Aber es wurden auch repräsentative Herren-
häuser aus Fachwerk errichtet, wie etwa der erhalte-
ne Wohnbau des Jagdhauses Oesterholz bei Schlan-
gen, den der lippische Graf Simon VI. 1598/99(d) er-
richten ließ, oder das 1661 vom Paderborner Fürst-
bischof Dietrich Adolf von der Recke erbaute Jagd-
haus Hövelhof in der Senne.2 Ein anspruchsvolles
Fachwerk-Herrenhaus errichtete Moritz II. von Ame-
lunxen 1580 auf Haus Außel bei Batenhorst, einem
Burgmannengut der Fürstbischöfe von Osnabrück im
ehemals osnabrückischen Amt Reckenberg bei
Wiedenbrück (Kr. Gütersloh).3 Diese Fachwerkbauten
sind zweistöckig abgezimmerte Wohngebäude mit
einer hohen Eingangsdiele und mehreren kaminbe-
heizten Sälen im Erd- und Obergeschoss. Die stock-
werkweise verzimmerten Fassaden mit reichem
Schnitzdekor werden durch Zwerchhäuser (Oester-
holz, nicht mehr erhalten) oder Eckerker (Außel,
Hövelhof) akzentuiert.
Doch waren solche repräsentativen Wohnbauten auf
frühneuzeitlichen Adelsgütern keineswegs selbstver-
ständlich - viele ländliche Herrensitze sahen noch im
16. bis 18. Jahrhundert wie große Bauernhöfe aus
und die adligen Lehnsinhaber lebten in großen nie-
derdeutschen Hallenhäusern. Auch bürgerliche Amts-
träger der Frühen Neuzeit errichteten noch im 17. und
18. Jahrhundert durchaus repräsentative Hallenhäu-
ser; zwei Beispiele aus Rheda und Wiedenbrück stell-
te Stefan Baumeier 1988 vor.4 Zuletzt hat Hermann
Kaiser das „ständisch geprägte" adlige Wohnen im
Hallenhaus diskutiert.5 Er kritisiert zu Recht, dass sich
die Kunstgeschichte lange Zeit nur für Schlösser und
Gutshäuser interessierte, während die volkskundliche
Hausforschung vorrangig Bauernhäuser im Blick
hatte. So wurden die „herrschaftlichen Hallenhäu-
ser"6 lange Zeit von der Forschung nicht wahrgenom-
men oder als Bauernhäuser bzw. Wirtschaftsgebäude
missverstanden. Einige Beispiele für Hallenhäuser als
Herrenhäuser aus Ostwestfalen-Lippe seien im Fol-
genden näher vorgestellt.7
Der Valepagenhof bei Delbrück
Das Haupthaus des Valepagenhofes wurde 1577 in
Delbrück-Dorfbauerschaft (Kreis Paderborn) als gro-
ßer Vierständerbau mit einem prächtigen Renais-
sance-Schaugiebel erbaut und gilt als schönstes Bau-
ernhaus Westfalens; 2000 widmete ihm die Deutsche
Post sogar eine Briefmarke. 1973 wurde der Bau
abgetragen und von 1975 bis 1979 im heutigen LWL-
Freilichtmuseum Detmold wiederaufgebaut - gegen-
über dem Kirchhof im Zentrum der Baugruppe
„Paderborner Dorf" (Abb. 1).8 Dort steht er stellver-
tretend für einige nicht mehr erhaltene Bauernhäuser
des 16. Jahrhunderts aus Dörfern im Kreis Höxter, die
ähnlich prachtvolle Schnitzgiebel mit Fächerrosetten
besaßen.9
Allerdings war der Valepagenhof kein gewöhnlicher
Bauernhof, sondern ein mittelalterlicher Adelssitz.10
Der Hof, der nach einem Flurstück „auf der Lake" bis
ins 19. Jahrhundert auch „Lakehof" genannt wurde,
war ehemals ein Lehnsgut des Benediktinerklosters
Abdinghof in Paderborn. Im Lehnsregister des Abtes
Gizo (1340/41) und seiner Nachfolger wird ein
Gerardus von der Lake als erster Lehnsträger des spä-
teren Valepagenhofes genannt: Item Gerardus van
der Lake curiam to der Lake in Delebrughe de qua
pensio infrascripta." Möglicherweise ist der mehrfach
als curia bezeichnete Hof aus einem älteren Haupthof
(Villikationshof) des Klosters Abdinghof hervorgegan-
gen. Noch in der Neuzeit gehörte zu dem Hof eine
kleine Grundherrschaft mit vier abhängigen Höfen im
Kirchspiel Delbrück: Der Vollmeier Nellmann in Oster-
loh (1672: 25 Morgen Ackerland), der Vollmeier Nolte
in Westerloh (40 Morgen), der Halbmeier Furlmeier in
Hövelhof (Furlhof, 19 Morgen) und der Achtelmeier
Lübbenmeyer in Delbrück-Dorf Bauerschaft (Lübben-
hof, 8 Morgen). Diese Höfe wurden von eigenbehöri-
gen12 Bauern bewirtschaftet, die an den Valepagen-
hof Abgaben und Dienste leisten mussten.13
1389 erfolgte die Belehnung des Heinrich von
Wichmodeberg (Wichmannsberg), genannt Valepage,
mit dem Hof. Diese Familie ist 1311 erstmals als
Ministerialengeschlecht der Edelherren von Büren
(südlich von Paderborn) nachweisbar; mit der Beleh-
nung verlagerte sie ihren Sitz nach Delbrück.14 Nach
der Mitte des 15. Jahrhunderts starben die Valepage
im Mannesstamme aus; das Lehen ging durch