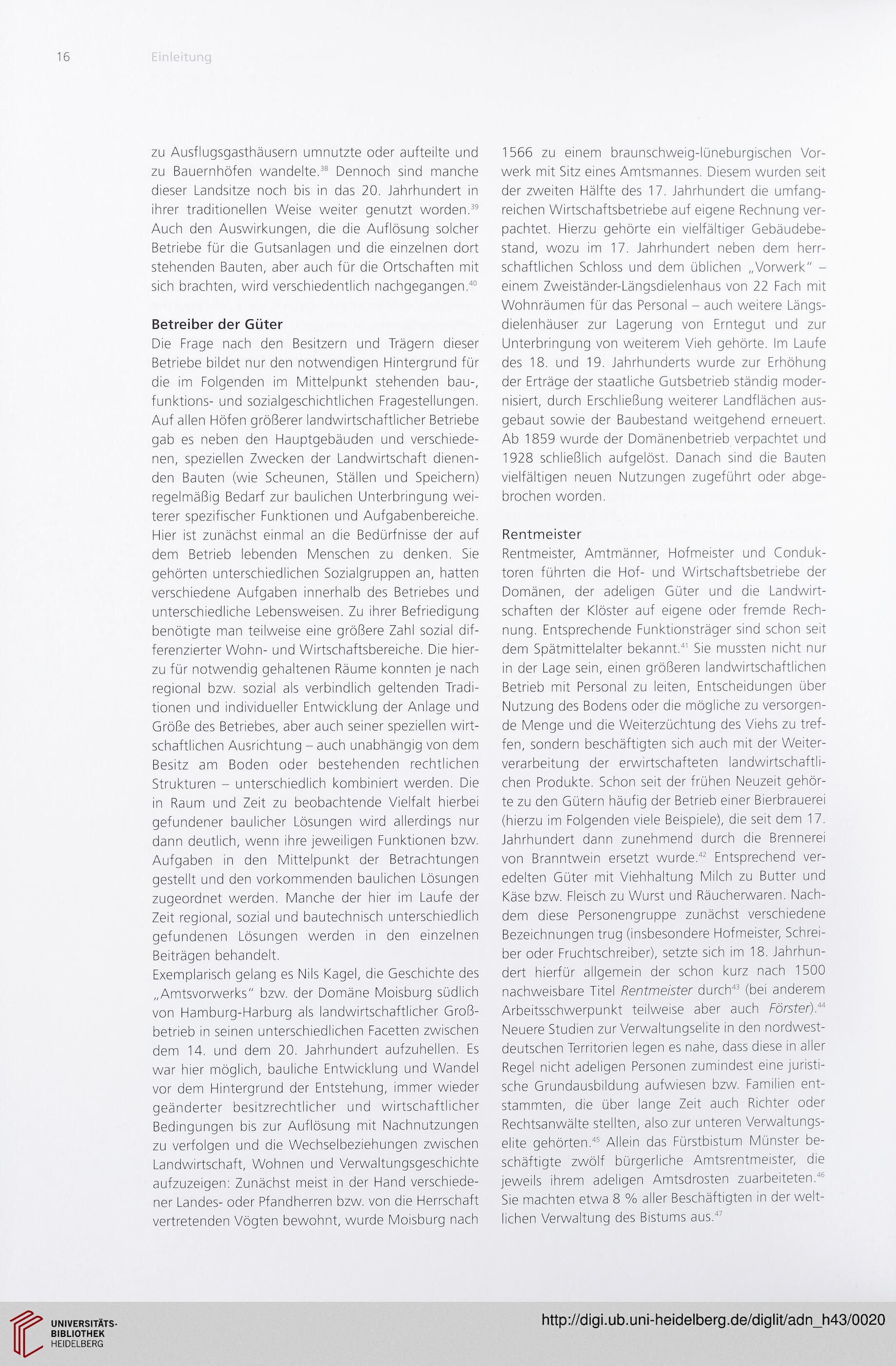16
Einleitung
zu Ausflugsgasthäusern umnutzte oder aufteilte und
zu Bauernhöfen wandelte.38 Dennoch sind manche
dieser Landsitze noch bis in das 20. Jahrhundert in
ihrer traditionellen Weise weiter genutzt worden.39
Auch den Auswirkungen, die die Auflösung solcher
Betriebe für die Gutsanlagen und die einzelnen dort
stehenden Bauten, aber auch für die Ortschaften mit
sich brachten, wird verschiedentlich nachgegangen.40
Betreiber der Güter
Die Frage nach den Besitzern und Trägern dieser
Betriebe bildet nur den notwendigen Hintergrund für
die im Folgenden im Mittelpunkt stehenden bau-,
funktions- und sozialgeschichtlichen Fragestellungen.
Auf allen Höfen größerer landwirtschaftlicher Betriebe
gab es neben den Hauptgebäuden und verschiede-
nen, speziellen Zwecken der Landwirtschaft dienen-
den Bauten (wie Scheunen, Ställen und Speichern)
regelmäßig Bedarf zur baulichen Unterbringung wei-
terer spezifischer Funktionen und Aufgabenbereiche.
Hier ist zunächst einmal an die Bedürfnisse der auf
dem Betrieb lebenden Menschen zu denken. Sie
gehörten unterschiedlichen Sozialgruppen an, hatten
verschiedene Aufgaben innerhalb des Betriebes und
unterschiedliche Lebensweisen. Zu ihrer Befriedigung
benötigte man teilweise eine größere Zahl sozial dif-
ferenzierter Wohn- und Wirtschaftsbereiche. Die hier-
zu für notwendig gehaltenen Räume konnten je nach
regional bzw. sozial als verbindlich geltenden Tradi-
tionen und individueller Entwicklung der Anlage und
Größe des Betriebes, aber auch seiner speziellen wirt-
schaftlichen Ausrichtung - auch unabhängig von dem
Besitz am Boden oder bestehenden rechtlichen
Strukturen - unterschiedlich kombiniert werden. Die
in Raum und Zeit zu beobachtende Vielfalt hierbei
gefundener baulicher Lösungen wird allerdings nur
dann deutlich, wenn ihre jeweiligen Funktionen bzw.
Aufgaben in den Mittelpunkt der Betrachtungen
gestellt und den vorkommenden baulichen Lösungen
zugeordnet werden. Manche der hier im Laufe der
Zeit regional, sozial und bautechnisch unterschiedlich
gefundenen Lösungen werden in den einzelnen
Beiträgen behandelt.
Exemplarisch gelang es Nils Kagel, die Geschichte des
„Amtsvorwerks" bzw. der Domäne Moisburg südlich
von Hamburg-Harburg als landwirtschaftlicher Groß-
betrieb in seinen unterschiedlichen Facetten zwischen
dem 14. und dem 20. Jahrhundert aufzuhellen. Es
war hier möglich, bauliche Entwicklung und Wandel
vor dem Hintergrund der Entstehung, immer wieder
geänderter besitzrechtlicher und wirtschaftlicher
Bedingungen bis zur Auflösung mit Nachnutzungen
zu verfolgen und die Wechselbeziehungen zwischen
Landwirtschaft, Wohnen und Verwaltungsgeschichte
aufzuzeigen: Zunächst meist in der Hand verschiede-
ner Landes- oder Pfandherren bzw. von die Herrschaft
vertretenden Vögten bewohnt, wurde Moisburg nach
1566 zu einem braunschweig-lüneburgischen Vor-
werk mit Sitz eines Amtsmannes. Diesem wurden seit
der zweiten Hälfte des 17. Jahrhundert die umfang-
reichen Wirtschaftsbetriebe auf eigene Rechnung ver-
pachtet. Hierzu gehörte ein vielfältiger Gebäudebe-
stand, wozu im 17. Jahrhundert neben dem herr-
schaftlichen Schloss und dem üblichen „Vorwerk" -
einem Zweiständer-Längsdielenhaus von 22 Fach mit
Wohnräumen für das Personal - auch weitere Längs-
dielenhäuser zur Lagerung von Erntegut und zur
Unterbringung von weiterem Vieh gehörte. Im Laufe
des 18. und 19. Jahrhunderts wurde zur Erhöhung
der Erträge der staatliche Gutsbetrieb ständig moder-
nisiert, durch Erschließung weiterer Landflächen aus-
gebaut sowie der Baubestand weitgehend erneuert.
Ab 1859 wurde der Domänenbetrieb verpachtet und
1928 schließlich aufgelöst. Danach sind die Bauten
vielfältigen neuen Nutzungen zugeführt oder abge-
brochen worden.
Rentmeister
Rentmeister, Amtmänner, Hofmeister und Conduk-
toren führten die Hof- und Wirtschaftsbetriebe der
Domänen, der adeligen Güter und die Landwirt-
schaften der Klöster auf eigene oder fremde Rech-
nung. Entsprechende Funktionsträger sind schon seit
dem Spätmittelalter bekannt.4' Sie mussten nicht nur
in der Lage sein, einen größeren landwirtschaftlichen
Betrieb mit Personal zu leiten, Entscheidungen über
Nutzung des Bodens oder die mögliche zu versorgen-
de Menge und die Weiterzüchtung des Viehs zu tref-
fen, sondern beschäftigten sich auch mit der Weiter-
verarbeitung der erwirtschafteten landwirtschaftli-
chen Produkte. Schon seit der frühen Neuzeit gehör-
te zu den Gütern häufig der Betrieb einer Bierbrauerei
(hierzu im Folgenden viele Beispiele), die seit dem 17.
Jahrhundert dann zunehmend durch die Brennerei
von Branntwein ersetzt wurde.42 Entsprechend ver-
edelten Güter mit Viehhaltung Milch zu Butter und
Käse bzw. Fleisch zu Wurst und Räucherwaren. Nach-
dem diese Personengruppe zunächst verschiedene
Bezeichnungen trug (insbesondere Hofmeister, Schrei-
ber oder Fruchtschreiber), setzte sich im 18. Jahrhun-
dert hierfür allgemein der schon kurz nach 1500
nachweisbare Titel Rentmeister durch43 (bei anderem
Arbeitsschwerpunkt teilweise aber auch Förster).44
Neuere Studien zur Verwaltungselite in den nordwest-
deutschen Territorien legen es nahe, dass diese in aller
Regel nicht adeligen Personen zumindest eine juristi-
sche Grundausbildung aufwiesen bzw. Familien ent-
stammten, die über lange Zeit auch Richter oder
Rechtsanwälte stellten, also zur unteren Verwaltungs-
elite gehörten.45 Allein das Fürstbistum Münster be-
schäftigte zwölf bürgerliche Amtsrentmeister, die
jeweils ihrem adeligen Amtsdrosten zuarbeiteten.46
Sie machten etwa 8 % aller Beschäftigten in der welt-
lichen Verwaltung des Bistums aus.47
Einleitung
zu Ausflugsgasthäusern umnutzte oder aufteilte und
zu Bauernhöfen wandelte.38 Dennoch sind manche
dieser Landsitze noch bis in das 20. Jahrhundert in
ihrer traditionellen Weise weiter genutzt worden.39
Auch den Auswirkungen, die die Auflösung solcher
Betriebe für die Gutsanlagen und die einzelnen dort
stehenden Bauten, aber auch für die Ortschaften mit
sich brachten, wird verschiedentlich nachgegangen.40
Betreiber der Güter
Die Frage nach den Besitzern und Trägern dieser
Betriebe bildet nur den notwendigen Hintergrund für
die im Folgenden im Mittelpunkt stehenden bau-,
funktions- und sozialgeschichtlichen Fragestellungen.
Auf allen Höfen größerer landwirtschaftlicher Betriebe
gab es neben den Hauptgebäuden und verschiede-
nen, speziellen Zwecken der Landwirtschaft dienen-
den Bauten (wie Scheunen, Ställen und Speichern)
regelmäßig Bedarf zur baulichen Unterbringung wei-
terer spezifischer Funktionen und Aufgabenbereiche.
Hier ist zunächst einmal an die Bedürfnisse der auf
dem Betrieb lebenden Menschen zu denken. Sie
gehörten unterschiedlichen Sozialgruppen an, hatten
verschiedene Aufgaben innerhalb des Betriebes und
unterschiedliche Lebensweisen. Zu ihrer Befriedigung
benötigte man teilweise eine größere Zahl sozial dif-
ferenzierter Wohn- und Wirtschaftsbereiche. Die hier-
zu für notwendig gehaltenen Räume konnten je nach
regional bzw. sozial als verbindlich geltenden Tradi-
tionen und individueller Entwicklung der Anlage und
Größe des Betriebes, aber auch seiner speziellen wirt-
schaftlichen Ausrichtung - auch unabhängig von dem
Besitz am Boden oder bestehenden rechtlichen
Strukturen - unterschiedlich kombiniert werden. Die
in Raum und Zeit zu beobachtende Vielfalt hierbei
gefundener baulicher Lösungen wird allerdings nur
dann deutlich, wenn ihre jeweiligen Funktionen bzw.
Aufgaben in den Mittelpunkt der Betrachtungen
gestellt und den vorkommenden baulichen Lösungen
zugeordnet werden. Manche der hier im Laufe der
Zeit regional, sozial und bautechnisch unterschiedlich
gefundenen Lösungen werden in den einzelnen
Beiträgen behandelt.
Exemplarisch gelang es Nils Kagel, die Geschichte des
„Amtsvorwerks" bzw. der Domäne Moisburg südlich
von Hamburg-Harburg als landwirtschaftlicher Groß-
betrieb in seinen unterschiedlichen Facetten zwischen
dem 14. und dem 20. Jahrhundert aufzuhellen. Es
war hier möglich, bauliche Entwicklung und Wandel
vor dem Hintergrund der Entstehung, immer wieder
geänderter besitzrechtlicher und wirtschaftlicher
Bedingungen bis zur Auflösung mit Nachnutzungen
zu verfolgen und die Wechselbeziehungen zwischen
Landwirtschaft, Wohnen und Verwaltungsgeschichte
aufzuzeigen: Zunächst meist in der Hand verschiede-
ner Landes- oder Pfandherren bzw. von die Herrschaft
vertretenden Vögten bewohnt, wurde Moisburg nach
1566 zu einem braunschweig-lüneburgischen Vor-
werk mit Sitz eines Amtsmannes. Diesem wurden seit
der zweiten Hälfte des 17. Jahrhundert die umfang-
reichen Wirtschaftsbetriebe auf eigene Rechnung ver-
pachtet. Hierzu gehörte ein vielfältiger Gebäudebe-
stand, wozu im 17. Jahrhundert neben dem herr-
schaftlichen Schloss und dem üblichen „Vorwerk" -
einem Zweiständer-Längsdielenhaus von 22 Fach mit
Wohnräumen für das Personal - auch weitere Längs-
dielenhäuser zur Lagerung von Erntegut und zur
Unterbringung von weiterem Vieh gehörte. Im Laufe
des 18. und 19. Jahrhunderts wurde zur Erhöhung
der Erträge der staatliche Gutsbetrieb ständig moder-
nisiert, durch Erschließung weiterer Landflächen aus-
gebaut sowie der Baubestand weitgehend erneuert.
Ab 1859 wurde der Domänenbetrieb verpachtet und
1928 schließlich aufgelöst. Danach sind die Bauten
vielfältigen neuen Nutzungen zugeführt oder abge-
brochen worden.
Rentmeister
Rentmeister, Amtmänner, Hofmeister und Conduk-
toren führten die Hof- und Wirtschaftsbetriebe der
Domänen, der adeligen Güter und die Landwirt-
schaften der Klöster auf eigene oder fremde Rech-
nung. Entsprechende Funktionsträger sind schon seit
dem Spätmittelalter bekannt.4' Sie mussten nicht nur
in der Lage sein, einen größeren landwirtschaftlichen
Betrieb mit Personal zu leiten, Entscheidungen über
Nutzung des Bodens oder die mögliche zu versorgen-
de Menge und die Weiterzüchtung des Viehs zu tref-
fen, sondern beschäftigten sich auch mit der Weiter-
verarbeitung der erwirtschafteten landwirtschaftli-
chen Produkte. Schon seit der frühen Neuzeit gehör-
te zu den Gütern häufig der Betrieb einer Bierbrauerei
(hierzu im Folgenden viele Beispiele), die seit dem 17.
Jahrhundert dann zunehmend durch die Brennerei
von Branntwein ersetzt wurde.42 Entsprechend ver-
edelten Güter mit Viehhaltung Milch zu Butter und
Käse bzw. Fleisch zu Wurst und Räucherwaren. Nach-
dem diese Personengruppe zunächst verschiedene
Bezeichnungen trug (insbesondere Hofmeister, Schrei-
ber oder Fruchtschreiber), setzte sich im 18. Jahrhun-
dert hierfür allgemein der schon kurz nach 1500
nachweisbare Titel Rentmeister durch43 (bei anderem
Arbeitsschwerpunkt teilweise aber auch Förster).44
Neuere Studien zur Verwaltungselite in den nordwest-
deutschen Territorien legen es nahe, dass diese in aller
Regel nicht adeligen Personen zumindest eine juristi-
sche Grundausbildung aufwiesen bzw. Familien ent-
stammten, die über lange Zeit auch Richter oder
Rechtsanwälte stellten, also zur unteren Verwaltungs-
elite gehörten.45 Allein das Fürstbistum Münster be-
schäftigte zwölf bürgerliche Amtsrentmeister, die
jeweils ihrem adeligen Amtsdrosten zuarbeiteten.46
Sie machten etwa 8 % aller Beschäftigten in der welt-
lichen Verwaltung des Bistums aus.47