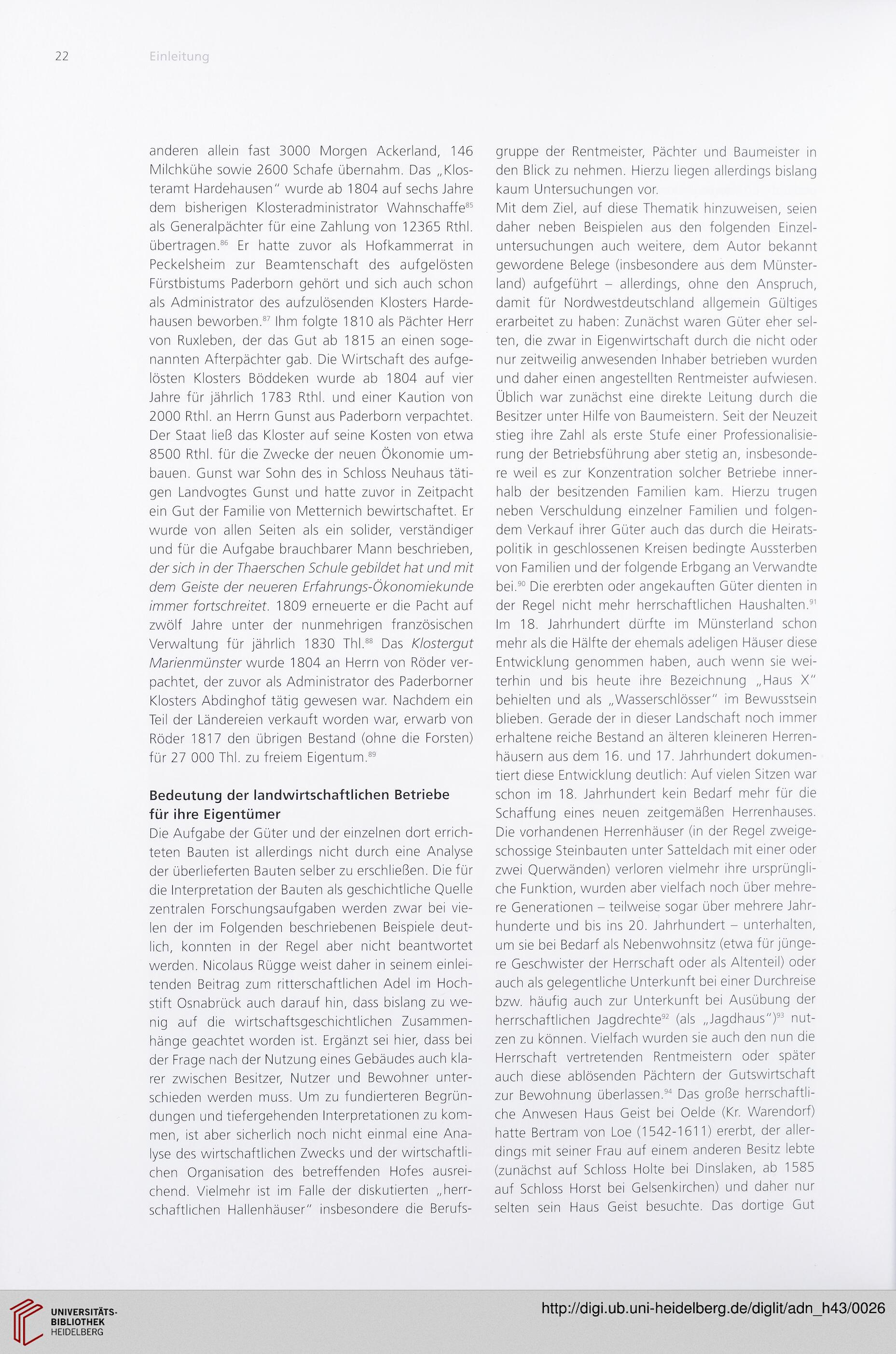22
Einleitung
anderen allein fast 3000 Morgen Ackerland, 146
Milchkühe sowie 2600 Schafe übernahm. Das „Klos-
teramt Hardehausen" wurde ab 1804 auf sechs Jahre
dem bisherigen Klosteradministrator Wahnschaffe85
als Generalpächter für eine Zahlung von 12365 Rthl.
übertragen.86 Er hatte zuvor als Hofkammerrat in
Peckelsheim zur Beamtenschaft des aufgelösten
Fürstbistums Paderborn gehört und sich auch schon
als Administrator des aufzulösenden Klosters Harde-
hausen beworben.87 Ihm folgte 1810 als Pächter Herr
von Ruxleben, der das Gut ab 1815 an einen soge-
nannten Afterpächter gab. Die Wirtschaft des aufge-
lösten Klosters Böddeken wurde ab 1804 auf vier
Jahre für jährlich 1783 Rthl. und einer Kaution von
2000 Rthl. an Herrn Gunst aus Paderborn verpachtet.
Der Staat ließ das Kloster auf seine Kosten von etwa
8500 Rthl. für die Zwecke der neuen Ökonomie um-
bauen. Gunst war Sohn des in Schloss Neuhaus täti-
gen Landvogtes Gunst und hatte zuvor in Zeitpacht
ein Gut der Familie von Metternich bewirtschaftet. Er
wurde von allen Seiten als ein solider, verständiger
und für die Aufgabe brauchbarer Mann beschrieben,
der sich in der Thaerschen Schule gebildet hat und mit
dem Geiste der neueren Erfahrungs-Ökonomiekunde
immer fortschreitet. 1809 erneuerte er die Pacht auf
zwölf Jahre unter der nunmehrigen französischen
Verwaltung für jährlich 1830 Thl.88 Das Klostergut
Marienmünster wurde 1804 an Herrn von Röder ver-
pachtet, der zuvor als Administrator des Paderborner
Klosters Abdinghof tätig gewesen war. Nachdem ein
Teil der Ländereien verkauft worden war, erwarb von
Röder 1817 den übrigen Bestand (ohne die Forsten)
für 27 000 Thl. zu freiem Eigentum.89
Bedeutung der landwirtschaftlichen Betriebe
für ihre Eigentümer
Die Aufgabe der Güter und der einzelnen dort errich-
teten Bauten ist allerdings nicht durch eine Analyse
der überlieferten Bauten selber zu erschließen. Die für
die Interpretation der Bauten als geschichtliche Quelle
zentralen Forschungsaufgaben werden zwar bei vie-
len der im Folgenden beschriebenen Beispiele deut-
lich, konnten in der Regel aber nicht beantwortet
werden. Nicolaus Rügge weist daher in seinem einlei-
tenden Beitrag zum ritterschaftlichen Adel im Hoch-
stift Osnabrück auch darauf hin, dass bislang zu we-
nig auf die wirtschaftsgeschichtlichen Zusammen-
hänge geachtet worden ist. Ergänzt sei hier, dass bei
der Frage nach der Nutzung eines Gebäudes auch kla-
rer zwischen Besitzer, Nutzer und Bewohner unter-
schieden werden muss. Um zu fundierteren Begrün-
dungen und tiefergehenden Interpretationen zu kom-
men, ist aber sicherlich noch nicht einmal eine Ana-
lyse des wirtschaftlichen Zwecks und der wirtschaftli-
chen Organisation des betreffenden Hofes ausrei-
chend. Vielmehr ist im Falle der diskutierten „herr-
schaftlichen Hallenhäuser" insbesondere die Berufs-
gruppe der Rentmeister, Pächter und Baumeister in
den Blick zu nehmen. Hierzu liegen allerdings bislang
kaum Untersuchungen vor.
Mit dem Ziel, auf diese Thematik hinzuweisen, seien
daher neben Beispielen aus den folgenden Einzel-
untersuchungen auch weitere, dem Autor bekannt
gewordene Belege (insbesondere aus dem Münster-
land) aufgeführt - allerdings, ohne den Anspruch,
damit für Nordwestdeutschland allgemein Gültiges
erarbeitet zu haben: Zunächst waren Güter eher sel-
ten, die zwar in Eigenwirtschaft durch die nicht oder
nur zeitweilig anwesenden Inhaber betrieben wurden
und daher einen angestellten Rentmeister aufwiesen.
Üblich war zunächst eine direkte Leitung durch die
Besitzer unter Hilfe von Baumeistern. Seit der Neuzeit
stieg ihre Zahl als erste Stufe einer Professionalisie-
rung der Betriebsführung aber stetig an, insbesonde-
re weil es zur Konzentration solcher Betriebe inner-
halb der besitzenden Familien kam. Hierzu trugen
neben Verschuldung einzelner Familien und folgen-
dem Verkauf ihrer Güter auch das durch die Heirats-
politik in geschlossenen Kreisen bedingte Aussterben
von Familien und der folgende Erbgang an Verwandte
bei.90 Die ererbten oder angekauften Güter dienten in
der Regel nicht mehr herrschaftlichen Haushalten.91
Im 18. Jahrhundert dürfte im Münsterland schon
mehr als die Hälfte der ehemals adeligen Häuser diese
Entwicklung genommen haben, auch wenn sie wei-
terhin und bis heute ihre Bezeichnung „Haus X"
behielten und als „Wasserschlösser" im Bewusstsein
blieben. Gerade der in dieser Landschaft noch immer
erhaltene reiche Bestand an älteren kleineren Herren-
häusern aus dem 16. und 17. Jahrhundert dokumen-
tiert diese Entwicklung deutlich: Auf vielen Sitzen war
schon im 18. Jahrhundert kein Bedarf mehr für die
Schaffung eines neuen zeitgemäßen Herrenhauses.
Die vorhandenen Herrenhäuser (in der Regel zweige-
schossige Steinbauten unter Satteldach mit einer oder
zwei Querwänden) verloren vielmehr ihre ursprüngli-
che Funktion, wurden aber vielfach noch über mehre-
re Generationen - teilweise sogar über mehrere Jahr-
hunderte und bis ins 20. Jahrhundert - unterhalten,
um sie bei Bedarf als Nebenwohnsitz (etwa für jünge-
re Geschwister der Herrschaft oder als Altenteil) oder
auch als gelegentliche Unterkunft bei einer Durchreise
bzw. häufig auch zur Unterkunft bei Ausübung der
herrschaftlichen Jagdrechte92 (als „Jagdhaus")93 nut-
zen zu können. Vielfach wurden sie auch den nun die
Herrschaft vertretenden Rentmeistern oder später
auch diese ablösenden Pächtern der Gutswirtschaft
zur Bewohnung überlassen.94 Das große herrschaftli-
che Anwesen Haus Geist bei Oelde (Kr. Warendorf)
hatte Bertram von Loe (1542-161 1) ererbt, der aller-
dings mit seiner Frau auf einem anderen Besitz lebte
(zunächst auf Schloss Holte bei Dinslaken, ab 1585
auf Schloss Horst bei Gelsenkirchen) und daher nur
selten sein Haus Geist besuchte. Das dortige Gut
Einleitung
anderen allein fast 3000 Morgen Ackerland, 146
Milchkühe sowie 2600 Schafe übernahm. Das „Klos-
teramt Hardehausen" wurde ab 1804 auf sechs Jahre
dem bisherigen Klosteradministrator Wahnschaffe85
als Generalpächter für eine Zahlung von 12365 Rthl.
übertragen.86 Er hatte zuvor als Hofkammerrat in
Peckelsheim zur Beamtenschaft des aufgelösten
Fürstbistums Paderborn gehört und sich auch schon
als Administrator des aufzulösenden Klosters Harde-
hausen beworben.87 Ihm folgte 1810 als Pächter Herr
von Ruxleben, der das Gut ab 1815 an einen soge-
nannten Afterpächter gab. Die Wirtschaft des aufge-
lösten Klosters Böddeken wurde ab 1804 auf vier
Jahre für jährlich 1783 Rthl. und einer Kaution von
2000 Rthl. an Herrn Gunst aus Paderborn verpachtet.
Der Staat ließ das Kloster auf seine Kosten von etwa
8500 Rthl. für die Zwecke der neuen Ökonomie um-
bauen. Gunst war Sohn des in Schloss Neuhaus täti-
gen Landvogtes Gunst und hatte zuvor in Zeitpacht
ein Gut der Familie von Metternich bewirtschaftet. Er
wurde von allen Seiten als ein solider, verständiger
und für die Aufgabe brauchbarer Mann beschrieben,
der sich in der Thaerschen Schule gebildet hat und mit
dem Geiste der neueren Erfahrungs-Ökonomiekunde
immer fortschreitet. 1809 erneuerte er die Pacht auf
zwölf Jahre unter der nunmehrigen französischen
Verwaltung für jährlich 1830 Thl.88 Das Klostergut
Marienmünster wurde 1804 an Herrn von Röder ver-
pachtet, der zuvor als Administrator des Paderborner
Klosters Abdinghof tätig gewesen war. Nachdem ein
Teil der Ländereien verkauft worden war, erwarb von
Röder 1817 den übrigen Bestand (ohne die Forsten)
für 27 000 Thl. zu freiem Eigentum.89
Bedeutung der landwirtschaftlichen Betriebe
für ihre Eigentümer
Die Aufgabe der Güter und der einzelnen dort errich-
teten Bauten ist allerdings nicht durch eine Analyse
der überlieferten Bauten selber zu erschließen. Die für
die Interpretation der Bauten als geschichtliche Quelle
zentralen Forschungsaufgaben werden zwar bei vie-
len der im Folgenden beschriebenen Beispiele deut-
lich, konnten in der Regel aber nicht beantwortet
werden. Nicolaus Rügge weist daher in seinem einlei-
tenden Beitrag zum ritterschaftlichen Adel im Hoch-
stift Osnabrück auch darauf hin, dass bislang zu we-
nig auf die wirtschaftsgeschichtlichen Zusammen-
hänge geachtet worden ist. Ergänzt sei hier, dass bei
der Frage nach der Nutzung eines Gebäudes auch kla-
rer zwischen Besitzer, Nutzer und Bewohner unter-
schieden werden muss. Um zu fundierteren Begrün-
dungen und tiefergehenden Interpretationen zu kom-
men, ist aber sicherlich noch nicht einmal eine Ana-
lyse des wirtschaftlichen Zwecks und der wirtschaftli-
chen Organisation des betreffenden Hofes ausrei-
chend. Vielmehr ist im Falle der diskutierten „herr-
schaftlichen Hallenhäuser" insbesondere die Berufs-
gruppe der Rentmeister, Pächter und Baumeister in
den Blick zu nehmen. Hierzu liegen allerdings bislang
kaum Untersuchungen vor.
Mit dem Ziel, auf diese Thematik hinzuweisen, seien
daher neben Beispielen aus den folgenden Einzel-
untersuchungen auch weitere, dem Autor bekannt
gewordene Belege (insbesondere aus dem Münster-
land) aufgeführt - allerdings, ohne den Anspruch,
damit für Nordwestdeutschland allgemein Gültiges
erarbeitet zu haben: Zunächst waren Güter eher sel-
ten, die zwar in Eigenwirtschaft durch die nicht oder
nur zeitweilig anwesenden Inhaber betrieben wurden
und daher einen angestellten Rentmeister aufwiesen.
Üblich war zunächst eine direkte Leitung durch die
Besitzer unter Hilfe von Baumeistern. Seit der Neuzeit
stieg ihre Zahl als erste Stufe einer Professionalisie-
rung der Betriebsführung aber stetig an, insbesonde-
re weil es zur Konzentration solcher Betriebe inner-
halb der besitzenden Familien kam. Hierzu trugen
neben Verschuldung einzelner Familien und folgen-
dem Verkauf ihrer Güter auch das durch die Heirats-
politik in geschlossenen Kreisen bedingte Aussterben
von Familien und der folgende Erbgang an Verwandte
bei.90 Die ererbten oder angekauften Güter dienten in
der Regel nicht mehr herrschaftlichen Haushalten.91
Im 18. Jahrhundert dürfte im Münsterland schon
mehr als die Hälfte der ehemals adeligen Häuser diese
Entwicklung genommen haben, auch wenn sie wei-
terhin und bis heute ihre Bezeichnung „Haus X"
behielten und als „Wasserschlösser" im Bewusstsein
blieben. Gerade der in dieser Landschaft noch immer
erhaltene reiche Bestand an älteren kleineren Herren-
häusern aus dem 16. und 17. Jahrhundert dokumen-
tiert diese Entwicklung deutlich: Auf vielen Sitzen war
schon im 18. Jahrhundert kein Bedarf mehr für die
Schaffung eines neuen zeitgemäßen Herrenhauses.
Die vorhandenen Herrenhäuser (in der Regel zweige-
schossige Steinbauten unter Satteldach mit einer oder
zwei Querwänden) verloren vielmehr ihre ursprüngli-
che Funktion, wurden aber vielfach noch über mehre-
re Generationen - teilweise sogar über mehrere Jahr-
hunderte und bis ins 20. Jahrhundert - unterhalten,
um sie bei Bedarf als Nebenwohnsitz (etwa für jünge-
re Geschwister der Herrschaft oder als Altenteil) oder
auch als gelegentliche Unterkunft bei einer Durchreise
bzw. häufig auch zur Unterkunft bei Ausübung der
herrschaftlichen Jagdrechte92 (als „Jagdhaus")93 nut-
zen zu können. Vielfach wurden sie auch den nun die
Herrschaft vertretenden Rentmeistern oder später
auch diese ablösenden Pächtern der Gutswirtschaft
zur Bewohnung überlassen.94 Das große herrschaftli-
che Anwesen Haus Geist bei Oelde (Kr. Warendorf)
hatte Bertram von Loe (1542-161 1) ererbt, der aller-
dings mit seiner Frau auf einem anderen Besitz lebte
(zunächst auf Schloss Holte bei Dinslaken, ab 1585
auf Schloss Horst bei Gelsenkirchen) und daher nur
selten sein Haus Geist besuchte. Das dortige Gut