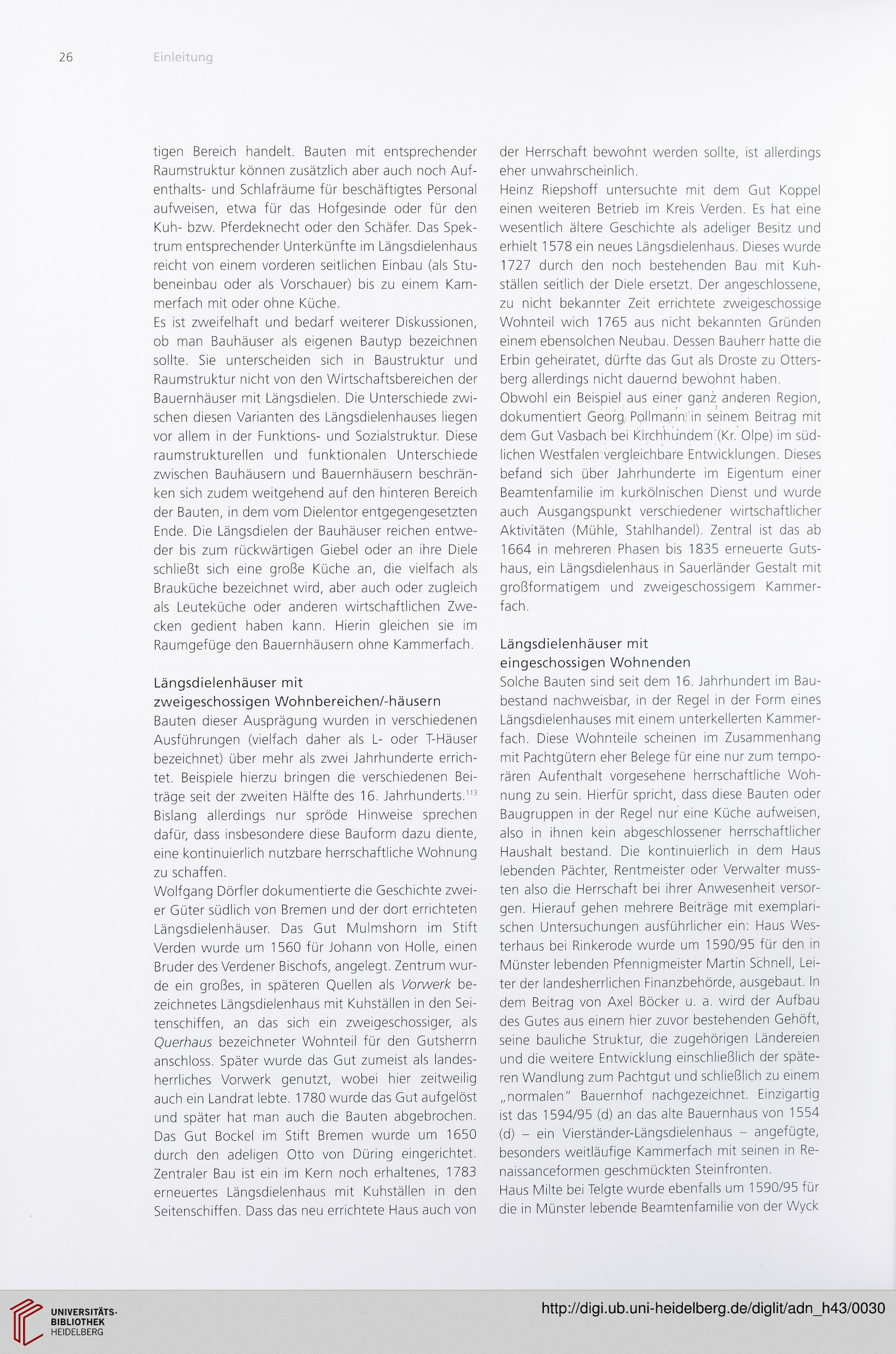26
Einleitung
tigen Bereich handelt. Bauten mit entsprechender
Raumstruktur können zusätzlich aber auch noch Auf-
enthalts- und Schlafräume für beschäftigtes Personal
aufweisen, etwa für das Hofgesinde oder für den
Kuh- bzw. Pferdeknecht oder den Schäfer. Das Spek-
trum entsprechender Unterkünfte im Längsdielenhaus
reicht von einem vorderen seitlichen Einbau (als Stu-
beneinbau oder als Vorschauer) bis zu einem Kam-
merfach mit oder ohne Küche.
Es ist zweifelhaft und bedarf weiterer Diskussionen,
ob man Bauhäuser als eigenen Bautyp bezeichnen
sollte. Sie unterscheiden sich in Baustruktur und
Raumstruktur nicht von den Wirtschaftsbereichen der
Bauernhäuser mit Längsdielen. Die Unterschiede zwi-
schen diesen Varianten des Längsdielenhauses liegen
vor allem in der Funktions- und Sozialstruktur. Diese
raumstrukturellen und funktionalen Unterschiede
zwischen Bauhäusern und Bauernhäusern beschrän-
ken sich zudem weitgehend auf den hinteren Bereich
der Bauten, in dem vom Dielentor entgegengesetzten
Ende. Die Längsdielen der Bauhäuser reichen entwe-
der bis zum rückwärtigen Giebel oder an ihre Diele
schließt sich eine große Küche an, die vielfach als
Brauküche bezeichnet wird, aber auch oder zugleich
als Leuteküche oder anderen wirtschaftlichen Zwe-
cken gedient haben kann. Hierin gleichen sie im
Raumgefüge den Bauernhäusern ohne Kammerfach.
Längsdielenhäuser mit
zweigeschossigen Wohnbereichen/-häusern
Bauten dieser Ausprägung wurden in verschiedenen
Ausführungen (vielfach daher als L- oder T-Häuser
bezeichnet) über mehr als zwei Jahrhunderte errich-
tet. Beispiele hierzu bringen die verschiedenen Bei-
träge seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts.113
Bislang allerdings nur spröde Hinweise sprechen
dafür, dass insbesondere diese Bauform dazu diente,
eine kontinuierlich nutzbare herrschaftliche Wohnung
zu schaffen.
Wolfgang Dörfler dokumentierte die Geschichte zwei-
er Güter südlich von Bremen und der dort errichteten
Längsdielenhäuser. Das Gut Mulmshorn im Stift
Verden wurde um 1560 für Johann von Holle, einen
Bruder des Verdener Bischofs, angelegt. Zentrum wur-
de ein großes, in späteren Quellen als Vorwerk be-
zeichnetes Längsdielenhaus mit Kuhställen in den Sei-
tenschiffen, an das sich ein zweigeschossiger, als
Querhaus bezeichneter Wohnteil für den Gutsherrn
anschloss. Später wurde das Gut zumeist als landes-
herrliches Vorwerk genutzt, wobei hier zeitweilig
auch ein Landrat lebte. 1780 wurde das Gut aufgelöst
und später hat man auch die Bauten abgebrochen.
Das Gut Bockei im Stift Bremen wurde um 1650
durch den adeligen Otto von Düring eingerichtet.
Zentraler Bau ist ein im Kern noch erhaltenes, 1783
erneuertes Längsdielenhaus mit Kuhställen in den
Seitenschiffen. Dass das neu errichtete Haus auch von
der Herrschaft bewohnt werden sollte, ist allerdings
eher unwahrscheinlich.
Heinz Riepshoff untersuchte mit dem Gut Koppel
einen weiteren Betrieb im Kreis Verden. Es hat eine
wesentlich ältere Geschichte als adeliger Besitz und
erhielt 1578 ein neues Längsdielenhaus. Dieses wurde
1727 durch den noch bestehenden Bau mit Kuh-
ställen seitlich der Diele ersetzt. Der angeschlossene,
zu nicht bekannter Zeit errichtete zweigeschossige
Wohnteil wich 1765 aus nicht bekannten Gründen
einem ebensolchen Neubau. Dessen Bauherr hatte die
Erbin geheiratet, dürfte das Gut als Droste zu Otters-
berg allerdings nicht dauernd bewohnt haben.
Obwohl ein Beispiel aus einer ganz anderen Region,
dokumentiert Georg Pollma.nn 'in seinem Beitrag mit
dem Gut Vasbach bei Kirchhundem (Kr. Olpe) im süd-
lichen Westfalen vergleichbare Entwicklungen. Dieses
befand sich über Jahrhunderte im Eigentum einer
Beamtenfamilie im kurkölnischen Dienst und wurde
auch Ausgangspunkt verschiedener wirtschaftlicher
Aktivitäten (Mühle, Stahlhandel). Zentral ist das ab
1664 in mehreren Phasen bis 1835 erneuerte Guts-
haus, ein Längsdielenhaus in Sauerländer Gestalt mit
großformatigem und zweigeschossigem Kammer-
fach.
Längsdielenhäuser mit
eingeschossigen Wohnenden
Solche Bauten sind seit dem 16. Jahrhundert im Bau-
bestand nachweisbar, in der Regel in der Form eines
Längsdielenhauses mit einem unterkellerten Kammer-
fach. Diese Wohnteile scheinen im Zusammenhang
mit Pachtgütern eher Belege für eine nur zum tempo-
rären Aufenthalt vorgesehene herrschaftliche Woh-
nung zu sein. Hierfür spricht, dass diese Bauten oder
Baugruppen in der Regel nur eine Küche aufweisen,
also in ihnen kein abgeschlossener herrschaftlicher
Haushalt bestand. Die kontinuierlich in dem Haus
lebenden Pächter, Rentmeister oder Verwalter muss-
ten also die Herrschaft bei ihrer Anwesenheit versor-
gen. Hierauf gehen mehrere Beiträge mit exemplari-
schen Untersuchungen ausführlicher ein: Haus Wes-
terhaus bei Rinkerode wurde um 1590/95 für den in
Münster lebenden Pfennigmeister Martin Schnell, Lei-
ter der landesherrlichen Finanzbehörde, ausgebaut. In
dem Beitrag von Axel Böcker u. a. wird der Aufbau
des Gutes aus einem hier zuvor bestehenden Gehöft,
seine bauliche Struktur, die zugehörigen Ländereien
und die weitere Entwicklung einschließlich der späte-
ren Wandlung zum Pachtgut und schließlich zu einem
„normalen" Bauernhof nachgezeichnet. Einzigartig
ist das 1594/95 (d) an das alte Bauernhaus von 1554
(d) - ein Vierständer-Längsdielenhaus - angefügte,
besonders weitläufige Kammerfach mit seinen in Re-
naissanceformen geschmückten Steinfronten.
Haus Milte bei Telgte wurde ebenfalls um 1590/95 für
die in Münster lebende Beamtenfamilie von der Wyck
Einleitung
tigen Bereich handelt. Bauten mit entsprechender
Raumstruktur können zusätzlich aber auch noch Auf-
enthalts- und Schlafräume für beschäftigtes Personal
aufweisen, etwa für das Hofgesinde oder für den
Kuh- bzw. Pferdeknecht oder den Schäfer. Das Spek-
trum entsprechender Unterkünfte im Längsdielenhaus
reicht von einem vorderen seitlichen Einbau (als Stu-
beneinbau oder als Vorschauer) bis zu einem Kam-
merfach mit oder ohne Küche.
Es ist zweifelhaft und bedarf weiterer Diskussionen,
ob man Bauhäuser als eigenen Bautyp bezeichnen
sollte. Sie unterscheiden sich in Baustruktur und
Raumstruktur nicht von den Wirtschaftsbereichen der
Bauernhäuser mit Längsdielen. Die Unterschiede zwi-
schen diesen Varianten des Längsdielenhauses liegen
vor allem in der Funktions- und Sozialstruktur. Diese
raumstrukturellen und funktionalen Unterschiede
zwischen Bauhäusern und Bauernhäusern beschrän-
ken sich zudem weitgehend auf den hinteren Bereich
der Bauten, in dem vom Dielentor entgegengesetzten
Ende. Die Längsdielen der Bauhäuser reichen entwe-
der bis zum rückwärtigen Giebel oder an ihre Diele
schließt sich eine große Küche an, die vielfach als
Brauküche bezeichnet wird, aber auch oder zugleich
als Leuteküche oder anderen wirtschaftlichen Zwe-
cken gedient haben kann. Hierin gleichen sie im
Raumgefüge den Bauernhäusern ohne Kammerfach.
Längsdielenhäuser mit
zweigeschossigen Wohnbereichen/-häusern
Bauten dieser Ausprägung wurden in verschiedenen
Ausführungen (vielfach daher als L- oder T-Häuser
bezeichnet) über mehr als zwei Jahrhunderte errich-
tet. Beispiele hierzu bringen die verschiedenen Bei-
träge seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts.113
Bislang allerdings nur spröde Hinweise sprechen
dafür, dass insbesondere diese Bauform dazu diente,
eine kontinuierlich nutzbare herrschaftliche Wohnung
zu schaffen.
Wolfgang Dörfler dokumentierte die Geschichte zwei-
er Güter südlich von Bremen und der dort errichteten
Längsdielenhäuser. Das Gut Mulmshorn im Stift
Verden wurde um 1560 für Johann von Holle, einen
Bruder des Verdener Bischofs, angelegt. Zentrum wur-
de ein großes, in späteren Quellen als Vorwerk be-
zeichnetes Längsdielenhaus mit Kuhställen in den Sei-
tenschiffen, an das sich ein zweigeschossiger, als
Querhaus bezeichneter Wohnteil für den Gutsherrn
anschloss. Später wurde das Gut zumeist als landes-
herrliches Vorwerk genutzt, wobei hier zeitweilig
auch ein Landrat lebte. 1780 wurde das Gut aufgelöst
und später hat man auch die Bauten abgebrochen.
Das Gut Bockei im Stift Bremen wurde um 1650
durch den adeligen Otto von Düring eingerichtet.
Zentraler Bau ist ein im Kern noch erhaltenes, 1783
erneuertes Längsdielenhaus mit Kuhställen in den
Seitenschiffen. Dass das neu errichtete Haus auch von
der Herrschaft bewohnt werden sollte, ist allerdings
eher unwahrscheinlich.
Heinz Riepshoff untersuchte mit dem Gut Koppel
einen weiteren Betrieb im Kreis Verden. Es hat eine
wesentlich ältere Geschichte als adeliger Besitz und
erhielt 1578 ein neues Längsdielenhaus. Dieses wurde
1727 durch den noch bestehenden Bau mit Kuh-
ställen seitlich der Diele ersetzt. Der angeschlossene,
zu nicht bekannter Zeit errichtete zweigeschossige
Wohnteil wich 1765 aus nicht bekannten Gründen
einem ebensolchen Neubau. Dessen Bauherr hatte die
Erbin geheiratet, dürfte das Gut als Droste zu Otters-
berg allerdings nicht dauernd bewohnt haben.
Obwohl ein Beispiel aus einer ganz anderen Region,
dokumentiert Georg Pollma.nn 'in seinem Beitrag mit
dem Gut Vasbach bei Kirchhundem (Kr. Olpe) im süd-
lichen Westfalen vergleichbare Entwicklungen. Dieses
befand sich über Jahrhunderte im Eigentum einer
Beamtenfamilie im kurkölnischen Dienst und wurde
auch Ausgangspunkt verschiedener wirtschaftlicher
Aktivitäten (Mühle, Stahlhandel). Zentral ist das ab
1664 in mehreren Phasen bis 1835 erneuerte Guts-
haus, ein Längsdielenhaus in Sauerländer Gestalt mit
großformatigem und zweigeschossigem Kammer-
fach.
Längsdielenhäuser mit
eingeschossigen Wohnenden
Solche Bauten sind seit dem 16. Jahrhundert im Bau-
bestand nachweisbar, in der Regel in der Form eines
Längsdielenhauses mit einem unterkellerten Kammer-
fach. Diese Wohnteile scheinen im Zusammenhang
mit Pachtgütern eher Belege für eine nur zum tempo-
rären Aufenthalt vorgesehene herrschaftliche Woh-
nung zu sein. Hierfür spricht, dass diese Bauten oder
Baugruppen in der Regel nur eine Küche aufweisen,
also in ihnen kein abgeschlossener herrschaftlicher
Haushalt bestand. Die kontinuierlich in dem Haus
lebenden Pächter, Rentmeister oder Verwalter muss-
ten also die Herrschaft bei ihrer Anwesenheit versor-
gen. Hierauf gehen mehrere Beiträge mit exemplari-
schen Untersuchungen ausführlicher ein: Haus Wes-
terhaus bei Rinkerode wurde um 1590/95 für den in
Münster lebenden Pfennigmeister Martin Schnell, Lei-
ter der landesherrlichen Finanzbehörde, ausgebaut. In
dem Beitrag von Axel Böcker u. a. wird der Aufbau
des Gutes aus einem hier zuvor bestehenden Gehöft,
seine bauliche Struktur, die zugehörigen Ländereien
und die weitere Entwicklung einschließlich der späte-
ren Wandlung zum Pachtgut und schließlich zu einem
„normalen" Bauernhof nachgezeichnet. Einzigartig
ist das 1594/95 (d) an das alte Bauernhaus von 1554
(d) - ein Vierständer-Längsdielenhaus - angefügte,
besonders weitläufige Kammerfach mit seinen in Re-
naissanceformen geschmückten Steinfronten.
Haus Milte bei Telgte wurde ebenfalls um 1590/95 für
die in Münster lebende Beamtenfamilie von der Wyck