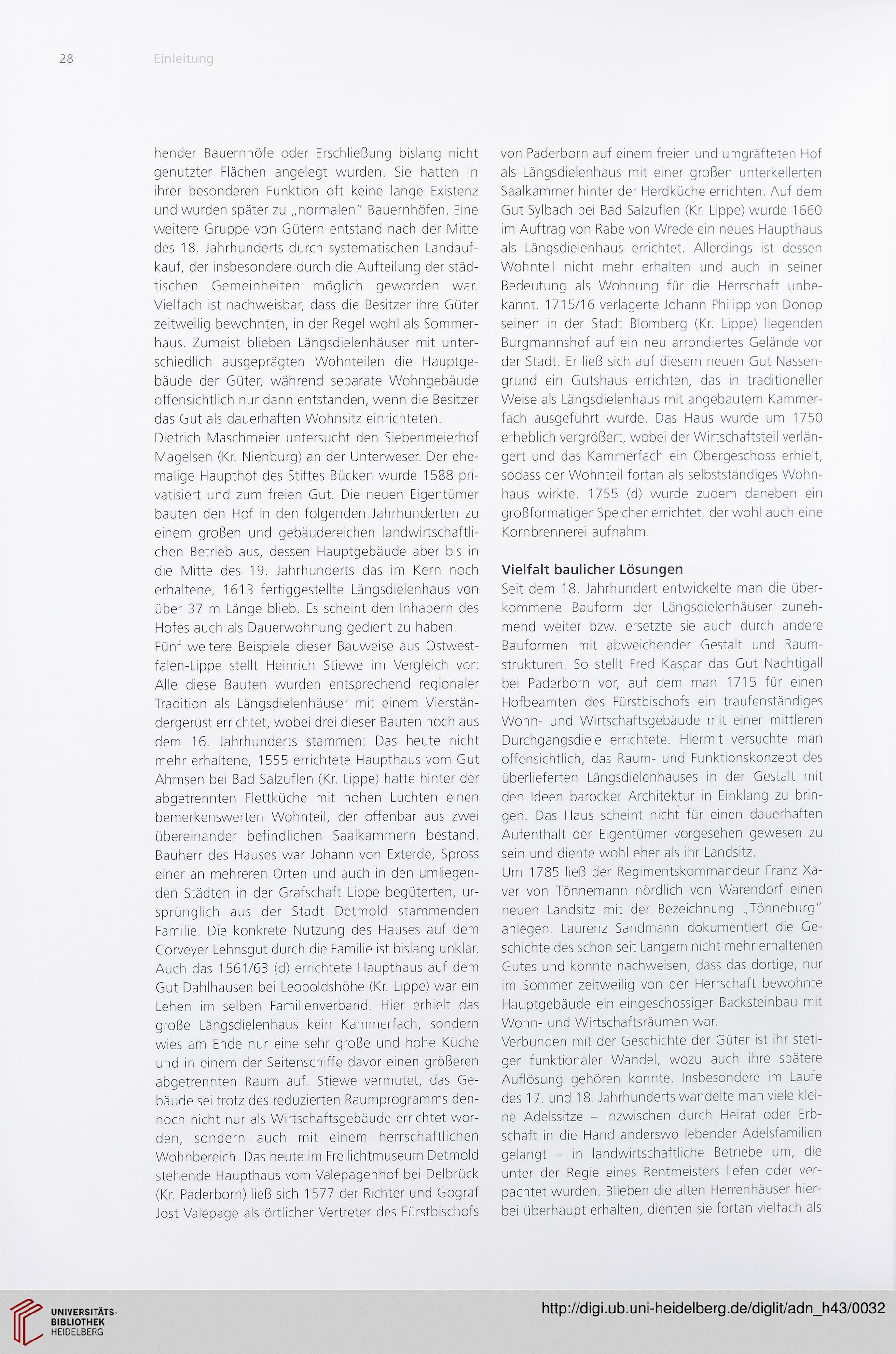28
Einleitung
hender Bauernhöfe oder Erschließung bislang nicht
genutzter Flächen angelegt wurden. Sie hatten in
ihrer besonderen Funktion oft keine lange Existenz
und wurden später zu „normalen" Bauernhöfen. Eine
weitere Gruppe von Gütern entstand nach der Mitte
des 18. Jahrhunderts durch systematischen Landauf-
kauf, der insbesondere durch die Aufteilung der städ-
tischen Gemeinheiten möglich geworden war.
Vielfach ist nachweisbar, dass die Besitzer ihre Güter
zeitweilig bewohnten, in der Regel wohl als Sommer-
haus. Zumeist blieben Längsdielenhäuser mit unter-
schiedlich ausgeprägten Wohnteilen die Hauptge-
bäude der Güter, während separate Wohngebäude
offensichtlich nur dann entstanden, wenn die Besitzer
das Gut als dauerhaften Wohnsitz einrichteten.
Dietrich Maschmeier untersucht den Siebenmeierhof
Magelsen (Kr. Nienburg) an der Unterweser. Der ehe-
malige Haupthof des Stiftes Bücken wurde 1588 pri-
vatisiert und zum freien Gut. Die neuen Eigentümer
bauten den Hof in den folgenden Jahrhunderten zu
einem großen und gebäudereichen landwirtschaftli-
chen Betrieb aus, dessen Hauptgebäude aber bis in
die Mitte des 19. Jahrhunderts das im Kern noch
erhaltene, 1613 fertiggestellte Längsdielenhaus von
über 37 m Länge blieb. Es scheint den Inhabern des
Hofes auch als Dauerwohnung gedient zu haben.
Fünf weitere Beispiele dieser Bauweise aus Ostwest-
falen-Lippe stellt Heinrich Stiewe im Vergleich vor:
Alle diese Bauten wurden entsprechend regionaler
Tradition als Längsdielenhäuser mit einem Vierstän-
dergerüst errichtet, wobei drei dieser Bauten noch aus
dem 16. Jahrhunderts stammen: Das heute nicht
mehr erhaltene, 1555 errichtete Haupthaus vom Gut
Ahmsen bei Bad Salzuflen (Kr. Lippe) hatte hinter der
abgetrennten Flettküche mit hohen Luchten einen
bemerkenswerten Wohnteil, der offenbar aus zwei
übereinander befindlichen Saalkammern bestand.
Bauherr des Hauses war Johann von Exterde, Spross
einer an mehreren Orten und auch in den umliegen-
den Städten in der Grafschaft Lippe begüterten, ur-
sprünglich aus der Stadt Detmold stammenden
Familie. Die konkrete Nutzung des Hauses auf dem
Corveyer Lehnsgut durch die Familie ist bislang unklar.
Auch das 1561/63 (d) errichtete Haupthaus auf dem
Gut Dahlhausen bei Leopoldshöhe (Kr. Lippe) war ein
Lehen im selben Familienverband. Hier erhielt das
große Längsdielenhaus kein Kammerfach, sondern
wies am Ende nur eine sehr große und hohe Küche
und in einem der Seitenschiffe davor einen größeren
abgetrennten Raum auf. Stiewe vermutet, das Ge-
bäude sei trotz des reduzierten Raumprogramms den-
noch nicht nur als Wirtschaftsgebäude errichtet wor-
den, sondern auch mit einem herrschaftlichen
Wohnbereich. Das heute im Freilichtmuseum Detmold
stehende Haupthaus vom Valepagenhof bei Delbrück
(Kr. Paderborn) ließ sich 1577 der Richter und Gograf
Jost Valepage als örtlicher Vertreter des Fürstbischofs
von Paderborn auf einem freien und umgräfteten Hof
als Längsdielenhaus mit einer großen unterkellerten
Saalkammer hinter der Herdküche errichten. Auf dem
Gut Sylbach bei Bad Salzuflen (Kr. Lippe) wurde 1660
im Auftrag von Rabe von Wrede ein neues Haupthaus
als Längsdielenhaus errichtet. Allerdings ist dessen
Wohnteil nicht mehr erhalten und auch in seiner
Bedeutung als Wohnung für die Herrschaft unbe-
kannt. 1715/16 verlagerte Johann Philipp von Donop
seinen in der Stadt Blomberg (Kr. Lippe) liegenden
Burgmannshof auf ein neu arrondiertes Gelände vor
der Stadt. Er ließ sich auf diesem neuen Gut Nässen-
grund ein Gutshaus errichten, das in traditioneller
Weise als Längsdielenhaus mit angebautem Kammer-
fach ausgeführt wurde. Das Haus wurde um 1750
erheblich vergrößert, wobei der Wirtschaftsteil verlän-
gert und das Kammerfach ein Obergeschoss erhielt,
sodass der Wohnteil fortan als selbstständiges Wohn-
haus wirkte. 1755 (d) wurde zudem daneben ein
großformatiger Speicher errichtet, der wohl auch eine
Kornbrennerei aufnahm.
Vielfalt baulicher Lösungen
Seit dem 18. Jahrhundert entwickelte man die über-
kommene Bauform der Längsdielenhäuser zuneh-
mend weiter bzw. ersetzte sie auch durch andere
Bauformen mit abweichender Gestalt und Raum-
strukturen. So stellt Fred Kaspar das Gut Nachtigall
bei Paderborn vor, auf dem man 1715 für einen
Hofbeamten des Fürstbischofs ein traufenständiges
Wohn- und Wirtschaftsgebäude mit einer mittleren
Durchgangsdiele errichtete. Hiermit versuchte man
offensichtlich, das Raum- und Funktionskonzept des
überlieferten Längsdielenhauses in der Gestalt mit
den Ideen barocker Architektur in Einklang zu brin-
gen. Das Haus scheint nicht für einen dauerhaften
Aufenthalt der Eigentümer vorgesehen gewesen zu
sein und diente wohl eher als ihr Landsitz.
Um 1785 ließ der Regimentskommandeur Franz Xa-
ver von Tönnemann nördlich von Warendorf einen
neuen Landsitz mit der Bezeichnung „Tönneburg"
anlegen. Laurenz Sandmann dokumentiert die Ge-
schichte des schon seit Langem nicht mehr erhaltenen
Gutes und konnte nachweisen, dass das dortige, nur
im Sommer zeitweilig von der Herrschaft bewohnte
Hauptgebäude ein eingeschossiger Backsteinbau mit
Wohn- und Wirtschaftsräumen war.
Verbunden mit der Geschichte der Güter ist ihr steti-
ger funktionaler Wandel, wozu auch ihre spätere
Auflösung gehören konnte. Insbesondere im Laufe
des 17. und 18. Jahrhunderts wandelte man viele klei-
ne Adelssitze - inzwischen durch Heirat oder Erb-
schaft in die Hand anderswo lebender Adelsfamilien
gelangt - in landwirtschaftliche Betriebe um, die
unter der Regie eines Rentmeisters liefen oder ver-
pachtet wurden. Blieben die alten Herrenhäuser hier-
bei überhaupt erhalten, dienten sie fortan vielfach als
Einleitung
hender Bauernhöfe oder Erschließung bislang nicht
genutzter Flächen angelegt wurden. Sie hatten in
ihrer besonderen Funktion oft keine lange Existenz
und wurden später zu „normalen" Bauernhöfen. Eine
weitere Gruppe von Gütern entstand nach der Mitte
des 18. Jahrhunderts durch systematischen Landauf-
kauf, der insbesondere durch die Aufteilung der städ-
tischen Gemeinheiten möglich geworden war.
Vielfach ist nachweisbar, dass die Besitzer ihre Güter
zeitweilig bewohnten, in der Regel wohl als Sommer-
haus. Zumeist blieben Längsdielenhäuser mit unter-
schiedlich ausgeprägten Wohnteilen die Hauptge-
bäude der Güter, während separate Wohngebäude
offensichtlich nur dann entstanden, wenn die Besitzer
das Gut als dauerhaften Wohnsitz einrichteten.
Dietrich Maschmeier untersucht den Siebenmeierhof
Magelsen (Kr. Nienburg) an der Unterweser. Der ehe-
malige Haupthof des Stiftes Bücken wurde 1588 pri-
vatisiert und zum freien Gut. Die neuen Eigentümer
bauten den Hof in den folgenden Jahrhunderten zu
einem großen und gebäudereichen landwirtschaftli-
chen Betrieb aus, dessen Hauptgebäude aber bis in
die Mitte des 19. Jahrhunderts das im Kern noch
erhaltene, 1613 fertiggestellte Längsdielenhaus von
über 37 m Länge blieb. Es scheint den Inhabern des
Hofes auch als Dauerwohnung gedient zu haben.
Fünf weitere Beispiele dieser Bauweise aus Ostwest-
falen-Lippe stellt Heinrich Stiewe im Vergleich vor:
Alle diese Bauten wurden entsprechend regionaler
Tradition als Längsdielenhäuser mit einem Vierstän-
dergerüst errichtet, wobei drei dieser Bauten noch aus
dem 16. Jahrhunderts stammen: Das heute nicht
mehr erhaltene, 1555 errichtete Haupthaus vom Gut
Ahmsen bei Bad Salzuflen (Kr. Lippe) hatte hinter der
abgetrennten Flettküche mit hohen Luchten einen
bemerkenswerten Wohnteil, der offenbar aus zwei
übereinander befindlichen Saalkammern bestand.
Bauherr des Hauses war Johann von Exterde, Spross
einer an mehreren Orten und auch in den umliegen-
den Städten in der Grafschaft Lippe begüterten, ur-
sprünglich aus der Stadt Detmold stammenden
Familie. Die konkrete Nutzung des Hauses auf dem
Corveyer Lehnsgut durch die Familie ist bislang unklar.
Auch das 1561/63 (d) errichtete Haupthaus auf dem
Gut Dahlhausen bei Leopoldshöhe (Kr. Lippe) war ein
Lehen im selben Familienverband. Hier erhielt das
große Längsdielenhaus kein Kammerfach, sondern
wies am Ende nur eine sehr große und hohe Küche
und in einem der Seitenschiffe davor einen größeren
abgetrennten Raum auf. Stiewe vermutet, das Ge-
bäude sei trotz des reduzierten Raumprogramms den-
noch nicht nur als Wirtschaftsgebäude errichtet wor-
den, sondern auch mit einem herrschaftlichen
Wohnbereich. Das heute im Freilichtmuseum Detmold
stehende Haupthaus vom Valepagenhof bei Delbrück
(Kr. Paderborn) ließ sich 1577 der Richter und Gograf
Jost Valepage als örtlicher Vertreter des Fürstbischofs
von Paderborn auf einem freien und umgräfteten Hof
als Längsdielenhaus mit einer großen unterkellerten
Saalkammer hinter der Herdküche errichten. Auf dem
Gut Sylbach bei Bad Salzuflen (Kr. Lippe) wurde 1660
im Auftrag von Rabe von Wrede ein neues Haupthaus
als Längsdielenhaus errichtet. Allerdings ist dessen
Wohnteil nicht mehr erhalten und auch in seiner
Bedeutung als Wohnung für die Herrschaft unbe-
kannt. 1715/16 verlagerte Johann Philipp von Donop
seinen in der Stadt Blomberg (Kr. Lippe) liegenden
Burgmannshof auf ein neu arrondiertes Gelände vor
der Stadt. Er ließ sich auf diesem neuen Gut Nässen-
grund ein Gutshaus errichten, das in traditioneller
Weise als Längsdielenhaus mit angebautem Kammer-
fach ausgeführt wurde. Das Haus wurde um 1750
erheblich vergrößert, wobei der Wirtschaftsteil verlän-
gert und das Kammerfach ein Obergeschoss erhielt,
sodass der Wohnteil fortan als selbstständiges Wohn-
haus wirkte. 1755 (d) wurde zudem daneben ein
großformatiger Speicher errichtet, der wohl auch eine
Kornbrennerei aufnahm.
Vielfalt baulicher Lösungen
Seit dem 18. Jahrhundert entwickelte man die über-
kommene Bauform der Längsdielenhäuser zuneh-
mend weiter bzw. ersetzte sie auch durch andere
Bauformen mit abweichender Gestalt und Raum-
strukturen. So stellt Fred Kaspar das Gut Nachtigall
bei Paderborn vor, auf dem man 1715 für einen
Hofbeamten des Fürstbischofs ein traufenständiges
Wohn- und Wirtschaftsgebäude mit einer mittleren
Durchgangsdiele errichtete. Hiermit versuchte man
offensichtlich, das Raum- und Funktionskonzept des
überlieferten Längsdielenhauses in der Gestalt mit
den Ideen barocker Architektur in Einklang zu brin-
gen. Das Haus scheint nicht für einen dauerhaften
Aufenthalt der Eigentümer vorgesehen gewesen zu
sein und diente wohl eher als ihr Landsitz.
Um 1785 ließ der Regimentskommandeur Franz Xa-
ver von Tönnemann nördlich von Warendorf einen
neuen Landsitz mit der Bezeichnung „Tönneburg"
anlegen. Laurenz Sandmann dokumentiert die Ge-
schichte des schon seit Langem nicht mehr erhaltenen
Gutes und konnte nachweisen, dass das dortige, nur
im Sommer zeitweilig von der Herrschaft bewohnte
Hauptgebäude ein eingeschossiger Backsteinbau mit
Wohn- und Wirtschaftsräumen war.
Verbunden mit der Geschichte der Güter ist ihr steti-
ger funktionaler Wandel, wozu auch ihre spätere
Auflösung gehören konnte. Insbesondere im Laufe
des 17. und 18. Jahrhunderts wandelte man viele klei-
ne Adelssitze - inzwischen durch Heirat oder Erb-
schaft in die Hand anderswo lebender Adelsfamilien
gelangt - in landwirtschaftliche Betriebe um, die
unter der Regie eines Rentmeisters liefen oder ver-
pachtet wurden. Blieben die alten Herrenhäuser hier-
bei überhaupt erhalten, dienten sie fortan vielfach als