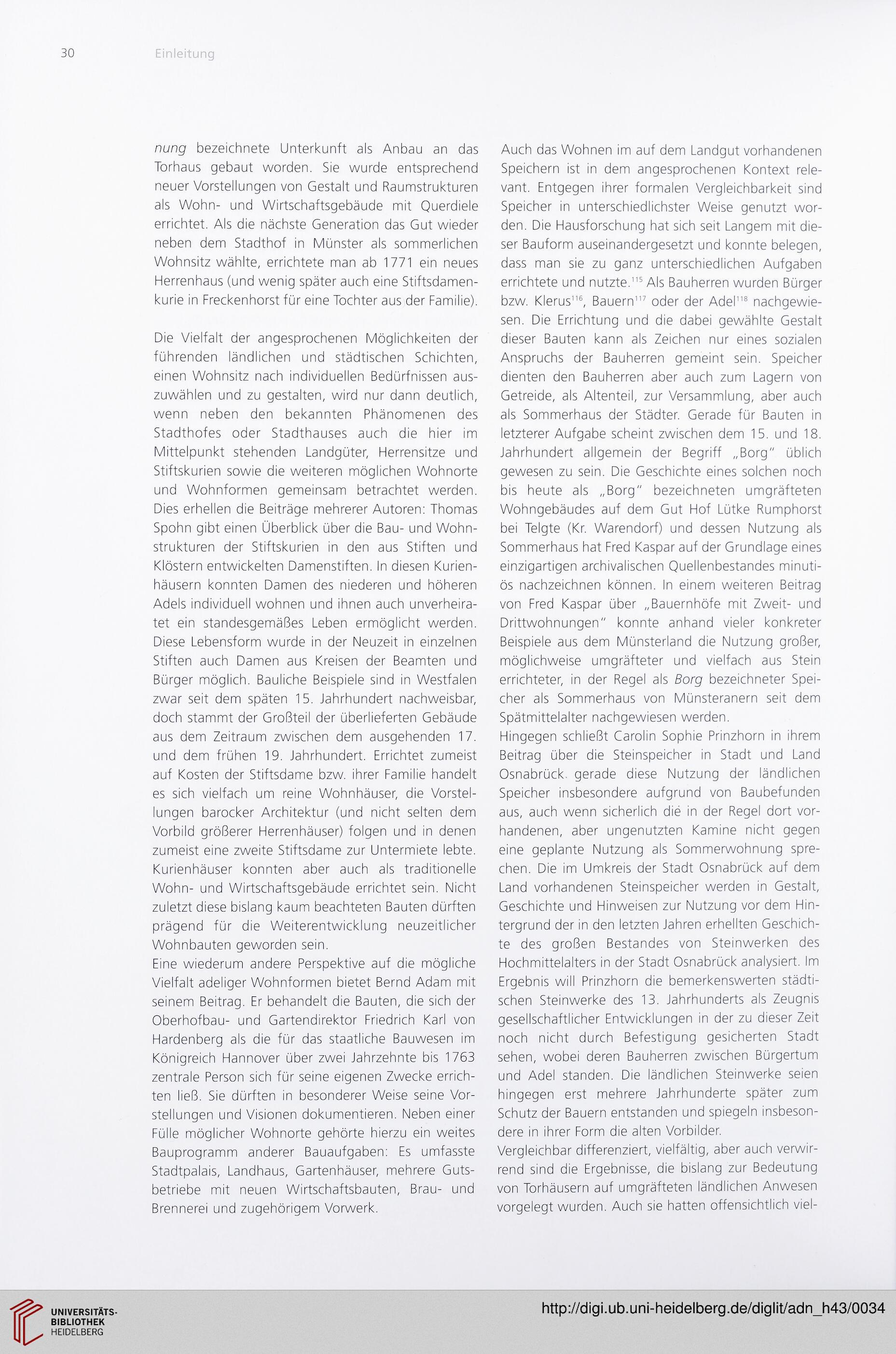30
Einleitung
nung bezeichnete Unterkunft als Anbau an das
Torhaus gebaut worden. Sie wurde entsprechend
neuer Vorstellungen von Gestalt und Raumstrukturen
als Wohn- und Wirtschaftsgebäude mit Querdiele
errichtet. Als die nächste Generation das Gut wieder
neben dem Stadthof in Münster als sommerlichen
Wohnsitz wählte, errichtete man ab 1771 ein neues
Herrenhaus (und wenig später auch eine Stiftsdamen-
kurie in Freckenhorst für eine Tochter aus der Familie).
Die Vielfalt der angesprochenen Möglichkeiten der
führenden ländlichen und städtischen Schichten,
einen Wohnsitz nach individuellen Bedürfnissen aus-
zuwählen und zu gestalten, wird nur dann deutlich,
wenn neben den bekannten Phänomenen des
Stadthofes oder Stadthauses auch die hier im
Mittelpunkt stehenden Landgüter, Herrensitze und
Stiftskurien sowie die weiteren möglichen Wohnorte
und Wohnformen gemeinsam betrachtet werden.
Dies erhellen die Beiträge mehrerer Autoren: Thomas
Spohn gibt einen Überblick über die Bau- und Wohn-
strukturen der Stiftskurien in den aus Stiften und
Klöstern entwickelten Damenstiften. In diesen Kurien-
häusern konnten Damen des niederen und höheren
Adels individuell wohnen und ihnen auch unverheira-
tet ein standesgemäßes Leben ermöglicht werden.
Diese Lebensform wurde in der Neuzeit in einzelnen
Stiften auch Damen aus Kreisen der Beamten und
Bürger möglich. Bauliche Beispiele sind in Westfalen
zwar seit dem späten 15. Jahrhundert nachweisbar,
doch stammt der Großteil der überlieferten Gebäude
aus dem Zeitraum zwischen dem ausgehenden 17.
und dem frühen 19. Jahrhundert. Errichtet zumeist
auf Kosten der Stiftsdame bzw. ihrer Familie handelt
es sich vielfach um reine Wohnhäuser, die Vorstel-
lungen barocker Architektur (und nicht selten dem
Vorbild größerer Herrenhäuser) folgen und in denen
zumeist eine zweite Stiftsdame zur Untermiete lebte.
Kurienhäuser konnten aber auch als traditionelle
Wohn- und Wirtschaftsgebäude errichtet sein. Nicht
zuletzt diese bislang kaum beachteten Bauten dürften
prägend für die Weiterentwicklung neuzeitlicher
Wohnbauten geworden sein.
Eine wiederum andere Perspektive auf die mögliche
Vielfalt adeliger Wohnformen bietet Bernd Adam mit
seinem Beitrag. Er behandelt die Bauten, die sich der
Oberhofbau- und Gartendirektor Friedrich Karl von
Hardenberg als die für das staatliche Bauwesen im
Königreich Hannover über zwei Jahrzehnte bis 1763
zentrale Person sich für seine eigenen Zwecke errich-
ten ließ. Sie dürften in besonderer Weise seine Vor-
stellungen und Visionen dokumentieren. Neben einer
Fülle möglicher Wohnorte gehörte hierzu ein weites
Bauprogramm anderer Bauaufgaben: Es umfasste
Stadtpalais, Landhaus, Gartenhäuser, mehrere Guts-
betriebe mit neuen Wirtschaftsbauten, Brau- und
Brennerei und zugehörigem Vorwerk.
Auch das Wohnen im auf dem Landgut vorhandenen
Speichern ist in dem angesprochenen Kontext rele-
vant. Entgegen ihrer formalen Vergleichbarkeit sind
Speicher in unterschiedlichster Weise genutzt wor-
den. Die Hausforschung hat sich seit Langem mit die-
ser Bauform auseinandergesetzt und konnte belegen,
dass man sie zu ganz unterschiedlichen Aufgaben
errichtete und nutzte.115 Als Bauherren wurden Bürger
bzw. Klerus116, Bauern117 oder der Adel118 nachgewie-
sen. Die Errichtung und die dabei gewählte Gestalt
dieser Bauten kann als Zeichen nur eines sozialen
Anspruchs der Bauherren gemeint sein. Speicher
dienten den Bauherren aber auch zum Lagern von
Getreide, als Altenteil, zur Versammlung, aber auch
als Sommerhaus der Städter. Gerade für Bauten in
letzterer Aufgabe scheint zwischen dem 15. und 18.
Jahrhundert allgemein der Begriff „Borg" üblich
gewesen zu sein. Die Geschichte eines solchen noch
bis heute als „Borg" bezeichneten umgräfteten
Wohngebäudes auf dem Gut Hof Lütke Rumphorst
bei Telgte (Kr. Warendorf) und dessen Nutzung als
Sommerhaus hat Fred Kaspar auf der Grundlage eines
einzigartigen archivalischen Quellenbestandes minuti-
ös nachzeichnen können. In einem weiteren Beitrag
von Fred Kaspar über „Bauernhöfe mit Zweit- und
Drittwohnungen" konnte anhand vieler konkreter
Beispiele aus dem Münsterland die Nutzung großer,
möglichweise umgräfteter und vielfach aus Stein
errichteter, in der Regel als Borg bezeichneter Spei-
cher als Sommerhaus von Münsteranern seit dem
Spätmittelalter nachgewiesen werden.
Hingegen schließt Carolin Sophie Prinzhorn in ihrem
Beitrag über die Steinspeicher in Stadt und Land
Osnabrück, gerade diese Nutzung der ländlichen
Speicher insbesondere aufgrund von Baubefunden
aus, auch wenn sicherlich die in der Regel dort vor-
handenen, aber ungenutzten Kamine nicht gegen
eine geplante Nutzung als Sommerwohnung spre-
chen. Die im Umkreis der Stadt Osnabrück auf dem
Land vorhandenen Steinspeicher werden in Gestalt,
Geschichte und Hinweisen zur Nutzung vor dem Hin-
tergrund der in den letzten Jahren erhellten Geschich-
te des großen Bestandes von Steinwerken des
Hochmittelalters in der Stadt Osnabrück analysiert. Im
Ergebnis will Prinzhorn die bemerkenswerten städti-
schen Steinwerke des 13. Jahrhunderts als Zeugnis
gesellschaftlicher Entwicklungen in der zu dieser Zeit
noch nicht durch Befestigung gesicherten Stadt
sehen, wobei deren Bauherren zwischen Bürgertum
und Adel standen. Die ländlichen Steinwerke seien
hingegen erst mehrere Jahrhunderte später zum
Schutz der Bauern entstanden und spiegeln insbeson-
dere in ihrer Form die alten Vorbilder.
Vergleichbar differenziert, vielfältig, aber auch verwir-
rend sind die Ergebnisse, die bislang zur Bedeutung
von Torhäusern auf umgräfteten ländlichen Anwesen
vorgelegt wurden. Auch sie hatten offensichtlich viel-
Einleitung
nung bezeichnete Unterkunft als Anbau an das
Torhaus gebaut worden. Sie wurde entsprechend
neuer Vorstellungen von Gestalt und Raumstrukturen
als Wohn- und Wirtschaftsgebäude mit Querdiele
errichtet. Als die nächste Generation das Gut wieder
neben dem Stadthof in Münster als sommerlichen
Wohnsitz wählte, errichtete man ab 1771 ein neues
Herrenhaus (und wenig später auch eine Stiftsdamen-
kurie in Freckenhorst für eine Tochter aus der Familie).
Die Vielfalt der angesprochenen Möglichkeiten der
führenden ländlichen und städtischen Schichten,
einen Wohnsitz nach individuellen Bedürfnissen aus-
zuwählen und zu gestalten, wird nur dann deutlich,
wenn neben den bekannten Phänomenen des
Stadthofes oder Stadthauses auch die hier im
Mittelpunkt stehenden Landgüter, Herrensitze und
Stiftskurien sowie die weiteren möglichen Wohnorte
und Wohnformen gemeinsam betrachtet werden.
Dies erhellen die Beiträge mehrerer Autoren: Thomas
Spohn gibt einen Überblick über die Bau- und Wohn-
strukturen der Stiftskurien in den aus Stiften und
Klöstern entwickelten Damenstiften. In diesen Kurien-
häusern konnten Damen des niederen und höheren
Adels individuell wohnen und ihnen auch unverheira-
tet ein standesgemäßes Leben ermöglicht werden.
Diese Lebensform wurde in der Neuzeit in einzelnen
Stiften auch Damen aus Kreisen der Beamten und
Bürger möglich. Bauliche Beispiele sind in Westfalen
zwar seit dem späten 15. Jahrhundert nachweisbar,
doch stammt der Großteil der überlieferten Gebäude
aus dem Zeitraum zwischen dem ausgehenden 17.
und dem frühen 19. Jahrhundert. Errichtet zumeist
auf Kosten der Stiftsdame bzw. ihrer Familie handelt
es sich vielfach um reine Wohnhäuser, die Vorstel-
lungen barocker Architektur (und nicht selten dem
Vorbild größerer Herrenhäuser) folgen und in denen
zumeist eine zweite Stiftsdame zur Untermiete lebte.
Kurienhäuser konnten aber auch als traditionelle
Wohn- und Wirtschaftsgebäude errichtet sein. Nicht
zuletzt diese bislang kaum beachteten Bauten dürften
prägend für die Weiterentwicklung neuzeitlicher
Wohnbauten geworden sein.
Eine wiederum andere Perspektive auf die mögliche
Vielfalt adeliger Wohnformen bietet Bernd Adam mit
seinem Beitrag. Er behandelt die Bauten, die sich der
Oberhofbau- und Gartendirektor Friedrich Karl von
Hardenberg als die für das staatliche Bauwesen im
Königreich Hannover über zwei Jahrzehnte bis 1763
zentrale Person sich für seine eigenen Zwecke errich-
ten ließ. Sie dürften in besonderer Weise seine Vor-
stellungen und Visionen dokumentieren. Neben einer
Fülle möglicher Wohnorte gehörte hierzu ein weites
Bauprogramm anderer Bauaufgaben: Es umfasste
Stadtpalais, Landhaus, Gartenhäuser, mehrere Guts-
betriebe mit neuen Wirtschaftsbauten, Brau- und
Brennerei und zugehörigem Vorwerk.
Auch das Wohnen im auf dem Landgut vorhandenen
Speichern ist in dem angesprochenen Kontext rele-
vant. Entgegen ihrer formalen Vergleichbarkeit sind
Speicher in unterschiedlichster Weise genutzt wor-
den. Die Hausforschung hat sich seit Langem mit die-
ser Bauform auseinandergesetzt und konnte belegen,
dass man sie zu ganz unterschiedlichen Aufgaben
errichtete und nutzte.115 Als Bauherren wurden Bürger
bzw. Klerus116, Bauern117 oder der Adel118 nachgewie-
sen. Die Errichtung und die dabei gewählte Gestalt
dieser Bauten kann als Zeichen nur eines sozialen
Anspruchs der Bauherren gemeint sein. Speicher
dienten den Bauherren aber auch zum Lagern von
Getreide, als Altenteil, zur Versammlung, aber auch
als Sommerhaus der Städter. Gerade für Bauten in
letzterer Aufgabe scheint zwischen dem 15. und 18.
Jahrhundert allgemein der Begriff „Borg" üblich
gewesen zu sein. Die Geschichte eines solchen noch
bis heute als „Borg" bezeichneten umgräfteten
Wohngebäudes auf dem Gut Hof Lütke Rumphorst
bei Telgte (Kr. Warendorf) und dessen Nutzung als
Sommerhaus hat Fred Kaspar auf der Grundlage eines
einzigartigen archivalischen Quellenbestandes minuti-
ös nachzeichnen können. In einem weiteren Beitrag
von Fred Kaspar über „Bauernhöfe mit Zweit- und
Drittwohnungen" konnte anhand vieler konkreter
Beispiele aus dem Münsterland die Nutzung großer,
möglichweise umgräfteter und vielfach aus Stein
errichteter, in der Regel als Borg bezeichneter Spei-
cher als Sommerhaus von Münsteranern seit dem
Spätmittelalter nachgewiesen werden.
Hingegen schließt Carolin Sophie Prinzhorn in ihrem
Beitrag über die Steinspeicher in Stadt und Land
Osnabrück, gerade diese Nutzung der ländlichen
Speicher insbesondere aufgrund von Baubefunden
aus, auch wenn sicherlich die in der Regel dort vor-
handenen, aber ungenutzten Kamine nicht gegen
eine geplante Nutzung als Sommerwohnung spre-
chen. Die im Umkreis der Stadt Osnabrück auf dem
Land vorhandenen Steinspeicher werden in Gestalt,
Geschichte und Hinweisen zur Nutzung vor dem Hin-
tergrund der in den letzten Jahren erhellten Geschich-
te des großen Bestandes von Steinwerken des
Hochmittelalters in der Stadt Osnabrück analysiert. Im
Ergebnis will Prinzhorn die bemerkenswerten städti-
schen Steinwerke des 13. Jahrhunderts als Zeugnis
gesellschaftlicher Entwicklungen in der zu dieser Zeit
noch nicht durch Befestigung gesicherten Stadt
sehen, wobei deren Bauherren zwischen Bürgertum
und Adel standen. Die ländlichen Steinwerke seien
hingegen erst mehrere Jahrhunderte später zum
Schutz der Bauern entstanden und spiegeln insbeson-
dere in ihrer Form die alten Vorbilder.
Vergleichbar differenziert, vielfältig, aber auch verwir-
rend sind die Ergebnisse, die bislang zur Bedeutung
von Torhäusern auf umgräfteten ländlichen Anwesen
vorgelegt wurden. Auch sie hatten offensichtlich viel-