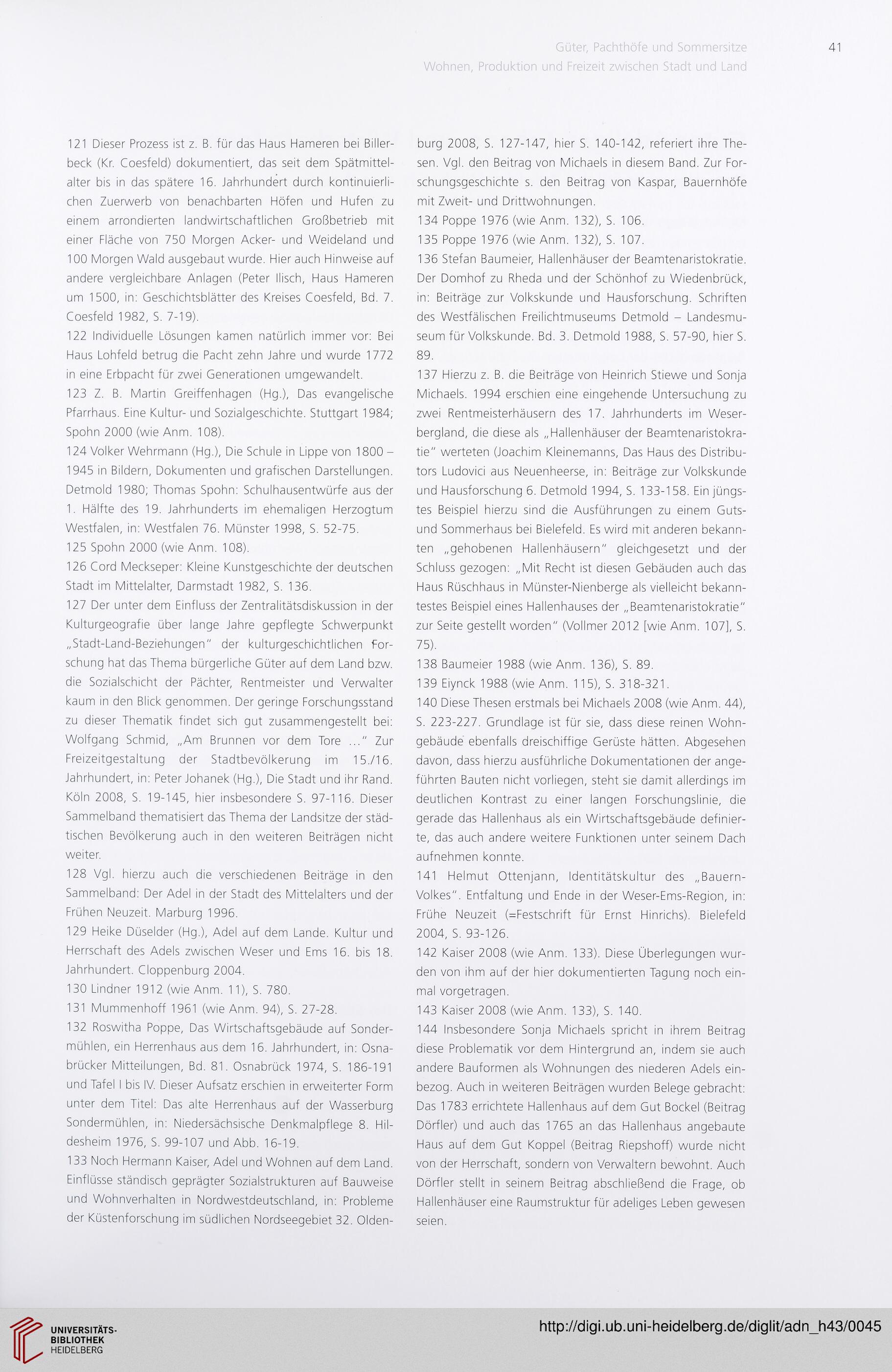Güter, Pachthöfe und Sommersitze
Wohnen, Produktion und Freizeit zwischen Stadt und Land
41
121 Dieser Prozess ist z. B. für das Haus Hameren bei Biller-
beck (Kr. Coesfeld) dokumentiert, das seit dem Spätmittel-
alter bis in das spätere 16. Jahrhundert durch kontinuierli-
chen Zuerwerb von benachbarten Höfen und Hufen zu
einem arrondierten landwirtschaftlichen Großbetrieb mit
einer Fläche von 750 Morgen Acker- und Weideland und
100 Morgen Wald ausgebaut wurde. Hier auch Hinweise auf
andere vergleichbare Anlagen (Peter llisch, Haus Hameren
um 1500, in: Geschichtsblätter des Kreises Coesfeld, Bd. 7.
Coesfeld 1982, S. 7-19).
122 Individuelle Lösungen kamen natürlich immer vor: Bei
Haus Lohfeld betrug die Pacht zehn Jahre und wurde 1772
in eine Erbpacht für zwei Generationen umgewandelt.
123 Z. B. Martin Greiffenhagen (Hg.), Das evangelische
Pfarrhaus. Eine Kultur- und Sozialgeschichte. Stuttgart 1984;
Spohn 2000 (wie Anm. 108).
124 Volker Wehrmann (Hg.), Die Schule in Lippe von 1800 -
1945 in Bildern, Dokumenten und grafischen Darstellungen.
Detmold 1980; Thomas Spohn: Schulhausentwürfe aus der
1. Hälfte des 19. Jahrhunderts im ehemaligen Herzogtum
Westfalen, in: Westfalen 76. Münster 1998, S. 52-75.
125 Spohn 2000 (wie Anm. 108).
126 Cord Meckseper: Kleine Kunstgeschichte der deutschen
Stadt im Mittelalter, Darmstadt 1982, S. 136.
127 Der unter dem Einfluss der Zentralitätsdiskussion in der
Kulturgeografie über lange Jahre gepflegte Schwerpunkt
„Stadt-Land-Beziehungen" der kulturgeschichtlichen For-
schung hat das Thema bürgerliche Güter auf dem Land bzw.
die Sozialschicht der Pächter, Rentmeister und Verwalter
kaum in den Blick genommen. Der geringe Forschungsstand
zu dieser Thematik findet sich gut zusammengestellt bei:
Wolfgang Schmid, „Am Brunnen vor dem Tore ..." Zur
Freizeitgestaltung der Stadtbevölkerung im 15./16.
Jahrhundert, in: Peter Johanek (Hg.), Die Stadt und ihr Rand.
Köln 2008, S. 19-145, hier insbesondere S. 97-116. Dieser
Sammelband thematisiert das Thema der Landsitze der städ-
tischen Bevölkerung auch in den weiteren Beiträgen nicht
weiter.
128 Vgl. hierzu auch die verschiedenen Beiträge in den
Sammelband: Der Adel in der Stadt des Mittelalters und der
Frühen Neuzeit. Marburg 1996.
129 Heike Düselder (Hg.), Adel auf dem Lande. Kultur und
Herrschaft des Adels zwischen Weser und Ems 16. bis 18.
Jahrhundert. Cloppenburg 2004.
130 Lindner 1912 (wie Anm. 11), S. 780.
131 Mummenhoff 1961 (wie Anm. 94), S. 27-28.
132 Roswitha Poppe, Das Wirtschaftsgebäude auf Sonder-
mühlen, ein Herrenhaus aus dem 16. Jahrhundert, in: Osna-
brücker Mitteilungen, Bd. 81. Osnabrück 1974, S. 186-191
und Tafel I bis IV. Dieser Aufsatz erschien in erweiterter Form
unter dem Titel: Das alte Herrenhaus auf der Wasserburg
Sondermühlen, in: Niedersächsische Denkmalpflege 8. Hil-
desheim 1976, S. 99-107 und Abb. 16-19.
133 Noch Hermann Kaiser, Adel und Wohnen auf dem Land.
Einflüsse ständisch geprägter Sozialstrukturen auf Bauweise
und Wohnverhalten in Nordwestdeutschland, in: Probleme
der Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet 32. Olden-
burg 2008, S. 127-147, hier S. 140-142, referiert ihre The-
sen. Vgl. den Beitrag von Michaels in diesem Band. Zur For-
schungsgeschichte s. den Beitrag von Kaspar, Bauernhöfe
mit Zweit- und Drittwohnungen.
134 Poppe 1976 (wie Anm. 132), S. 106.
135 Poppe 1976 (wie Anm. 132), S. 107.
136 Stefan Baumeier, Hallenhäuser der Beamtenaristokratie.
Der Domhof zu Rheda und der Schönhof zu Wiedenbrück,
in: Beiträge zur Volkskunde und Hausforschung. Schriften
des Westfälischen Freilichtmuseums Detmold - Landesmu-
seum für Volkskunde. Bd. 3. Detmold 1988, S. 57-90, hier S.
89.
137 Hierzu z. B. die Beiträge von Heinrich Stiewe und Sonja
Michaels. 1994 erschien eine eingehende Untersuchung zu
zwei Rentmeisterhäusern des 17. Jahrhunderts im Weser-
bergland, die diese als „Hallenhäuser der Beamtenaristokra-
tie" werteten (Joachim Kleinemanns, Das Haus des Distribu-
tors Ludovici aus Neuenheerse, in: Beiträge zur Volkskunde
und Hausforschung 6. Detmold 1994, S. 133-158. Ein jüngs-
tes Beispiel hierzu sind die Ausführungen zu einem Guts-
und Sommerhaus bei Bielefeld. Es wird mit anderen bekann-
ten „gehobenen Hallenhäusern" gleichgesetzt und der
Schluss gezogen: „Mit Recht ist diesen Gebäuden auch das
Haus Rüschhaus in Münster-Nienberge als vielleicht bekann-
testes Beispiel eines Hallenhauses der „Beamtenaristokratie"
zur Seite gestellt worden" (Vollmer 2012 [wie Anm. 107], S.
75).
138 Baumeier 1988 (wie Anm. 136), S. 89.
139 Eiynck 1988 (wie Anm. 115), S. 318-321.
140 Diese Thesen erstmals bei Michaels 2008 (wie Anm. 44),
S. 223-227. Grundlage ist für sie, dass diese reinen Wohn-
gebäude ebenfalls dreischiffige Gerüste hätten. Abgesehen
davon, dass hierzu ausführliche Dokumentationen der ange-
führten Bauten nicht vorliegen, steht sie damit allerdings im
deutlichen Kontrast zu einer langen Forschungslinie, die
gerade das Hallenhaus als ein Wirtschaftsgebäude definier-
te, das auch andere weitere Funktionen unter seinem Dach
aufnehmen konnte.
141 Helmut Ottenjann, Identitätskultur des „Bauern-
Volkes". Entfaltung und Ende in der Weser-Ems-Region, in:
Frühe Neuzeit (=Festschrift für Ernst Hinrichs). Bielefeld
2004, S. 93-126.
142 Kaiser 2008 (wie Anm. 133). Diese Überlegungen wur-
den von ihm auf der hier dokumentierten Tagung noch ein-
mal vorgetragen.
143 Kaiser 2008 (wie Anm. 133), S. 140.
144 Insbesondere Sonja Michaels spricht in ihrem Beitrag
diese Problematik vor dem Hintergrund an, indem sie auch
andere Bauformen als Wohnungen des niederen Adels ein-
bezog. Auch in weiteren Beiträgen wurden Belege gebracht:
Das 1783 errichtete Hallenhaus auf dem Gut Bockei (Beitrag
Dörfler) und auch das 1765 an das Hallenhaus angebaute
Haus auf dem Gut Koppel (Beitrag Riepshoff) wurde nicht
von der Herrschaft, sondern von Verwaltern bewohnt. Auch
Dörfler stellt in seinem Beitrag abschließend die Frage, ob
Hallenhäuser eine Raumstruktur für adeliges Leben gewesen
seien.
Wohnen, Produktion und Freizeit zwischen Stadt und Land
41
121 Dieser Prozess ist z. B. für das Haus Hameren bei Biller-
beck (Kr. Coesfeld) dokumentiert, das seit dem Spätmittel-
alter bis in das spätere 16. Jahrhundert durch kontinuierli-
chen Zuerwerb von benachbarten Höfen und Hufen zu
einem arrondierten landwirtschaftlichen Großbetrieb mit
einer Fläche von 750 Morgen Acker- und Weideland und
100 Morgen Wald ausgebaut wurde. Hier auch Hinweise auf
andere vergleichbare Anlagen (Peter llisch, Haus Hameren
um 1500, in: Geschichtsblätter des Kreises Coesfeld, Bd. 7.
Coesfeld 1982, S. 7-19).
122 Individuelle Lösungen kamen natürlich immer vor: Bei
Haus Lohfeld betrug die Pacht zehn Jahre und wurde 1772
in eine Erbpacht für zwei Generationen umgewandelt.
123 Z. B. Martin Greiffenhagen (Hg.), Das evangelische
Pfarrhaus. Eine Kultur- und Sozialgeschichte. Stuttgart 1984;
Spohn 2000 (wie Anm. 108).
124 Volker Wehrmann (Hg.), Die Schule in Lippe von 1800 -
1945 in Bildern, Dokumenten und grafischen Darstellungen.
Detmold 1980; Thomas Spohn: Schulhausentwürfe aus der
1. Hälfte des 19. Jahrhunderts im ehemaligen Herzogtum
Westfalen, in: Westfalen 76. Münster 1998, S. 52-75.
125 Spohn 2000 (wie Anm. 108).
126 Cord Meckseper: Kleine Kunstgeschichte der deutschen
Stadt im Mittelalter, Darmstadt 1982, S. 136.
127 Der unter dem Einfluss der Zentralitätsdiskussion in der
Kulturgeografie über lange Jahre gepflegte Schwerpunkt
„Stadt-Land-Beziehungen" der kulturgeschichtlichen For-
schung hat das Thema bürgerliche Güter auf dem Land bzw.
die Sozialschicht der Pächter, Rentmeister und Verwalter
kaum in den Blick genommen. Der geringe Forschungsstand
zu dieser Thematik findet sich gut zusammengestellt bei:
Wolfgang Schmid, „Am Brunnen vor dem Tore ..." Zur
Freizeitgestaltung der Stadtbevölkerung im 15./16.
Jahrhundert, in: Peter Johanek (Hg.), Die Stadt und ihr Rand.
Köln 2008, S. 19-145, hier insbesondere S. 97-116. Dieser
Sammelband thematisiert das Thema der Landsitze der städ-
tischen Bevölkerung auch in den weiteren Beiträgen nicht
weiter.
128 Vgl. hierzu auch die verschiedenen Beiträge in den
Sammelband: Der Adel in der Stadt des Mittelalters und der
Frühen Neuzeit. Marburg 1996.
129 Heike Düselder (Hg.), Adel auf dem Lande. Kultur und
Herrschaft des Adels zwischen Weser und Ems 16. bis 18.
Jahrhundert. Cloppenburg 2004.
130 Lindner 1912 (wie Anm. 11), S. 780.
131 Mummenhoff 1961 (wie Anm. 94), S. 27-28.
132 Roswitha Poppe, Das Wirtschaftsgebäude auf Sonder-
mühlen, ein Herrenhaus aus dem 16. Jahrhundert, in: Osna-
brücker Mitteilungen, Bd. 81. Osnabrück 1974, S. 186-191
und Tafel I bis IV. Dieser Aufsatz erschien in erweiterter Form
unter dem Titel: Das alte Herrenhaus auf der Wasserburg
Sondermühlen, in: Niedersächsische Denkmalpflege 8. Hil-
desheim 1976, S. 99-107 und Abb. 16-19.
133 Noch Hermann Kaiser, Adel und Wohnen auf dem Land.
Einflüsse ständisch geprägter Sozialstrukturen auf Bauweise
und Wohnverhalten in Nordwestdeutschland, in: Probleme
der Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet 32. Olden-
burg 2008, S. 127-147, hier S. 140-142, referiert ihre The-
sen. Vgl. den Beitrag von Michaels in diesem Band. Zur For-
schungsgeschichte s. den Beitrag von Kaspar, Bauernhöfe
mit Zweit- und Drittwohnungen.
134 Poppe 1976 (wie Anm. 132), S. 106.
135 Poppe 1976 (wie Anm. 132), S. 107.
136 Stefan Baumeier, Hallenhäuser der Beamtenaristokratie.
Der Domhof zu Rheda und der Schönhof zu Wiedenbrück,
in: Beiträge zur Volkskunde und Hausforschung. Schriften
des Westfälischen Freilichtmuseums Detmold - Landesmu-
seum für Volkskunde. Bd. 3. Detmold 1988, S. 57-90, hier S.
89.
137 Hierzu z. B. die Beiträge von Heinrich Stiewe und Sonja
Michaels. 1994 erschien eine eingehende Untersuchung zu
zwei Rentmeisterhäusern des 17. Jahrhunderts im Weser-
bergland, die diese als „Hallenhäuser der Beamtenaristokra-
tie" werteten (Joachim Kleinemanns, Das Haus des Distribu-
tors Ludovici aus Neuenheerse, in: Beiträge zur Volkskunde
und Hausforschung 6. Detmold 1994, S. 133-158. Ein jüngs-
tes Beispiel hierzu sind die Ausführungen zu einem Guts-
und Sommerhaus bei Bielefeld. Es wird mit anderen bekann-
ten „gehobenen Hallenhäusern" gleichgesetzt und der
Schluss gezogen: „Mit Recht ist diesen Gebäuden auch das
Haus Rüschhaus in Münster-Nienberge als vielleicht bekann-
testes Beispiel eines Hallenhauses der „Beamtenaristokratie"
zur Seite gestellt worden" (Vollmer 2012 [wie Anm. 107], S.
75).
138 Baumeier 1988 (wie Anm. 136), S. 89.
139 Eiynck 1988 (wie Anm. 115), S. 318-321.
140 Diese Thesen erstmals bei Michaels 2008 (wie Anm. 44),
S. 223-227. Grundlage ist für sie, dass diese reinen Wohn-
gebäude ebenfalls dreischiffige Gerüste hätten. Abgesehen
davon, dass hierzu ausführliche Dokumentationen der ange-
führten Bauten nicht vorliegen, steht sie damit allerdings im
deutlichen Kontrast zu einer langen Forschungslinie, die
gerade das Hallenhaus als ein Wirtschaftsgebäude definier-
te, das auch andere weitere Funktionen unter seinem Dach
aufnehmen konnte.
141 Helmut Ottenjann, Identitätskultur des „Bauern-
Volkes". Entfaltung und Ende in der Weser-Ems-Region, in:
Frühe Neuzeit (=Festschrift für Ernst Hinrichs). Bielefeld
2004, S. 93-126.
142 Kaiser 2008 (wie Anm. 133). Diese Überlegungen wur-
den von ihm auf der hier dokumentierten Tagung noch ein-
mal vorgetragen.
143 Kaiser 2008 (wie Anm. 133), S. 140.
144 Insbesondere Sonja Michaels spricht in ihrem Beitrag
diese Problematik vor dem Hintergrund an, indem sie auch
andere Bauformen als Wohnungen des niederen Adels ein-
bezog. Auch in weiteren Beiträgen wurden Belege gebracht:
Das 1783 errichtete Hallenhaus auf dem Gut Bockei (Beitrag
Dörfler) und auch das 1765 an das Hallenhaus angebaute
Haus auf dem Gut Koppel (Beitrag Riepshoff) wurde nicht
von der Herrschaft, sondern von Verwaltern bewohnt. Auch
Dörfler stellt in seinem Beitrag abschließend die Frage, ob
Hallenhäuser eine Raumstruktur für adeliges Leben gewesen
seien.