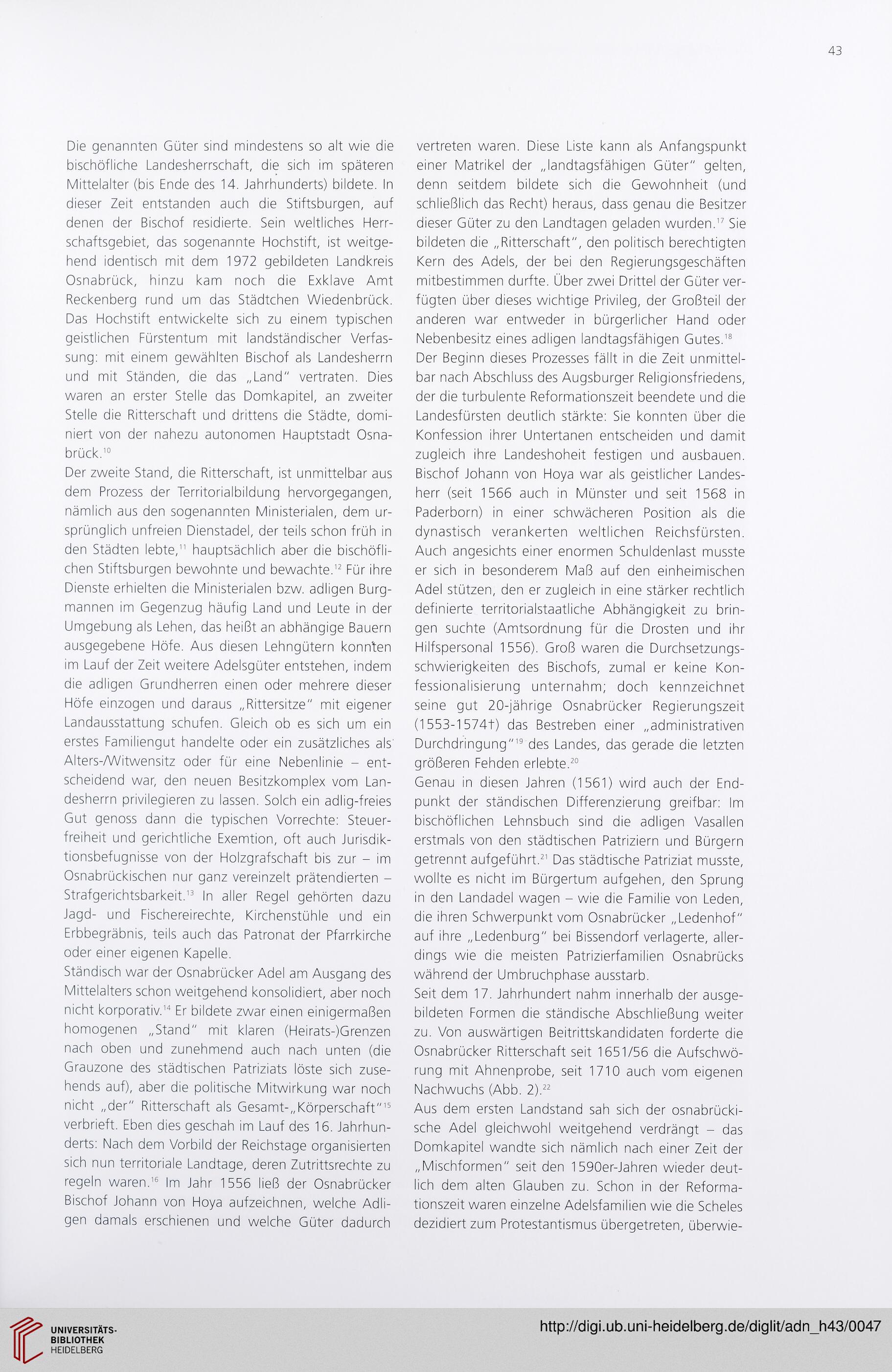43
Die genannten Güter sind mindestens so alt wie die
bischöfliche Landesherrschaft, die sich im späteren
Mittelalter (bis Ende des 14. Jahrhunderts) bildete. In
dieser Zeit entstanden auch die Stiftsburgen, auf
denen der Bischof residierte. Sein weltliches Herr-
schaftsgebiet, das sogenannte Hochstift, ist weitge-
hend identisch mit dem 1972 gebildeten Landkreis
Osnabrück, hinzu kam noch die Exklave Amt
Reckenberg rund um das Städtchen Wiedenbrück.
Das Hochstift entwickelte sich zu einem typischen
geistlichen Fürstentum mit landständischer Verfas-
sung: mit einem gewählten Bischof als Landesherrn
und mit Ständen, die das „Land" vertraten. Dies
waren an erster Stelle das Domkapitel, an zweiter
Stelle die Ritterschaft und drittens die Städte, domi-
niert von der nahezu autonomen Hauptstadt Osna-
brück.10
Der zweite Stand, die Ritterschaft, ist unmittelbar aus
dem Prozess der Territorialbildung hervorgegangen,
nämlich aus den sogenannten Ministerialen, dem ur-
sprünglich unfreien Dienstadel, der teils schon früh in
den Städten lebte,11 hauptsächlich aber die bischöfli-
chen Stiftsburgen bewohnte und bewachte.12 Für ihre
Dienste erhielten die Ministerialen bzw. adligen Burg-
mannen im Gegenzug häufig Land und Leute in der
Umgebung als Lehen, das heißt an abhängige Bauern
ausgegebene Höfe. Aus diesen Lehngütern konnten
im Lauf der Zeit weitere Adelsgüter entstehen, indem
die adligen Grundherren einen oder mehrere dieser
Höfe einzogen und daraus „Rittersitze" mit eigener
Landausstattung schufen. Gleich ob es sich um ein
erstes Familiengut handelte oder ein zusätzliches als
AltersVWitwensitz oder für eine Nebenlinie - ent-
scheidend war, den neuen Besitzkomplex vom Lan-
desherrn privilegieren zu lassen. Solch ein adlig-freies
Gut genoss dann die typischen Vorrechte: Steuer-
freiheit und gerichtliche Exemtion, oft auch Jurisdik-
tionsbefugnisse von der Holzgrafschaft bis zur - im
Osnabrückischen nur ganz vereinzelt prätendierten -
Strafgerichtsbarkeit.13 In aller Regel gehörten dazu
Jagd- und Fischereirechte, Kirchenstühle und ein
Erbbegräbnis, teils auch das Patronat der Pfarrkirche
oder einer eigenen Kapelle.
Ständisch war der Osnabrücker Adel am Ausgang des
Mittelalters schon weitgehend konsolidiert, aber noch
nicht korporativ.14 Er bildete zwar einen einigermaßen
homogenen „Stand" mit klaren (Heirats-)Grenzen
nach oben und zunehmend auch nach unten (die
Grauzone des städtischen Patriziats löste sich zuse-
hends auf), aber die politische Mitwirkung war noch
nicht „der" Ritterschaft als Gesamt-,,Körperschaft"15
verbrieft. Eben dies geschah im Lauf des 16. Jahrhun-
derts: Nach dem Vorbild der Reichstage organisierten
sich nun territoriale Landtage, deren Zutrittsrechte zu
regeln waren.16 Im Jahr 1556 ließ der Osnabrücker
Bischof Johann von Hoya aufzeichnen, welche Adli-
gen damals erschienen und welche Güter dadurch
vertreten waren. Diese Liste kann als Anfangspunkt
einer Matrikel der „landtagsfähigen Güter" gelten,
denn seitdem bildete sich die Gewohnheit (und
schließlich das Recht) heraus, dass genau die Besitzer
dieser Güter zu den Landtagen geladen wurden.17 Sie
bildeten die „Ritterschaft", den politisch berechtigten
Kern des Adels, der bei den Regierungsgeschäften
mitbestimmen durfte. Über zwei Drittel der Güter ver-
fügten über dieses wichtige Privileg, der Großteil der
anderen war entweder in bürgerlicher Hand oder
Nebenbesitz eines adligen landtagsfähigen Gutes.18
Der Beginn dieses Prozesses fällt in die Zeit unmittel-
bar nach Abschluss des Augsburger Religionsfriedens,
der die turbulente Reformationszeit beendete und die
Landesfürsten deutlich stärkte: Sie konnten über die
Konfession ihrer Untertanen entscheiden und damit
zugleich ihre Landeshoheit festigen und ausbauen.
Bischof Johann von Hoya war als geistlicher Landes-
herr (seit 1566 auch in Münster und seit 1568 in
Paderborn) in einer schwächeren Position als die
dynastisch verankerten weltlichen Reichsfürsten.
Auch angesichts einer enormen Schuldenlast musste
er sich in besonderem Maß auf den einheimischen
Adel stützen, den er zugleich in eine stärker rechtlich
definierte territorialstaatliche Abhängigkeit zu brin-
gen suchte (Amtsordnung für die Drosten und ihr
Hilfspersonal 1556). Groß waren die Durchsetzungs-
schwierigkeiten des Bischofs, zumal er keine Kon-
fessionalisierung unternahm; doch kennzeichnet
seine gut 20-jährige Osnabrücker Regierungszeit
(1553-1574t) das Bestreben einer „administrativen
Durchdringung"19 des Landes, das gerade die letzten
größeren Fehden erlebte.20
Genau in diesen Jahren (1561) wird auch der End-
punkt der ständischen Differenzierung greifbar: Im
bischöflichen Lehnsbuch sind die adligen Vasallen
erstmals von den städtischen Patriziern und Bürgern
getrennt aufgeführt.21 Das städtische Patriziat musste,
wollte es nicht im Bürgertum aufgehen, den Sprung
in den Landadel wagen - wie die Familie von Leden,
die ihren Schwerpunkt vom Osnabrücker „Ledenhof"
auf ihre „Ledenburg" bei Bissendorf verlagerte, aller-
dings wie die meisten Patrizierfamilien Osnabrücks
während der Umbruchphase ausstarb.
Seit dem 17. Jahrhundert nahm innerhalb der ausge-
bildeten Formen die ständische Abschließung weiter
zu. Von auswärtigen Beitrittskandidaten forderte die
Osnabrücker Ritterschaft seit 1651/56 die Aufschwö-
rung mit Ahnenprobe, seit 1710 auch vom eigenen
Nachwuchs (Abb. 2).22
Aus dem ersten Landstand sah sich der osnabrücki-
sche Adel gleichwohl weitgehend verdrängt - das
Domkapitel wandte sich nämlich nach einer Zeit der
„Mischformen" seit den 1590er-Jahren wieder deut-
lich dem alten Glauben zu. Schon in der Reforma-
tionszeit waren einzelne Adelsfamilien wie die Scheies
dezidiert zum Protestantismus übergetreten, überwie-
Die genannten Güter sind mindestens so alt wie die
bischöfliche Landesherrschaft, die sich im späteren
Mittelalter (bis Ende des 14. Jahrhunderts) bildete. In
dieser Zeit entstanden auch die Stiftsburgen, auf
denen der Bischof residierte. Sein weltliches Herr-
schaftsgebiet, das sogenannte Hochstift, ist weitge-
hend identisch mit dem 1972 gebildeten Landkreis
Osnabrück, hinzu kam noch die Exklave Amt
Reckenberg rund um das Städtchen Wiedenbrück.
Das Hochstift entwickelte sich zu einem typischen
geistlichen Fürstentum mit landständischer Verfas-
sung: mit einem gewählten Bischof als Landesherrn
und mit Ständen, die das „Land" vertraten. Dies
waren an erster Stelle das Domkapitel, an zweiter
Stelle die Ritterschaft und drittens die Städte, domi-
niert von der nahezu autonomen Hauptstadt Osna-
brück.10
Der zweite Stand, die Ritterschaft, ist unmittelbar aus
dem Prozess der Territorialbildung hervorgegangen,
nämlich aus den sogenannten Ministerialen, dem ur-
sprünglich unfreien Dienstadel, der teils schon früh in
den Städten lebte,11 hauptsächlich aber die bischöfli-
chen Stiftsburgen bewohnte und bewachte.12 Für ihre
Dienste erhielten die Ministerialen bzw. adligen Burg-
mannen im Gegenzug häufig Land und Leute in der
Umgebung als Lehen, das heißt an abhängige Bauern
ausgegebene Höfe. Aus diesen Lehngütern konnten
im Lauf der Zeit weitere Adelsgüter entstehen, indem
die adligen Grundherren einen oder mehrere dieser
Höfe einzogen und daraus „Rittersitze" mit eigener
Landausstattung schufen. Gleich ob es sich um ein
erstes Familiengut handelte oder ein zusätzliches als
AltersVWitwensitz oder für eine Nebenlinie - ent-
scheidend war, den neuen Besitzkomplex vom Lan-
desherrn privilegieren zu lassen. Solch ein adlig-freies
Gut genoss dann die typischen Vorrechte: Steuer-
freiheit und gerichtliche Exemtion, oft auch Jurisdik-
tionsbefugnisse von der Holzgrafschaft bis zur - im
Osnabrückischen nur ganz vereinzelt prätendierten -
Strafgerichtsbarkeit.13 In aller Regel gehörten dazu
Jagd- und Fischereirechte, Kirchenstühle und ein
Erbbegräbnis, teils auch das Patronat der Pfarrkirche
oder einer eigenen Kapelle.
Ständisch war der Osnabrücker Adel am Ausgang des
Mittelalters schon weitgehend konsolidiert, aber noch
nicht korporativ.14 Er bildete zwar einen einigermaßen
homogenen „Stand" mit klaren (Heirats-)Grenzen
nach oben und zunehmend auch nach unten (die
Grauzone des städtischen Patriziats löste sich zuse-
hends auf), aber die politische Mitwirkung war noch
nicht „der" Ritterschaft als Gesamt-,,Körperschaft"15
verbrieft. Eben dies geschah im Lauf des 16. Jahrhun-
derts: Nach dem Vorbild der Reichstage organisierten
sich nun territoriale Landtage, deren Zutrittsrechte zu
regeln waren.16 Im Jahr 1556 ließ der Osnabrücker
Bischof Johann von Hoya aufzeichnen, welche Adli-
gen damals erschienen und welche Güter dadurch
vertreten waren. Diese Liste kann als Anfangspunkt
einer Matrikel der „landtagsfähigen Güter" gelten,
denn seitdem bildete sich die Gewohnheit (und
schließlich das Recht) heraus, dass genau die Besitzer
dieser Güter zu den Landtagen geladen wurden.17 Sie
bildeten die „Ritterschaft", den politisch berechtigten
Kern des Adels, der bei den Regierungsgeschäften
mitbestimmen durfte. Über zwei Drittel der Güter ver-
fügten über dieses wichtige Privileg, der Großteil der
anderen war entweder in bürgerlicher Hand oder
Nebenbesitz eines adligen landtagsfähigen Gutes.18
Der Beginn dieses Prozesses fällt in die Zeit unmittel-
bar nach Abschluss des Augsburger Religionsfriedens,
der die turbulente Reformationszeit beendete und die
Landesfürsten deutlich stärkte: Sie konnten über die
Konfession ihrer Untertanen entscheiden und damit
zugleich ihre Landeshoheit festigen und ausbauen.
Bischof Johann von Hoya war als geistlicher Landes-
herr (seit 1566 auch in Münster und seit 1568 in
Paderborn) in einer schwächeren Position als die
dynastisch verankerten weltlichen Reichsfürsten.
Auch angesichts einer enormen Schuldenlast musste
er sich in besonderem Maß auf den einheimischen
Adel stützen, den er zugleich in eine stärker rechtlich
definierte territorialstaatliche Abhängigkeit zu brin-
gen suchte (Amtsordnung für die Drosten und ihr
Hilfspersonal 1556). Groß waren die Durchsetzungs-
schwierigkeiten des Bischofs, zumal er keine Kon-
fessionalisierung unternahm; doch kennzeichnet
seine gut 20-jährige Osnabrücker Regierungszeit
(1553-1574t) das Bestreben einer „administrativen
Durchdringung"19 des Landes, das gerade die letzten
größeren Fehden erlebte.20
Genau in diesen Jahren (1561) wird auch der End-
punkt der ständischen Differenzierung greifbar: Im
bischöflichen Lehnsbuch sind die adligen Vasallen
erstmals von den städtischen Patriziern und Bürgern
getrennt aufgeführt.21 Das städtische Patriziat musste,
wollte es nicht im Bürgertum aufgehen, den Sprung
in den Landadel wagen - wie die Familie von Leden,
die ihren Schwerpunkt vom Osnabrücker „Ledenhof"
auf ihre „Ledenburg" bei Bissendorf verlagerte, aller-
dings wie die meisten Patrizierfamilien Osnabrücks
während der Umbruchphase ausstarb.
Seit dem 17. Jahrhundert nahm innerhalb der ausge-
bildeten Formen die ständische Abschließung weiter
zu. Von auswärtigen Beitrittskandidaten forderte die
Osnabrücker Ritterschaft seit 1651/56 die Aufschwö-
rung mit Ahnenprobe, seit 1710 auch vom eigenen
Nachwuchs (Abb. 2).22
Aus dem ersten Landstand sah sich der osnabrücki-
sche Adel gleichwohl weitgehend verdrängt - das
Domkapitel wandte sich nämlich nach einer Zeit der
„Mischformen" seit den 1590er-Jahren wieder deut-
lich dem alten Glauben zu. Schon in der Reforma-
tionszeit waren einzelne Adelsfamilien wie die Scheies
dezidiert zum Protestantismus übergetreten, überwie-