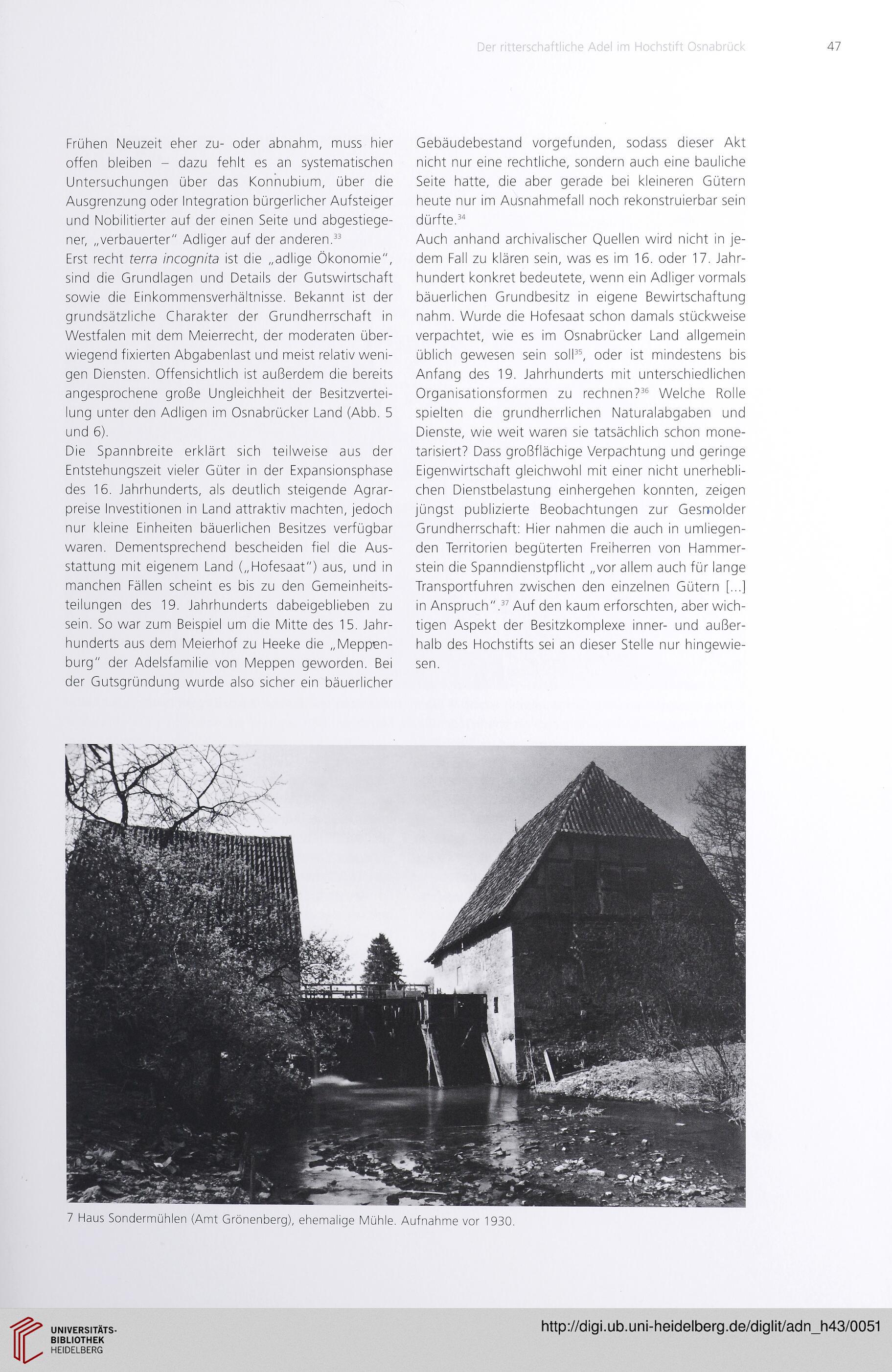Der ritterschaftliche Adel im Hochstift Osnabrück
47
Frühen Neuzeit eher zu- oder abnahm, muss hier
offen bleiben - dazu fehlt es an systematischen
Untersuchungen über das Konnubium, über die
Ausgrenzung oder Integration bürgerlicher Aufsteiger
und Nobilitierter auf der einen Seite und abgestiege-
ner, „verbauerter" Adliger auf der anderen.33
Erst recht terra incognita ist die „adlige Ökonomie",
sind die Grundlagen und Details der Gutswirtschaft
sowie die Einkommensverhältnisse. Bekannt ist der
grundsätzliche Charakter der Grundherrschaft in
Westfalen mit dem Meierrecht, der moderaten über-
wiegend fixierten Abgabenlast und meist relativ weni-
gen Diensten. Offensichtlich ist außerdem die bereits
angesprochene große Ungleichheit der Besitzvertei-
lung unter den Adligen im Osnabrücker Land (Abb. 5
und 6).
Die Spannbreite erklärt sich teilweise aus der
Entstehungszeit vieler Güter in der Expansionsphase
des 16. Jahrhunderts, als deutlich steigende Agrar-
preise Investitionen in Land attraktiv machten, jedoch
nur kleine Einheiten bäuerlichen Besitzes verfügbar
waren. Dementsprechend bescheiden fiel die Aus-
stattung mit eigenem Land („Hofesaat") aus, und in
manchen Fällen scheint es bis zu den Gemeinheits-
teilungen des 19. Jahrhunderts dabeigeblieben zu
sein. So war zum Beispiel um die Mitte des 15. Jahr-
hunderts aus dem Meierhof zu Heeke die „Meppen-
burg" der Adelsfamilie von Meppen geworden. Bei
der Gutsgründung wurde also sicher ein bäuerlicher
Gebäudebestand vorgefunden, sodass dieser Akt
nicht nur eine rechtliche, sondern auch eine bauliche
Seite hatte, die aber gerade bei kleineren Gütern
heute nur im Ausnahmefall noch rekonstruierbar sein
dürfte.34
Auch anhand archivalischer Quellen wird nicht in je-
dem Fall zu klären sein, was es im 16. oder 17. Jahr-
hundert konkret bedeutete, wenn ein Adliger vormals
bäuerlichen Grundbesitz in eigene Bewirtschaftung
nahm. Wurde die Hofesaat schon damals stückweise
verpachtet, wie es im Osnabrücker Land allgemein
üblich gewesen sein soll35, oder ist mindestens bis
Anfang des 19. Jahrhunderts mit unterschiedlichen
Organisationsformen zu rechnen?36 Welche Rolle
spielten die grundherrlichen Naturalabgaben und
Dienste, wie weit waren sie tatsächlich schon mone-
tarisiert? Dass großflächige Verpachtung und geringe
Eigenwirtschaft gleichwohl mit einer nicht unerhebli-
chen Dienstbelastung einhergehen konnten, zeigen
jüngst publizierte Beobachtungen zur Gesmolder
Grundherrschaft: Hier nahmen die auch in umliegen-
den Territorien begüterten Freiherren von Hammer-
stein die Spanndienstpflicht „vor allem auch für lange
Transportfuhren zwischen den einzelnen Gütern [...]
in Anspruch".37 Auf den kaum erforschten, aber wich-
tigen Aspekt der Besitzkomplexe inner- und außer-
halb des Hochstifts sei an dieser Stelle nur hingewie-
sen.
7 Haus Sondermühlen (Amt Gronenberg), ehemalige Mühle. Aufnahme vor 1930.
47
Frühen Neuzeit eher zu- oder abnahm, muss hier
offen bleiben - dazu fehlt es an systematischen
Untersuchungen über das Konnubium, über die
Ausgrenzung oder Integration bürgerlicher Aufsteiger
und Nobilitierter auf der einen Seite und abgestiege-
ner, „verbauerter" Adliger auf der anderen.33
Erst recht terra incognita ist die „adlige Ökonomie",
sind die Grundlagen und Details der Gutswirtschaft
sowie die Einkommensverhältnisse. Bekannt ist der
grundsätzliche Charakter der Grundherrschaft in
Westfalen mit dem Meierrecht, der moderaten über-
wiegend fixierten Abgabenlast und meist relativ weni-
gen Diensten. Offensichtlich ist außerdem die bereits
angesprochene große Ungleichheit der Besitzvertei-
lung unter den Adligen im Osnabrücker Land (Abb. 5
und 6).
Die Spannbreite erklärt sich teilweise aus der
Entstehungszeit vieler Güter in der Expansionsphase
des 16. Jahrhunderts, als deutlich steigende Agrar-
preise Investitionen in Land attraktiv machten, jedoch
nur kleine Einheiten bäuerlichen Besitzes verfügbar
waren. Dementsprechend bescheiden fiel die Aus-
stattung mit eigenem Land („Hofesaat") aus, und in
manchen Fällen scheint es bis zu den Gemeinheits-
teilungen des 19. Jahrhunderts dabeigeblieben zu
sein. So war zum Beispiel um die Mitte des 15. Jahr-
hunderts aus dem Meierhof zu Heeke die „Meppen-
burg" der Adelsfamilie von Meppen geworden. Bei
der Gutsgründung wurde also sicher ein bäuerlicher
Gebäudebestand vorgefunden, sodass dieser Akt
nicht nur eine rechtliche, sondern auch eine bauliche
Seite hatte, die aber gerade bei kleineren Gütern
heute nur im Ausnahmefall noch rekonstruierbar sein
dürfte.34
Auch anhand archivalischer Quellen wird nicht in je-
dem Fall zu klären sein, was es im 16. oder 17. Jahr-
hundert konkret bedeutete, wenn ein Adliger vormals
bäuerlichen Grundbesitz in eigene Bewirtschaftung
nahm. Wurde die Hofesaat schon damals stückweise
verpachtet, wie es im Osnabrücker Land allgemein
üblich gewesen sein soll35, oder ist mindestens bis
Anfang des 19. Jahrhunderts mit unterschiedlichen
Organisationsformen zu rechnen?36 Welche Rolle
spielten die grundherrlichen Naturalabgaben und
Dienste, wie weit waren sie tatsächlich schon mone-
tarisiert? Dass großflächige Verpachtung und geringe
Eigenwirtschaft gleichwohl mit einer nicht unerhebli-
chen Dienstbelastung einhergehen konnten, zeigen
jüngst publizierte Beobachtungen zur Gesmolder
Grundherrschaft: Hier nahmen die auch in umliegen-
den Territorien begüterten Freiherren von Hammer-
stein die Spanndienstpflicht „vor allem auch für lange
Transportfuhren zwischen den einzelnen Gütern [...]
in Anspruch".37 Auf den kaum erforschten, aber wich-
tigen Aspekt der Besitzkomplexe inner- und außer-
halb des Hochstifts sei an dieser Stelle nur hingewie-
sen.
7 Haus Sondermühlen (Amt Gronenberg), ehemalige Mühle. Aufnahme vor 1930.