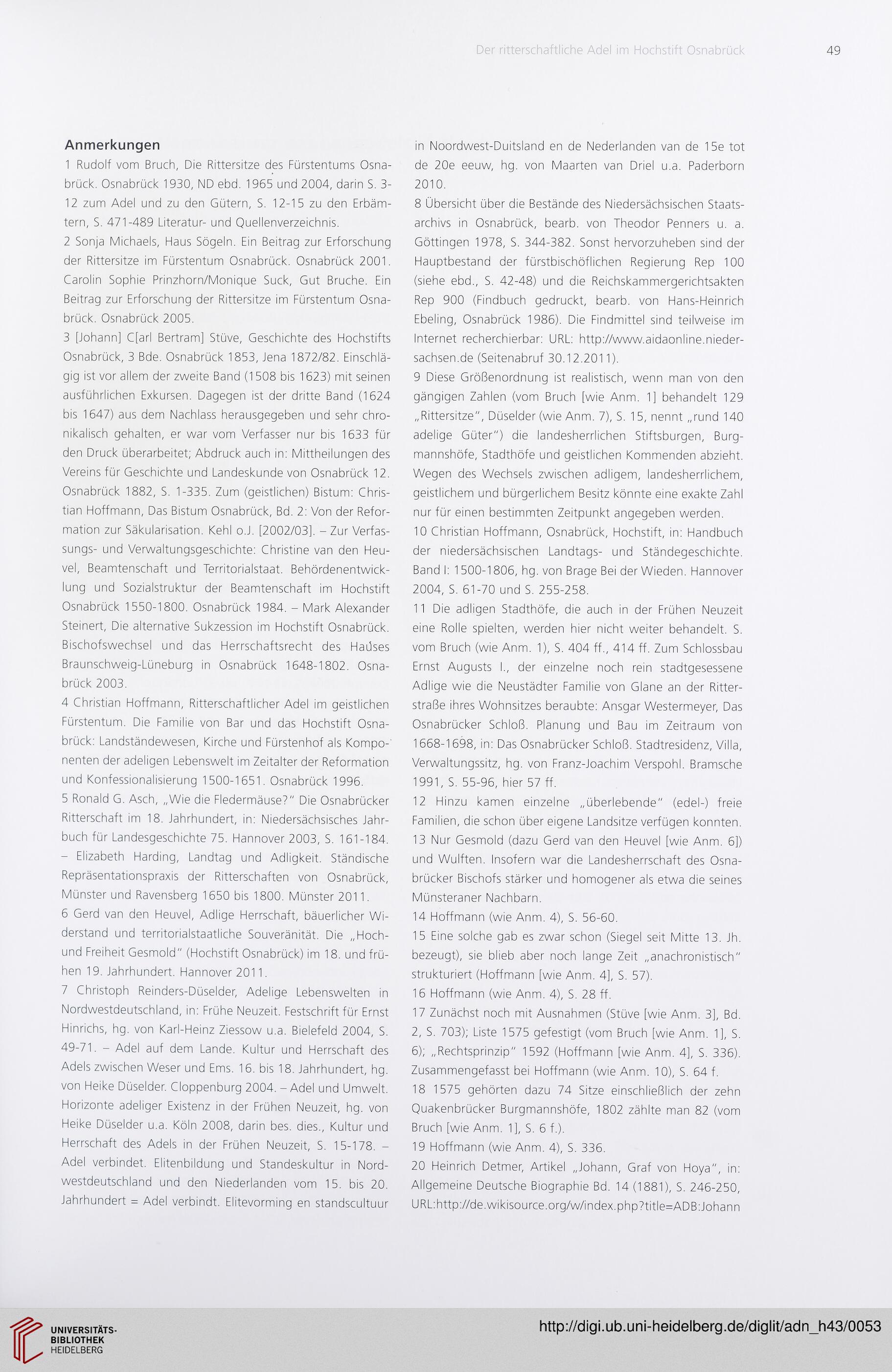Der ritterschaftliche Adel im Hochstift Osnabrück
49
Anmerkungen
1 Rudolf vom Bruch, Die Rittersitze des Fürstentums Osna-
brück. Osnabrück 1930, ND ebd. 1965 und 2004, darin S. 3-
12 zum Adel und zu den Gütern, S. 12-15 zu den Erbäm-
tern, S. 471-489 Literatur- und Quellenverzeichnis.
2 Sonja Michaels, Haus Sögeln. Ein Beitrag zur Erforschung
der Rittersitze im Fürstentum Osnabrück. Osnabrück 2001.
Carolin Sophie Prinzhorn/Monique Suck, Gut Bruche. Ein
Beitrag zur Erforschung der Rittersitze im Fürstentum Osna-
brück. Osnabrück 2005.
3 [Johann] C[arl Bertram] Stüve, Geschichte des Hochstifts
Osnabrück, 3 Bde. Osnabrück 1853, Jena 1872/82. Einschlä-
gig ist vor allem der zweite Band (1508 bis 1623) mit seinen
ausführlichen Exkursen. Dagegen ist der dritte Band (1624
bis 1647) aus dem Nachlass herausgegeben und sehr chro-
nikalisch gehalten, er war vom Verfasser nur bis 1633 für
den Druck überarbeitet; Abdruck auch in: Mittheilungen des
Vereins für Geschichte und Landeskunde von Osnabrück 12.
Osnabrück 1882, S. 1-335. Zum (geistlichen) Bistum: Chris-
tian Hoffmann, Das Bistum Osnabrück, Bd. 2: Von der Refor-
mation zur Säkularisation. Kehl o.J. [2002/03], - Zur Verfas-
sungs- und Verwaltungsgeschichte: Christine van den Heu-
vel, Beamtenschaft und Territorialstaat. Behördenentwick-
lung und Sozialstruktur der Beamtenschaft im Hochstift
Osnabrück 1550-1800. Osnabrück 1984. - Mark Alexander
Steinert, Die alternative Sukzession im Hochstift Osnabrück.
Bischofswechsel und das Herrschaftsrecht des Haüses
Braunschweig-Lüneburg in Osnabrück 1648-1802. Osna-
brück 2003.
4 Christian Hoffmann, Ritterschaftlicher Adel im geistlichen
Fürstentum. Die Familie von Bar und das Hochstift Osna-
brück: Landständewesen, Kirche und Fürstenhof als Kompo-
nenten der adeligen Lebenswelt im Zeitalter der Reformation
und Konfessionalisierung 1500-1651. Osnabrück 1996.
5 Ronald G. Asch, „Wie die Fledermäuse?" Die Osnabrücker
Ritterschaft im 18. Jahrhundert, in: Niedersächsisches Jahr-
buch für Landesgeschichte 75. Hannover 2003, S. 161-184.
- Elizabeth Harding, Landtag und Adligkeit. Ständische
Repräsentationspraxis der Ritterschaften von Osnabrück,
Münster und Ravensberg 1650 bis 1800. Münster 2011.
6 Gerd van den Heuvel, Adlige Herrschaft, bäuerlicher Wi-
derstand und territorialstaatliche Souveränität. Die „Hoch-
und Freiheit Gesmold" (Hochstift Osnabrück) im 18. und frü-
hen 19. Jahrhundert. Hannover 2011.
7 Christoph Reinders-Düselder, Adelige Lebenswelten in
Nordwestdeutschland, in: Frühe Neuzeit. Festschrift für Ernst
Hinrichs, hg. von Karl-Heinz Ziessow u.a. Bielefeld 2004, S.
49-71. - Adel auf dem Lande. Kultur und Herrschaft des
Adels zwischen Weser und Ems. 16. bis 18. Jahrhundert, hg.
von Heike Düselder. Cloppenburg 2004. - Adel und Umwelt.
Horizonte adeliger Existenz in der Frühen Neuzeit, hg. von
Heike Düselder u.a. Köln 2008, darin bes. dies., Kultur und
Herrschaft des Adels in der Frühen Neuzeit, S. 15-178. -
Adel verbindet. Elitenbildung und Standeskultur in Nord-
westdeutschland und den Niederlanden vom 15. bis 20.
Jahrhundert = Adel verbindt. Elitevorming en standscultuur
in Noordwest-Duitsland en de Nederlanden van de 15e tot
de 20e eeuw, hg. von Maarten van Driel u.a. Paderborn
2010.
8 Übersicht über die Bestände des Niedersächsischen Staats-
archivs in Osnabrück, bearb. von Theodor Penners u. a.
Göttingen 1978, S. 344-382. Sonst hervorzuheben sind der
Hauptbestand der fürstbischöflichen Regierung Rep 100
(siehe ebd., S. 42-48) und die Reichskammergerichtsakten
Rep 900 (Findbuch gedruckt, bearb. von Hans-Heinrich
Ebeling, Osnabrück 1986). Die Findmittel sind teilweise im
Internet recherchierbar: URL: http://www.aidaonline.nieder-
sachsen.de (Seitenabruf 30.12.2011).
9 Diese Größenordnung ist realistisch, wenn man von den
gängigen Zahlen (vom Bruch [wie Anm. 1] behandelt 129
„Rittersitze", Düselder (wie Anm. 7), S. 15, nennt „rund 140
adelige Güter") die landesherrlichen Stiftsburgen, Burg-
mannshöfe, Stadthöfe und geistlichen Kommenden abzieht.
Wegen des Wechsels zwischen adligem, landesherrlichem,
geistlichem und bürgerlichem Besitz könnte eine exakte Zahl
nur für einen bestimmten Zeitpunkt angegeben werden.
10 Christian Hoffmann, Osnabrück, Hochstift, in: Handbuch
der niedersächsischen Landtags- und Ständegeschichte.
Band I: 1500-1806, hg. von Brage Bei der Wieden. Hannover
2004, S. 61-70 und S. 255-258.
11 Die adligen Stadthöfe, die auch in der Frühen Neuzeit
eine Rolle spielten, werden hier nicht weiter behandelt. S.
vom Bruch (wie Anm. 1), S. 404 ff., 414 ff. Zum Schlossbau
Ernst Augusts L, der einzelne noch rein stadtgesessene
Adlige wie die Neustädter Familie von Glane an der Ritter-
straße ihres Wohnsitzes beraubte: Ansgar Westermeyer, Das
Osnabrücker Schloß. Planung und Bau im Zeitraum von
1668-1698, in: Das Osnabrücker Schloß. Stadtresidenz, Villa,
Verwaltungssitz, hg. von Franz-Joachim Verspohl. Bramsche
1991, S. 55-96, hier 57 ff.
12 Hinzu kamen einzelne „überlebende" (edel-) freie
Familien, die schon über eigene Landsitze verfügen konnten.
13 Nur Gesmold (dazu Gerd van den Heuvel [wie Anm. 6])
und Wulften. Insofern war die Landesherrschaft des Osna-
brücker Bischofs stärker und homogener als etwa die seines
Münsteraner Nachbarn.
14 Hoffmann (wie Anm. 4), S. 56-60.
15 Eine solche gab es zwar schon (Siegel seit Mitte 13. Jh.
bezeugt), sie blieb aber noch lange Zeit „anachronistisch"
strukturiert (Hoffmann [wie Anm. 4], S. 57).
16 Hoffmann (wie Anm. 4), S. 28 ff.
17 Zunächst noch mit Ausnahmen (Stüve [wie Anm. 3], Bd.
2, S. 703); Liste 1575 gefestigt (vom Bruch [wie Anm. 1], S.
6); „Rechtsprinzip" 1592 (Hoffmann [wie Anm. 4], S. 336).
Zusammengefasst bei Hoffmann (wie Anm. 10), S. 64 f.
18 1575 gehörten dazu 74 Sitze einschließlich der zehn
Quakenbrücker Burgmannshöfe, 1802 zählte man 82 (vom
Bruch [wie Anm. 1], S. 6 f.).
19 Hoffmann (wie Anm. 4), S. 336.
20 Heinrich Detmer, Artikel „Johann, Graf von Hoya", in:
Allgemeine Deutsche Biographie Bd. 14 (1881), S. 246-250,
URL:http://de.wikisource.org/w/index.php?title=ADB:Johann
49
Anmerkungen
1 Rudolf vom Bruch, Die Rittersitze des Fürstentums Osna-
brück. Osnabrück 1930, ND ebd. 1965 und 2004, darin S. 3-
12 zum Adel und zu den Gütern, S. 12-15 zu den Erbäm-
tern, S. 471-489 Literatur- und Quellenverzeichnis.
2 Sonja Michaels, Haus Sögeln. Ein Beitrag zur Erforschung
der Rittersitze im Fürstentum Osnabrück. Osnabrück 2001.
Carolin Sophie Prinzhorn/Monique Suck, Gut Bruche. Ein
Beitrag zur Erforschung der Rittersitze im Fürstentum Osna-
brück. Osnabrück 2005.
3 [Johann] C[arl Bertram] Stüve, Geschichte des Hochstifts
Osnabrück, 3 Bde. Osnabrück 1853, Jena 1872/82. Einschlä-
gig ist vor allem der zweite Band (1508 bis 1623) mit seinen
ausführlichen Exkursen. Dagegen ist der dritte Band (1624
bis 1647) aus dem Nachlass herausgegeben und sehr chro-
nikalisch gehalten, er war vom Verfasser nur bis 1633 für
den Druck überarbeitet; Abdruck auch in: Mittheilungen des
Vereins für Geschichte und Landeskunde von Osnabrück 12.
Osnabrück 1882, S. 1-335. Zum (geistlichen) Bistum: Chris-
tian Hoffmann, Das Bistum Osnabrück, Bd. 2: Von der Refor-
mation zur Säkularisation. Kehl o.J. [2002/03], - Zur Verfas-
sungs- und Verwaltungsgeschichte: Christine van den Heu-
vel, Beamtenschaft und Territorialstaat. Behördenentwick-
lung und Sozialstruktur der Beamtenschaft im Hochstift
Osnabrück 1550-1800. Osnabrück 1984. - Mark Alexander
Steinert, Die alternative Sukzession im Hochstift Osnabrück.
Bischofswechsel und das Herrschaftsrecht des Haüses
Braunschweig-Lüneburg in Osnabrück 1648-1802. Osna-
brück 2003.
4 Christian Hoffmann, Ritterschaftlicher Adel im geistlichen
Fürstentum. Die Familie von Bar und das Hochstift Osna-
brück: Landständewesen, Kirche und Fürstenhof als Kompo-
nenten der adeligen Lebenswelt im Zeitalter der Reformation
und Konfessionalisierung 1500-1651. Osnabrück 1996.
5 Ronald G. Asch, „Wie die Fledermäuse?" Die Osnabrücker
Ritterschaft im 18. Jahrhundert, in: Niedersächsisches Jahr-
buch für Landesgeschichte 75. Hannover 2003, S. 161-184.
- Elizabeth Harding, Landtag und Adligkeit. Ständische
Repräsentationspraxis der Ritterschaften von Osnabrück,
Münster und Ravensberg 1650 bis 1800. Münster 2011.
6 Gerd van den Heuvel, Adlige Herrschaft, bäuerlicher Wi-
derstand und territorialstaatliche Souveränität. Die „Hoch-
und Freiheit Gesmold" (Hochstift Osnabrück) im 18. und frü-
hen 19. Jahrhundert. Hannover 2011.
7 Christoph Reinders-Düselder, Adelige Lebenswelten in
Nordwestdeutschland, in: Frühe Neuzeit. Festschrift für Ernst
Hinrichs, hg. von Karl-Heinz Ziessow u.a. Bielefeld 2004, S.
49-71. - Adel auf dem Lande. Kultur und Herrschaft des
Adels zwischen Weser und Ems. 16. bis 18. Jahrhundert, hg.
von Heike Düselder. Cloppenburg 2004. - Adel und Umwelt.
Horizonte adeliger Existenz in der Frühen Neuzeit, hg. von
Heike Düselder u.a. Köln 2008, darin bes. dies., Kultur und
Herrschaft des Adels in der Frühen Neuzeit, S. 15-178. -
Adel verbindet. Elitenbildung und Standeskultur in Nord-
westdeutschland und den Niederlanden vom 15. bis 20.
Jahrhundert = Adel verbindt. Elitevorming en standscultuur
in Noordwest-Duitsland en de Nederlanden van de 15e tot
de 20e eeuw, hg. von Maarten van Driel u.a. Paderborn
2010.
8 Übersicht über die Bestände des Niedersächsischen Staats-
archivs in Osnabrück, bearb. von Theodor Penners u. a.
Göttingen 1978, S. 344-382. Sonst hervorzuheben sind der
Hauptbestand der fürstbischöflichen Regierung Rep 100
(siehe ebd., S. 42-48) und die Reichskammergerichtsakten
Rep 900 (Findbuch gedruckt, bearb. von Hans-Heinrich
Ebeling, Osnabrück 1986). Die Findmittel sind teilweise im
Internet recherchierbar: URL: http://www.aidaonline.nieder-
sachsen.de (Seitenabruf 30.12.2011).
9 Diese Größenordnung ist realistisch, wenn man von den
gängigen Zahlen (vom Bruch [wie Anm. 1] behandelt 129
„Rittersitze", Düselder (wie Anm. 7), S. 15, nennt „rund 140
adelige Güter") die landesherrlichen Stiftsburgen, Burg-
mannshöfe, Stadthöfe und geistlichen Kommenden abzieht.
Wegen des Wechsels zwischen adligem, landesherrlichem,
geistlichem und bürgerlichem Besitz könnte eine exakte Zahl
nur für einen bestimmten Zeitpunkt angegeben werden.
10 Christian Hoffmann, Osnabrück, Hochstift, in: Handbuch
der niedersächsischen Landtags- und Ständegeschichte.
Band I: 1500-1806, hg. von Brage Bei der Wieden. Hannover
2004, S. 61-70 und S. 255-258.
11 Die adligen Stadthöfe, die auch in der Frühen Neuzeit
eine Rolle spielten, werden hier nicht weiter behandelt. S.
vom Bruch (wie Anm. 1), S. 404 ff., 414 ff. Zum Schlossbau
Ernst Augusts L, der einzelne noch rein stadtgesessene
Adlige wie die Neustädter Familie von Glane an der Ritter-
straße ihres Wohnsitzes beraubte: Ansgar Westermeyer, Das
Osnabrücker Schloß. Planung und Bau im Zeitraum von
1668-1698, in: Das Osnabrücker Schloß. Stadtresidenz, Villa,
Verwaltungssitz, hg. von Franz-Joachim Verspohl. Bramsche
1991, S. 55-96, hier 57 ff.
12 Hinzu kamen einzelne „überlebende" (edel-) freie
Familien, die schon über eigene Landsitze verfügen konnten.
13 Nur Gesmold (dazu Gerd van den Heuvel [wie Anm. 6])
und Wulften. Insofern war die Landesherrschaft des Osna-
brücker Bischofs stärker und homogener als etwa die seines
Münsteraner Nachbarn.
14 Hoffmann (wie Anm. 4), S. 56-60.
15 Eine solche gab es zwar schon (Siegel seit Mitte 13. Jh.
bezeugt), sie blieb aber noch lange Zeit „anachronistisch"
strukturiert (Hoffmann [wie Anm. 4], S. 57).
16 Hoffmann (wie Anm. 4), S. 28 ff.
17 Zunächst noch mit Ausnahmen (Stüve [wie Anm. 3], Bd.
2, S. 703); Liste 1575 gefestigt (vom Bruch [wie Anm. 1], S.
6); „Rechtsprinzip" 1592 (Hoffmann [wie Anm. 4], S. 336).
Zusammengefasst bei Hoffmann (wie Anm. 10), S. 64 f.
18 1575 gehörten dazu 74 Sitze einschließlich der zehn
Quakenbrücker Burgmannshöfe, 1802 zählte man 82 (vom
Bruch [wie Anm. 1], S. 6 f.).
19 Hoffmann (wie Anm. 4), S. 336.
20 Heinrich Detmer, Artikel „Johann, Graf von Hoya", in:
Allgemeine Deutsche Biographie Bd. 14 (1881), S. 246-250,
URL:http://de.wikisource.org/w/index.php?title=ADB:Johann