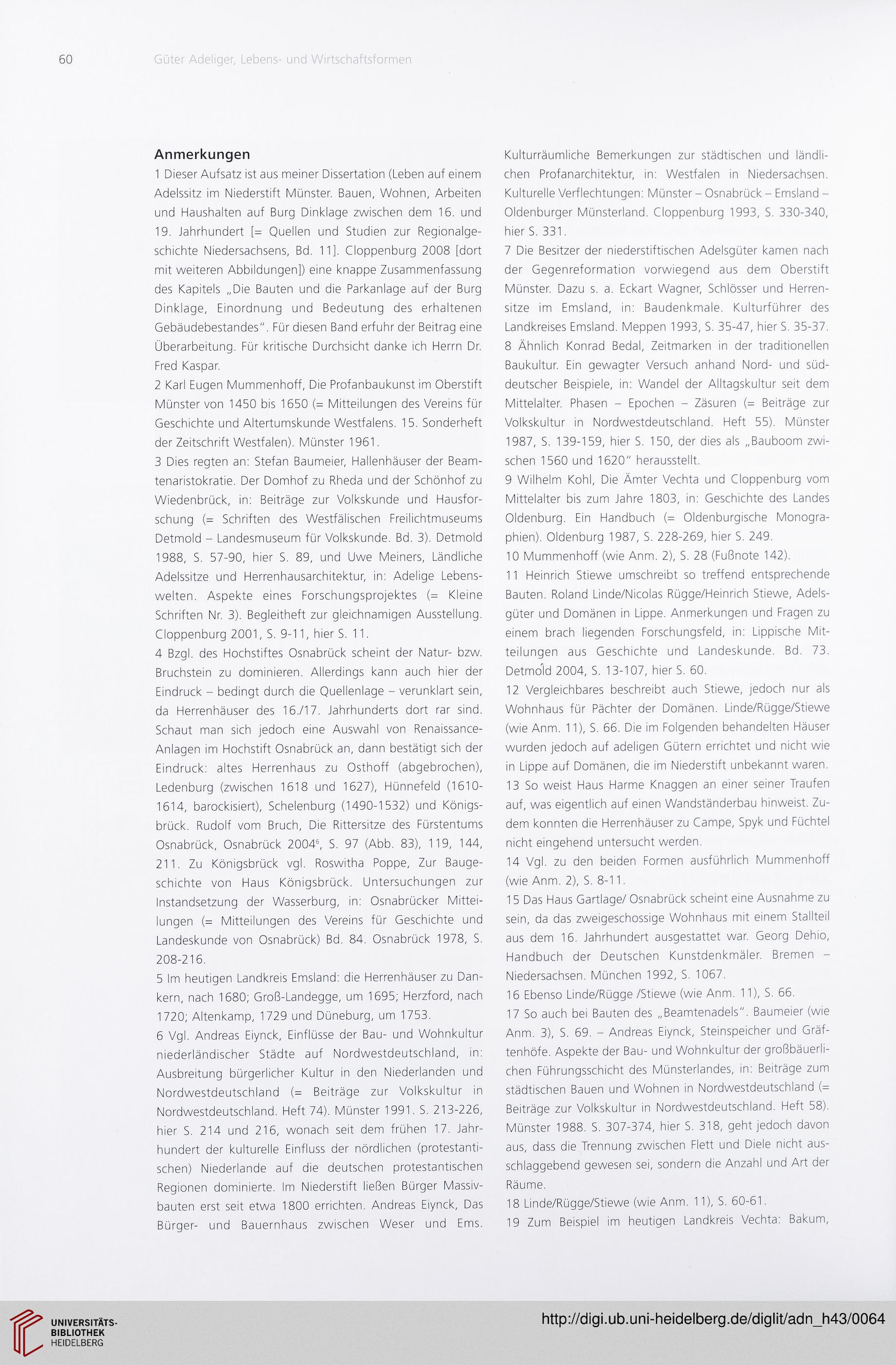60
Güter Adeliger, Lebens- und Wirtschaftsformen
Anmerkungen
1 Dieser Aufsatz ist aus meiner Dissertation (Leben auf einem
Adelssitz im Niederstift Münster. Bauen, Wohnen, Arbeiten
und Haushalten auf Burg Dinklage zwischen dem 16. und
19. Jahrhundert [= Quellen und Studien zur Regionalge-
schichte Niedersachsens, Bd. 11], Cloppenburg 2008 [dort
mit weiteren Abbildungen]) eine knappe Zusammenfassung
des Kapitels „Die Bauten und die Parkanlage auf der Burg
Dinklage, Einordnung und Bedeutung des erhaltenen
Gebäudebestandes". Für diesen Band erfuhr der Beitrag eine
Überarbeitung. Für kritische Durchsicht danke ich Herrn Dr.
Fred Kaspar.
2 Karl Eugen Mummenhoff, Die Profanbaukunst im Oberstift
Münster von 1450 bis 1650 (= Mitteilungen des Vereins für
Geschichte und Altertumskunde Westfalens. 15. Sonderheft
der Zeitschrift Westfalen). Münster 1961.
3 Dies regten an: Stefan Baumeier, Hallenhäuser der Beam-
tenaristokratie. Der Domhof zu Rheda und der Schönhof zu
Wiedenbrück, in: Beiträge zur Volkskunde und Hausfor-
schung (= Schriften des Westfälischen Freilichtmuseums
Detmold - Landesmuseum für Volkskunde. Bd. 3). Detmold
1988, S. 57-90, hier S. 89, und Uwe Meiners, Ländliche
Adelssitze und Herrenhausarchitektur, in: Adelige Lebens-
welten. Aspekte eines Forschungsprojektes (= Kleine
Schriften Nr. 3). Begleitheft zur gleichnamigen Ausstellung.
Cloppenburg 2001, S. 9-11, hier S. 11.
4 Bzgl. des Hochstiftes Osnabrück scheint der Natur- bzw.
Bruchstein zu dominieren. Allerdings kann auch hier der
Eindruck - bedingt durch die Quellenlage - verunklart sein,
da Herrenhäuser des 16./17. Jahrhunderts dort rar sind.
Schaut man sich jedoch eine Auswahl von Renaissance-
Anlagen im Hochstift Osnabrück an, dann bestätigt sich der
Eindruck: altes Herrenhaus zu Osthoff (abgebrochen),
Ledenburg (zwischen 1618 und 1627), Hünnefeld (1610-
1614, barockisiert), Schelenburg (1490-1532) und Königs-
brück. Rudolf vom Bruch, Die Rittersitze des Fürstentums
Osnabrück, Osnabrück 2 0 046, S. 97 (Abb. 83), 119, 144,
211. Zu Königsbrück vgl. Roswitha Poppe, Zur Bauge-
schichte von Haus Königsbrück. Untersuchungen zur
Instandsetzung der Wasserburg, in: Osnabrücker Mittei-
lungen (= Mitteilungen des Vereins für Geschichte und
Landeskunde von Osnabrück) Bd. 84. Osnabrück 1978, S.
208-216.
5 Im heutigen Landkreis Emsland: die Herrenhäuser zu Dan-
kern, nach 1680; Groß-Landegge, um 1695; Herzford, nach
1720; Altenkamp, 1729 und Düneburg, um 1753.
6 Vgl. Andreas Eiynck, Einflüsse der Bau- und Wohnkultur
niederländischer Städte auf Nordwestdeutschland, in:
Ausbreitung bürgerlicher Kultur in den Niederlanden und
Nordwestdeutschland (= Beiträge zur Volkskultur in
Nordwestdeutschland. Heft 74). Münster 1991. S. 213-226,
hier S. 214 und 216, wonach seit dem frühen 17. Jahr-
hundert der kulturelle Einfluss der nördlichen (protestanti-
schen) Niederlande auf die deutschen protestantischen
Regionen dominierte. Im Niederstift ließen Bürger Massiv-
bauten erst seit etwa 1800 errichten. Andreas Eiynck, Das
Bürger- und Bauernhaus zwischen Weser und Ems.
Kulturräumliche Bemerkungen zur städtischen und ländli-
chen Profanarchitektur, in: Westfalen in Niedersachsen.
Kulturelle Verflechtungen: Münster - Osnabrück - Emsland -
Oldenburger Münsterland. Cloppenburg 1993, S. 330-340,
hier S. 331.
7 Die Besitzer der niederstiftischen Adelsgüter kamen nach
der Gegenreformation vorwiegend aus dem Oberstift
Münster. Dazu s. a. Eckart Wagner, Schlösser und Herren-
sitze im Emsland, in: Baudenkmale. Kulturführer des
Landkreises Emsland. Meppen 1993, S. 35-47, hier S. 35-37.
8 Ähnlich Konrad Bedal, Zeitmarken in der traditionellen
Baukultur. Ein gewagter Versuch anhand Nord- und süd-
deutscher Beispiele, in: Wandel der Alltagskultur seit dem
Mittelalter. Phasen - Epochen - Zäsuren (= Beiträge zur
Volkskultur in Nordwestdeutschland. Heft 55). Münster
1987, S. 139-159, hier S. 150, der dies als „Bauboom zwi-
schen 1560 und 1620" herausstellt.
9 Wilhelm Kohl, Die Ämter Vechta und Cloppenburg vom
Mittelalter bis zum Jahre 1803, in: Geschichte des Landes
Oldenburg. Ein Handbuch (= Oldenburgische Monogra-
phien). Oldenburg 1987, S. 228-269, hier S. 249.
10 Mummenhoff (wie Anm. 2), S. 28 (Fußnote 142).
11 Heinrich Stiewe umschreibt so treffend entsprechende
Bauten. Roland Linde/Nicolas Rügge/Heinrich Stiewe, Adels-
güter und Domänen in Lippe. Anmerkungen und Fragen zu
einem brach liegenden Forschungsfeld, in: Lippische Mit-
teilungen aus Geschichte und Landeskunde. Bd. 73.
Detmold 2004, S. 13-107, hier S. 60.
12 Vergleichbares beschreibt auch Stiewe, jedoch nur als
Wohnhaus für Pächter der Domänen. Linde/Rügge/Stiewe
(wie Anm. 11), S. 66. Die im Folgenden behandelten Häuser
wurden jedoch auf adeligen Gütern errichtet und nicht wie
in Lippe auf Domänen, die im Niederstift unbekannt waren.
13 So weist Haus Harme Knaggen an einer seiner Traufen
auf, was eigentlich auf einen Wandständerbau hinweist. Zu-
dem konnten die Herrenhäuser zu Campe, Spyk und Füchtel
nicht eingehend untersucht werden.
14 Vgl. zu den beiden Formen ausführlich Mummenhoff
(wie Anm. 2), S. 8-11.
15 Das Haus Gartlage/ Osnabrück scheint eine Ausnahme zu
sein, da das zweigeschossige Wohnhaus mit einem Stallteil
aus dem 16. Jahrhundert ausgestattet war. Georg Dehio,
Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler. Bremen -
Niedersachsen. München 1992, S. 1067.
16 Ebenso Linde/Rügge/Stiewe (wie Anm. 11), S. 66.
17 So auch bei Bauten des „Beamtenadels". Baumeier (wie
Anm. 3), S. 69. - Andreas Eiynck, Steinspeicher und Gräf-
tenhöfe. Aspekte der Bau- und Wohnkultur der großbäuerli-
chen Führungsschicht des Münsterlandes, in: Beiträge zum
städtischen Bauen und Wohnen in Nordwestdeutschland (-
Beiträge zur Volkskultur in Nordwestdeutschland. Heft 58).
Münster 1988. S. 307-374, hier S. 318, geht jedoch davon
aus, dass die Trennung zwischen Flett und Diele nicht aus-
schlaggebend gewesen sei, sondern die Anzahl und Art der
Räume.
18 Linde/Rügge/Stiewe (wie Anm. 11), S. 60-61.
19 Zum Beispiel im heutigen Landkreis Vechta: Bakum,
Güter Adeliger, Lebens- und Wirtschaftsformen
Anmerkungen
1 Dieser Aufsatz ist aus meiner Dissertation (Leben auf einem
Adelssitz im Niederstift Münster. Bauen, Wohnen, Arbeiten
und Haushalten auf Burg Dinklage zwischen dem 16. und
19. Jahrhundert [= Quellen und Studien zur Regionalge-
schichte Niedersachsens, Bd. 11], Cloppenburg 2008 [dort
mit weiteren Abbildungen]) eine knappe Zusammenfassung
des Kapitels „Die Bauten und die Parkanlage auf der Burg
Dinklage, Einordnung und Bedeutung des erhaltenen
Gebäudebestandes". Für diesen Band erfuhr der Beitrag eine
Überarbeitung. Für kritische Durchsicht danke ich Herrn Dr.
Fred Kaspar.
2 Karl Eugen Mummenhoff, Die Profanbaukunst im Oberstift
Münster von 1450 bis 1650 (= Mitteilungen des Vereins für
Geschichte und Altertumskunde Westfalens. 15. Sonderheft
der Zeitschrift Westfalen). Münster 1961.
3 Dies regten an: Stefan Baumeier, Hallenhäuser der Beam-
tenaristokratie. Der Domhof zu Rheda und der Schönhof zu
Wiedenbrück, in: Beiträge zur Volkskunde und Hausfor-
schung (= Schriften des Westfälischen Freilichtmuseums
Detmold - Landesmuseum für Volkskunde. Bd. 3). Detmold
1988, S. 57-90, hier S. 89, und Uwe Meiners, Ländliche
Adelssitze und Herrenhausarchitektur, in: Adelige Lebens-
welten. Aspekte eines Forschungsprojektes (= Kleine
Schriften Nr. 3). Begleitheft zur gleichnamigen Ausstellung.
Cloppenburg 2001, S. 9-11, hier S. 11.
4 Bzgl. des Hochstiftes Osnabrück scheint der Natur- bzw.
Bruchstein zu dominieren. Allerdings kann auch hier der
Eindruck - bedingt durch die Quellenlage - verunklart sein,
da Herrenhäuser des 16./17. Jahrhunderts dort rar sind.
Schaut man sich jedoch eine Auswahl von Renaissance-
Anlagen im Hochstift Osnabrück an, dann bestätigt sich der
Eindruck: altes Herrenhaus zu Osthoff (abgebrochen),
Ledenburg (zwischen 1618 und 1627), Hünnefeld (1610-
1614, barockisiert), Schelenburg (1490-1532) und Königs-
brück. Rudolf vom Bruch, Die Rittersitze des Fürstentums
Osnabrück, Osnabrück 2 0 046, S. 97 (Abb. 83), 119, 144,
211. Zu Königsbrück vgl. Roswitha Poppe, Zur Bauge-
schichte von Haus Königsbrück. Untersuchungen zur
Instandsetzung der Wasserburg, in: Osnabrücker Mittei-
lungen (= Mitteilungen des Vereins für Geschichte und
Landeskunde von Osnabrück) Bd. 84. Osnabrück 1978, S.
208-216.
5 Im heutigen Landkreis Emsland: die Herrenhäuser zu Dan-
kern, nach 1680; Groß-Landegge, um 1695; Herzford, nach
1720; Altenkamp, 1729 und Düneburg, um 1753.
6 Vgl. Andreas Eiynck, Einflüsse der Bau- und Wohnkultur
niederländischer Städte auf Nordwestdeutschland, in:
Ausbreitung bürgerlicher Kultur in den Niederlanden und
Nordwestdeutschland (= Beiträge zur Volkskultur in
Nordwestdeutschland. Heft 74). Münster 1991. S. 213-226,
hier S. 214 und 216, wonach seit dem frühen 17. Jahr-
hundert der kulturelle Einfluss der nördlichen (protestanti-
schen) Niederlande auf die deutschen protestantischen
Regionen dominierte. Im Niederstift ließen Bürger Massiv-
bauten erst seit etwa 1800 errichten. Andreas Eiynck, Das
Bürger- und Bauernhaus zwischen Weser und Ems.
Kulturräumliche Bemerkungen zur städtischen und ländli-
chen Profanarchitektur, in: Westfalen in Niedersachsen.
Kulturelle Verflechtungen: Münster - Osnabrück - Emsland -
Oldenburger Münsterland. Cloppenburg 1993, S. 330-340,
hier S. 331.
7 Die Besitzer der niederstiftischen Adelsgüter kamen nach
der Gegenreformation vorwiegend aus dem Oberstift
Münster. Dazu s. a. Eckart Wagner, Schlösser und Herren-
sitze im Emsland, in: Baudenkmale. Kulturführer des
Landkreises Emsland. Meppen 1993, S. 35-47, hier S. 35-37.
8 Ähnlich Konrad Bedal, Zeitmarken in der traditionellen
Baukultur. Ein gewagter Versuch anhand Nord- und süd-
deutscher Beispiele, in: Wandel der Alltagskultur seit dem
Mittelalter. Phasen - Epochen - Zäsuren (= Beiträge zur
Volkskultur in Nordwestdeutschland. Heft 55). Münster
1987, S. 139-159, hier S. 150, der dies als „Bauboom zwi-
schen 1560 und 1620" herausstellt.
9 Wilhelm Kohl, Die Ämter Vechta und Cloppenburg vom
Mittelalter bis zum Jahre 1803, in: Geschichte des Landes
Oldenburg. Ein Handbuch (= Oldenburgische Monogra-
phien). Oldenburg 1987, S. 228-269, hier S. 249.
10 Mummenhoff (wie Anm. 2), S. 28 (Fußnote 142).
11 Heinrich Stiewe umschreibt so treffend entsprechende
Bauten. Roland Linde/Nicolas Rügge/Heinrich Stiewe, Adels-
güter und Domänen in Lippe. Anmerkungen und Fragen zu
einem brach liegenden Forschungsfeld, in: Lippische Mit-
teilungen aus Geschichte und Landeskunde. Bd. 73.
Detmold 2004, S. 13-107, hier S. 60.
12 Vergleichbares beschreibt auch Stiewe, jedoch nur als
Wohnhaus für Pächter der Domänen. Linde/Rügge/Stiewe
(wie Anm. 11), S. 66. Die im Folgenden behandelten Häuser
wurden jedoch auf adeligen Gütern errichtet und nicht wie
in Lippe auf Domänen, die im Niederstift unbekannt waren.
13 So weist Haus Harme Knaggen an einer seiner Traufen
auf, was eigentlich auf einen Wandständerbau hinweist. Zu-
dem konnten die Herrenhäuser zu Campe, Spyk und Füchtel
nicht eingehend untersucht werden.
14 Vgl. zu den beiden Formen ausführlich Mummenhoff
(wie Anm. 2), S. 8-11.
15 Das Haus Gartlage/ Osnabrück scheint eine Ausnahme zu
sein, da das zweigeschossige Wohnhaus mit einem Stallteil
aus dem 16. Jahrhundert ausgestattet war. Georg Dehio,
Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler. Bremen -
Niedersachsen. München 1992, S. 1067.
16 Ebenso Linde/Rügge/Stiewe (wie Anm. 11), S. 66.
17 So auch bei Bauten des „Beamtenadels". Baumeier (wie
Anm. 3), S. 69. - Andreas Eiynck, Steinspeicher und Gräf-
tenhöfe. Aspekte der Bau- und Wohnkultur der großbäuerli-
chen Führungsschicht des Münsterlandes, in: Beiträge zum
städtischen Bauen und Wohnen in Nordwestdeutschland (-
Beiträge zur Volkskultur in Nordwestdeutschland. Heft 58).
Münster 1988. S. 307-374, hier S. 318, geht jedoch davon
aus, dass die Trennung zwischen Flett und Diele nicht aus-
schlaggebend gewesen sei, sondern die Anzahl und Art der
Räume.
18 Linde/Rügge/Stiewe (wie Anm. 11), S. 60-61.
19 Zum Beispiel im heutigen Landkreis Vechta: Bakum,