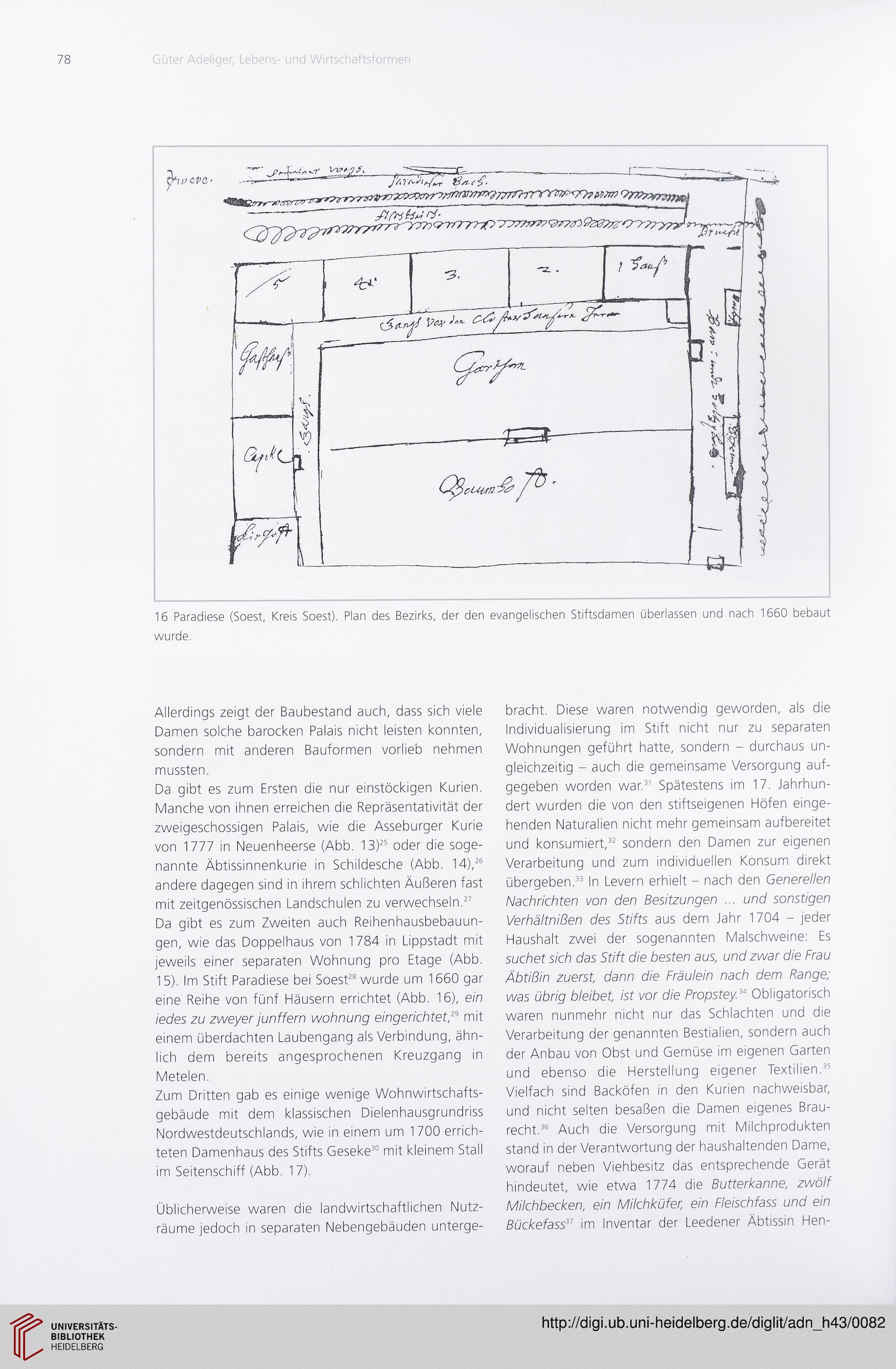78
Güter Adeliger, Lebens- und Wirtschaftsformen
16 Paradiese (Soest, Kreis Soest). Plan des Bezirks, der den evangelischen Stiftsdamen überlassen und nach 1660 bebaut
wurde.
Allerdings zeigt der Baubestand auch, dass sich viele
Damen solche barocken Palais nicht leisten konnten,
sondern mit anderen Bauformen vorlieb nehmen
mussten.
Da gibt es zum Ersten die nur einstöckigen Kurien.
Manche von ihnen erreichen die Repräsentativität der
zweigeschossigen Palais, wie die Asseburger Kurie
von 1777 in Neuenheerse (Abb. 13)25 oder die soge-
nannte Äbtissinnenkurie in Schildesche (Abb. 14),26
andere dagegen sind in ihrem schlichten Äußeren fast
mit zeitgenössischen Landschulen zu verwechseln.27
Da gibt es zum Zweiten auch Reihenhausbebauun-
gen, wie das Doppelhaus von 1784 in Lippstadt mit
jeweils einer separaten Wohnung pro Etage (Abb.
15). Im Stift Paradiese bei Soest28 wurde um 1660 gar
eine Reihe von fünf Häusern errichtet (Abb. 16), ein
iedes zu zweyer junffern wohnung eingerichtet,29 mit
einem überdachten Laubengang als Verbindung, ähn-
lich dem bereits angesprochenen Kreuzgang in
Metelen.
Zum Dritten gab es einige wenige Wohnwirtschafts-
gebäude mit dem klassischen Dielenhausgrundriss
Nordwestdeutschlands, wie in einem um 1700 errich-
teten Damenhaus des Stifts Geseke30 mit kleinem Stall
im Seitenschiff (Abb. 17).
Üblicherweise waren die landwirtschaftlichen Nutz-
räume jedoch in separaten Nebengebäuden unterge-
bracht. Diese waren notwendig geworden, als die
Individualisierung im Stift nicht nur zu separaten
Wohnungen geführt hatte, sondern - durchaus un-
gleichzeitig - auch die gemeinsame Versorgung auf-
gegeben worden war.31 Spätestens im 17. Jahrhun-
dert wurden die von den stiftseigenen Höfen einge-
henden Naturalien nicht mehr gemeinsam aufbereitet
und konsumiert,32 sondern den Damen zur eigenen
Verarbeitung und zum individuellen Konsum direkt
übergeben.33 In Levern erhielt - nach den Generellen
Nachrichten von den Besitzungen ... und sonstigen
Verhältnißen des Stifts aus dem Jahr 1704 - jeder
Haushalt zwei der sogenannten Malschweine: Es
suchet sich das Stift die besten aus, und zwar die Frau
Äbtißin zuerst, dann die Fräulein nach dem Range;
was übrig bleibet, ist vor die Propstey.34 Obligatorisch
waren nunmehr nicht nur das Schlachten und die
Verarbeitung der genannten Bestialien, sondern auch
der Anbau von Obst und Gemüse im eigenen Garten
und ebenso die Herstellung eigener Textilien.35
Vielfach sind Backöfen in den Kurien nachweisbar,
und nicht selten besaßen die Damen eigenes Brau-
recht.36 Auch die Versorgung mit Milchprodukten
stand in der Verantwortung der haushaltenden Dame,
worauf neben Viehbesitz das entsprechende Gerät
hindeutet, wie etwa 1774 die Butterkanne, zwölf
Milchbecken, ein Milchküfer, ein Fleischfass und ein
Bückefass37 im Inventar der Leedener Äbtissin Hen-
Güter Adeliger, Lebens- und Wirtschaftsformen
16 Paradiese (Soest, Kreis Soest). Plan des Bezirks, der den evangelischen Stiftsdamen überlassen und nach 1660 bebaut
wurde.
Allerdings zeigt der Baubestand auch, dass sich viele
Damen solche barocken Palais nicht leisten konnten,
sondern mit anderen Bauformen vorlieb nehmen
mussten.
Da gibt es zum Ersten die nur einstöckigen Kurien.
Manche von ihnen erreichen die Repräsentativität der
zweigeschossigen Palais, wie die Asseburger Kurie
von 1777 in Neuenheerse (Abb. 13)25 oder die soge-
nannte Äbtissinnenkurie in Schildesche (Abb. 14),26
andere dagegen sind in ihrem schlichten Äußeren fast
mit zeitgenössischen Landschulen zu verwechseln.27
Da gibt es zum Zweiten auch Reihenhausbebauun-
gen, wie das Doppelhaus von 1784 in Lippstadt mit
jeweils einer separaten Wohnung pro Etage (Abb.
15). Im Stift Paradiese bei Soest28 wurde um 1660 gar
eine Reihe von fünf Häusern errichtet (Abb. 16), ein
iedes zu zweyer junffern wohnung eingerichtet,29 mit
einem überdachten Laubengang als Verbindung, ähn-
lich dem bereits angesprochenen Kreuzgang in
Metelen.
Zum Dritten gab es einige wenige Wohnwirtschafts-
gebäude mit dem klassischen Dielenhausgrundriss
Nordwestdeutschlands, wie in einem um 1700 errich-
teten Damenhaus des Stifts Geseke30 mit kleinem Stall
im Seitenschiff (Abb. 17).
Üblicherweise waren die landwirtschaftlichen Nutz-
räume jedoch in separaten Nebengebäuden unterge-
bracht. Diese waren notwendig geworden, als die
Individualisierung im Stift nicht nur zu separaten
Wohnungen geführt hatte, sondern - durchaus un-
gleichzeitig - auch die gemeinsame Versorgung auf-
gegeben worden war.31 Spätestens im 17. Jahrhun-
dert wurden die von den stiftseigenen Höfen einge-
henden Naturalien nicht mehr gemeinsam aufbereitet
und konsumiert,32 sondern den Damen zur eigenen
Verarbeitung und zum individuellen Konsum direkt
übergeben.33 In Levern erhielt - nach den Generellen
Nachrichten von den Besitzungen ... und sonstigen
Verhältnißen des Stifts aus dem Jahr 1704 - jeder
Haushalt zwei der sogenannten Malschweine: Es
suchet sich das Stift die besten aus, und zwar die Frau
Äbtißin zuerst, dann die Fräulein nach dem Range;
was übrig bleibet, ist vor die Propstey.34 Obligatorisch
waren nunmehr nicht nur das Schlachten und die
Verarbeitung der genannten Bestialien, sondern auch
der Anbau von Obst und Gemüse im eigenen Garten
und ebenso die Herstellung eigener Textilien.35
Vielfach sind Backöfen in den Kurien nachweisbar,
und nicht selten besaßen die Damen eigenes Brau-
recht.36 Auch die Versorgung mit Milchprodukten
stand in der Verantwortung der haushaltenden Dame,
worauf neben Viehbesitz das entsprechende Gerät
hindeutet, wie etwa 1774 die Butterkanne, zwölf
Milchbecken, ein Milchküfer, ein Fleischfass und ein
Bückefass37 im Inventar der Leedener Äbtissin Hen-