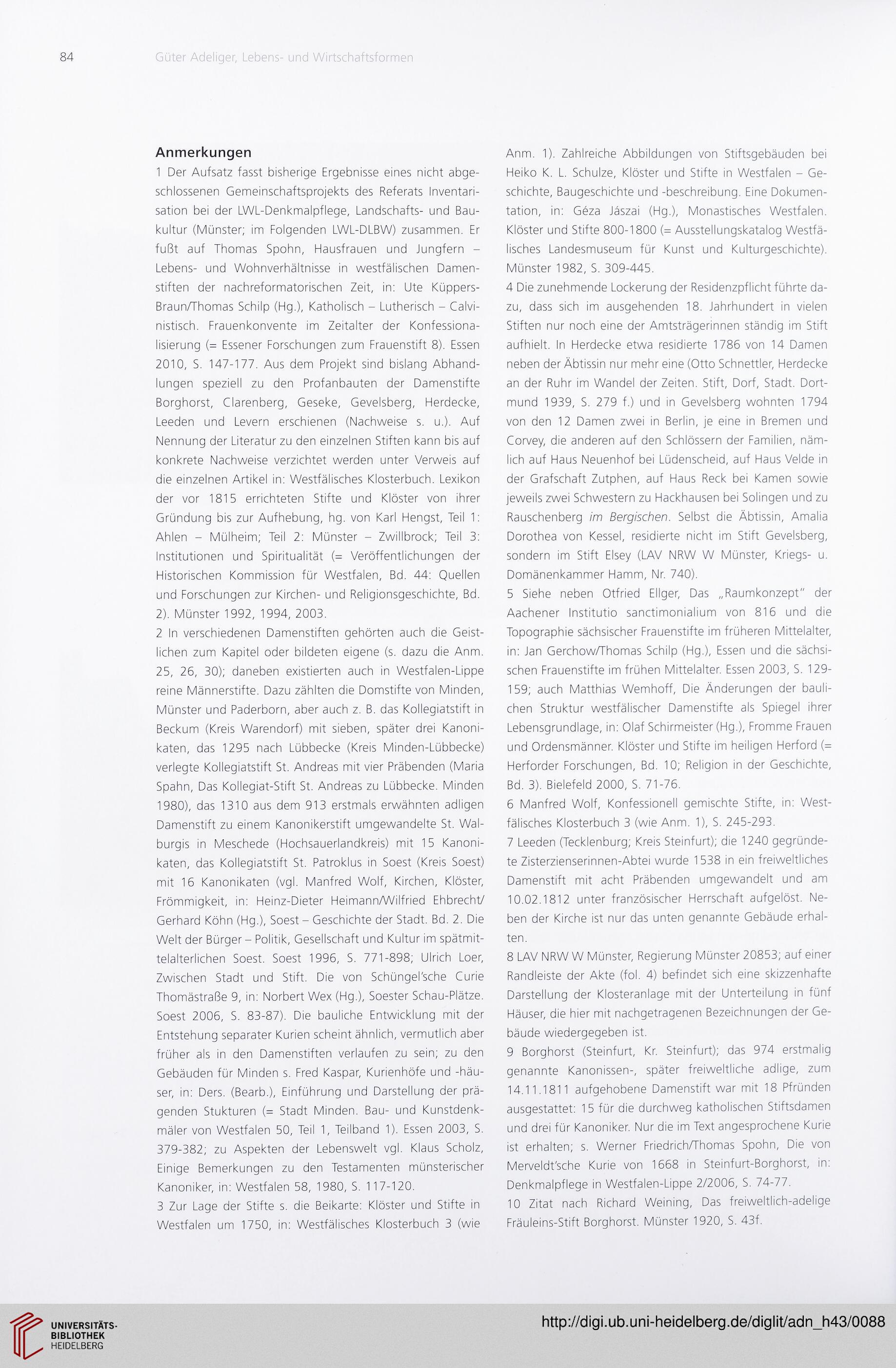84
Güter Adeliger, Lebens- und Wirtschaftsformen
Anmerkungen
1 Der Aufsatz fasst bisherige Ergebnisse eines nicht abge-
schlossenen Gemeinschaftsprojekts des Referats Inventari-
sation bei der LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Bau-
kultur (Münster; im Folgenden LWL-DLBW) zusammen. Er
fußt auf Thomas Spohn, Hausfrauen und Jungfern -
Lebens- und Wohnverhältnisse in westfälischen Damen-
stiften der nachreformatorischen Zeit, in: Ute Küppers-
Braun/Thomas Schilp (Hg.), Katholisch - Lutherisch - Calvi-
nistisch. Frauenkonvente im Zeitalter der Konfessiona-
lisierung (= Essener Forschungen zum Frauenstift 8). Essen
2010, S. 147-177. Aus dem Projekt sind bislang Abhand-
lungen speziell zu den Profanbauten der Damenstifte
Borghorst, Clarenberg, Geseke, Gevelsberg, Herdecke,
Leeden und Levern erschienen (Nachweise s. u.). Auf
Nennung der Literatur zu den einzelnen Stiften kann bis auf
konkrete Nachweise verzichtet werden unter Verweis auf
die einzelnen Artikel in: Westfälisches Klosterbuch. Lexikon
der vor 1815 errichteten Stifte und Klöster von ihrer
Gründung bis zur Aufhebung, hg. von Karl Hengst, Teil 1:
Ahlen - Mülheim; Teil 2: Münster - Zwillbrock; Teil 3:
Institutionen und Spiritualität (= Veröffentlichungen der
Historischen Kommission für Westfalen, Bd. 44: Quellen
und Forschungen zur Kirchen- und Religionsgeschichte, Bd.
2). Münster 1992, 1994, 2003.
2 In verschiedenen Damenstiften gehörten auch die Geist-
lichen zum Kapitel oder bildeten eigene (s. dazu die Anm.
25, 26, 30); daneben existierten auch in Westfalen-Lippe
reine Männerstifte. Dazu zählten die Domstifte von Minden,
Münster und Paderborn, aber auch z. B. das Kollegiatstift in
Beckum (Kreis Warendorf) mit sieben, später drei Kanoni-
katen, das 1295 nach Lübbecke (Kreis Minden-Lübbecke)
verlegte Kollegiatstift St. Andreas mit vier Präbenden (Maria
Spahn, Das Kollegiat-Stift St. Andreas zu Lübbecke. Minden
1980), das 1310 aus dem 913 erstmals erwähnten adligen
Damenstift zu einem Kanonikerstift umgewandelte St. Wal-
burgis in Meschede (Hochsauerlandkreis) mit 15 Kanoni-
katen, das Kollegiatstift St. Patroklus in Soest (Kreis Soest)
mit 16 Kanonikaten (vgl. Manfred Wolf, Kirchen, Klöster,
Frömmigkeit, in: Heinz-Dieter Heimann/Wilfried Ehbrecht/
Gerhard Köhn (Hg.), Soest - Geschichte der Stadt. Bd. 2. Die
Welt der Bürger - Politik, Gesellschaft und Kultur im spätmit-
telalterlichen Soest. Soest 1996, S. 771-898; Ulrich Loer,
Zwischen Stadt und Stift. Die von Schüngel'sche Curie
Thomästraße 9, in: Norbert Wex (Hg.), Soester Schau-Plätze.
Soest 2006, S. 83-87). Die bauliche Entwicklung mit der
Entstehung separater Kurien scheint ähnlich, vermutlich aber
früher als in den Damenstiften verlaufen zu sein; zu den
Gebäuden für Minden s. Fred Kaspar, Kurienhöfe und -häu-
ser, in: Ders. (Bearb.), Einführung und Darstellung der prä-
genden Stukturen (= Stadt Minden. Bau- und Kunstdenk-
mäler von Westfalen 50, Teil 1, Teilband 1). Essen 2003, S.
379-382; zu Aspekten der Lebenswelt vgl. Klaus Scholz,
Einige Bemerkungen zu den Testamenten münsterischer
Kanoniker, in: Westfalen 58, 1980, S. 117-120.
3 Zur Lage der Stifte s. die Beikarte: Klöster und Stifte in
Westfalen um 1750, in: Westfälisches Klosterbuch 3 (wie
Anm. 1). Zahlreiche Abbildungen von Stiftsgebäuden bei
Heiko K. L. Schulze, Klöster und Stifte in Westfalen - Ge-
schichte, Baugeschichte und -beschreibung. Eine Dokumen-
tation, in: Geza Jäszai (Hg.), Monastisches Westfalen.
Klöster und Stifte 800-1800 (= Ausstellungskatalog Westfä-
lisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte).
Münster 1982, S. 309-445.
4 Die zunehmende Lockerung der Residenzpflicht führte da-
zu, dass sich im ausgehenden 18. Jahrhundert in vielen
Stiften nur noch eine der Amtsträgerinnen ständig im Stift
aufhielt. In Herdecke etwa residierte 1786 von 14 Damen
neben der Äbtissin nur mehr eine (Otto Schnettler, Herdecke
an der Ruhr im Wandel der Zeiten. Stift, Dorf, Stadt. Dort-
mund 1939, S. 279 f.) und in Gevelsberg wohnten 1794
von den 12 Damen zwei in Berlin, je eine in Bremen und
Corvey, die anderen auf den Schlössern der Familien, näm-
lich auf Haus Neuenhof bei Lüdenscheid, auf Haus Velde in
der Grafschaft Zutphen, auf Haus Reck bei Kamen sowie
jeweils zwei Schwestern zu Hackhausen bei Solingen und zu
Rauschenberg im Bergischen. Selbst die Äbtissin, Amalia
Dorothea von Kessel, residierte nicht im Stift Gevelsberg,
sondern im Stift Elsey (LAV NRW W Münster, Kriegs- u.
Domänenkammer Hamm, Nr. 740).
5 Siehe neben Otfried Ellger, Das „Raumkonzept'' der
Aachener Institutio sanctimonialium von 816 und die
Topographie sächsischer Frauenstifte im früheren Mittelalter,
in: Jan Gerchow/Fhomas Schilp (Hg.), Essen und die sächsi-
schen Frauenstifte im frühen Mittelalter. Essen 2003, S. 129-
159; auch Matthias Wemhoff, Die Änderungen der bauli-
chen Struktur westfälischer Damenstifte als Spiegel ihrer
Lebensgrundlage, in: Olaf Schirmeister (Hg.), Fromme Frauen
und Ordensmänner. Klöster und Stifte im heiligen Herford (-
Herforder Forschungen, Bd. 10; Religion in der Geschichte,
Bd. 3). Bielefeld 2000, S. 71-76.
6 Manfred Wolf, Konfessionell gemischte Stifte, in: West-
fälisches Klosterbuch 3 (wie Anm. 1), S. 245-293.
7 Leeden (Tecklenburg; Kreis Steinfurt); die 1240 gegründe-
te Zisterzienserinnen-Abtei wurde 1538 in ein freiweltliches
Damenstift mit acht Präbenden umgewandelt und am
10.02.1812 unter französischer Herrschaft aufgelöst. Ne-
ben der Kirche ist nur das unten genannte Gebäude erhal-
ten.
8 LAV NRW W Münster, Regierung Münster 20853; auf einer
Randleiste der Akte (fol. 4) befindet sich eine skizzenhafte
Darstellung der Klosteranlage mit der Unterteilung in fünf
Häuser, die hier mit nachgetragenen Bezeichnungen der Ge-
bäude wiedergegeben ist.
9 Borghorst (Steinfurt, Kr. Steinfurt); das 974 erstmalig
genannte Kanonissen-, später freiweltliche adlige, zum
14.11.1811 aufgehobene Damenstift war mit 18 Pfründen
ausgestattet: 15 für die durchweg katholischen Stiftsdamen
und drei für Kanoniker. Nur die im Text angesprochene Kurie
ist erhalten; s. Werner Friedrich/Thomas Spohn, Die von
Merveldt'sche Kurie von 1668 in Steinfurt-Borghorst, in:
Denkmalpflege in Westfalen-Lippe 2/2006, S. 74-77.
10 Zitat nach Richard Weining, Das freiweltlich-adelige
Fräuleins-Stift Borghorst. Münster 1920, S. 43f.
Güter Adeliger, Lebens- und Wirtschaftsformen
Anmerkungen
1 Der Aufsatz fasst bisherige Ergebnisse eines nicht abge-
schlossenen Gemeinschaftsprojekts des Referats Inventari-
sation bei der LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Bau-
kultur (Münster; im Folgenden LWL-DLBW) zusammen. Er
fußt auf Thomas Spohn, Hausfrauen und Jungfern -
Lebens- und Wohnverhältnisse in westfälischen Damen-
stiften der nachreformatorischen Zeit, in: Ute Küppers-
Braun/Thomas Schilp (Hg.), Katholisch - Lutherisch - Calvi-
nistisch. Frauenkonvente im Zeitalter der Konfessiona-
lisierung (= Essener Forschungen zum Frauenstift 8). Essen
2010, S. 147-177. Aus dem Projekt sind bislang Abhand-
lungen speziell zu den Profanbauten der Damenstifte
Borghorst, Clarenberg, Geseke, Gevelsberg, Herdecke,
Leeden und Levern erschienen (Nachweise s. u.). Auf
Nennung der Literatur zu den einzelnen Stiften kann bis auf
konkrete Nachweise verzichtet werden unter Verweis auf
die einzelnen Artikel in: Westfälisches Klosterbuch. Lexikon
der vor 1815 errichteten Stifte und Klöster von ihrer
Gründung bis zur Aufhebung, hg. von Karl Hengst, Teil 1:
Ahlen - Mülheim; Teil 2: Münster - Zwillbrock; Teil 3:
Institutionen und Spiritualität (= Veröffentlichungen der
Historischen Kommission für Westfalen, Bd. 44: Quellen
und Forschungen zur Kirchen- und Religionsgeschichte, Bd.
2). Münster 1992, 1994, 2003.
2 In verschiedenen Damenstiften gehörten auch die Geist-
lichen zum Kapitel oder bildeten eigene (s. dazu die Anm.
25, 26, 30); daneben existierten auch in Westfalen-Lippe
reine Männerstifte. Dazu zählten die Domstifte von Minden,
Münster und Paderborn, aber auch z. B. das Kollegiatstift in
Beckum (Kreis Warendorf) mit sieben, später drei Kanoni-
katen, das 1295 nach Lübbecke (Kreis Minden-Lübbecke)
verlegte Kollegiatstift St. Andreas mit vier Präbenden (Maria
Spahn, Das Kollegiat-Stift St. Andreas zu Lübbecke. Minden
1980), das 1310 aus dem 913 erstmals erwähnten adligen
Damenstift zu einem Kanonikerstift umgewandelte St. Wal-
burgis in Meschede (Hochsauerlandkreis) mit 15 Kanoni-
katen, das Kollegiatstift St. Patroklus in Soest (Kreis Soest)
mit 16 Kanonikaten (vgl. Manfred Wolf, Kirchen, Klöster,
Frömmigkeit, in: Heinz-Dieter Heimann/Wilfried Ehbrecht/
Gerhard Köhn (Hg.), Soest - Geschichte der Stadt. Bd. 2. Die
Welt der Bürger - Politik, Gesellschaft und Kultur im spätmit-
telalterlichen Soest. Soest 1996, S. 771-898; Ulrich Loer,
Zwischen Stadt und Stift. Die von Schüngel'sche Curie
Thomästraße 9, in: Norbert Wex (Hg.), Soester Schau-Plätze.
Soest 2006, S. 83-87). Die bauliche Entwicklung mit der
Entstehung separater Kurien scheint ähnlich, vermutlich aber
früher als in den Damenstiften verlaufen zu sein; zu den
Gebäuden für Minden s. Fred Kaspar, Kurienhöfe und -häu-
ser, in: Ders. (Bearb.), Einführung und Darstellung der prä-
genden Stukturen (= Stadt Minden. Bau- und Kunstdenk-
mäler von Westfalen 50, Teil 1, Teilband 1). Essen 2003, S.
379-382; zu Aspekten der Lebenswelt vgl. Klaus Scholz,
Einige Bemerkungen zu den Testamenten münsterischer
Kanoniker, in: Westfalen 58, 1980, S. 117-120.
3 Zur Lage der Stifte s. die Beikarte: Klöster und Stifte in
Westfalen um 1750, in: Westfälisches Klosterbuch 3 (wie
Anm. 1). Zahlreiche Abbildungen von Stiftsgebäuden bei
Heiko K. L. Schulze, Klöster und Stifte in Westfalen - Ge-
schichte, Baugeschichte und -beschreibung. Eine Dokumen-
tation, in: Geza Jäszai (Hg.), Monastisches Westfalen.
Klöster und Stifte 800-1800 (= Ausstellungskatalog Westfä-
lisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte).
Münster 1982, S. 309-445.
4 Die zunehmende Lockerung der Residenzpflicht führte da-
zu, dass sich im ausgehenden 18. Jahrhundert in vielen
Stiften nur noch eine der Amtsträgerinnen ständig im Stift
aufhielt. In Herdecke etwa residierte 1786 von 14 Damen
neben der Äbtissin nur mehr eine (Otto Schnettler, Herdecke
an der Ruhr im Wandel der Zeiten. Stift, Dorf, Stadt. Dort-
mund 1939, S. 279 f.) und in Gevelsberg wohnten 1794
von den 12 Damen zwei in Berlin, je eine in Bremen und
Corvey, die anderen auf den Schlössern der Familien, näm-
lich auf Haus Neuenhof bei Lüdenscheid, auf Haus Velde in
der Grafschaft Zutphen, auf Haus Reck bei Kamen sowie
jeweils zwei Schwestern zu Hackhausen bei Solingen und zu
Rauschenberg im Bergischen. Selbst die Äbtissin, Amalia
Dorothea von Kessel, residierte nicht im Stift Gevelsberg,
sondern im Stift Elsey (LAV NRW W Münster, Kriegs- u.
Domänenkammer Hamm, Nr. 740).
5 Siehe neben Otfried Ellger, Das „Raumkonzept'' der
Aachener Institutio sanctimonialium von 816 und die
Topographie sächsischer Frauenstifte im früheren Mittelalter,
in: Jan Gerchow/Fhomas Schilp (Hg.), Essen und die sächsi-
schen Frauenstifte im frühen Mittelalter. Essen 2003, S. 129-
159; auch Matthias Wemhoff, Die Änderungen der bauli-
chen Struktur westfälischer Damenstifte als Spiegel ihrer
Lebensgrundlage, in: Olaf Schirmeister (Hg.), Fromme Frauen
und Ordensmänner. Klöster und Stifte im heiligen Herford (-
Herforder Forschungen, Bd. 10; Religion in der Geschichte,
Bd. 3). Bielefeld 2000, S. 71-76.
6 Manfred Wolf, Konfessionell gemischte Stifte, in: West-
fälisches Klosterbuch 3 (wie Anm. 1), S. 245-293.
7 Leeden (Tecklenburg; Kreis Steinfurt); die 1240 gegründe-
te Zisterzienserinnen-Abtei wurde 1538 in ein freiweltliches
Damenstift mit acht Präbenden umgewandelt und am
10.02.1812 unter französischer Herrschaft aufgelöst. Ne-
ben der Kirche ist nur das unten genannte Gebäude erhal-
ten.
8 LAV NRW W Münster, Regierung Münster 20853; auf einer
Randleiste der Akte (fol. 4) befindet sich eine skizzenhafte
Darstellung der Klosteranlage mit der Unterteilung in fünf
Häuser, die hier mit nachgetragenen Bezeichnungen der Ge-
bäude wiedergegeben ist.
9 Borghorst (Steinfurt, Kr. Steinfurt); das 974 erstmalig
genannte Kanonissen-, später freiweltliche adlige, zum
14.11.1811 aufgehobene Damenstift war mit 18 Pfründen
ausgestattet: 15 für die durchweg katholischen Stiftsdamen
und drei für Kanoniker. Nur die im Text angesprochene Kurie
ist erhalten; s. Werner Friedrich/Thomas Spohn, Die von
Merveldt'sche Kurie von 1668 in Steinfurt-Borghorst, in:
Denkmalpflege in Westfalen-Lippe 2/2006, S. 74-77.
10 Zitat nach Richard Weining, Das freiweltlich-adelige
Fräuleins-Stift Borghorst. Münster 1920, S. 43f.