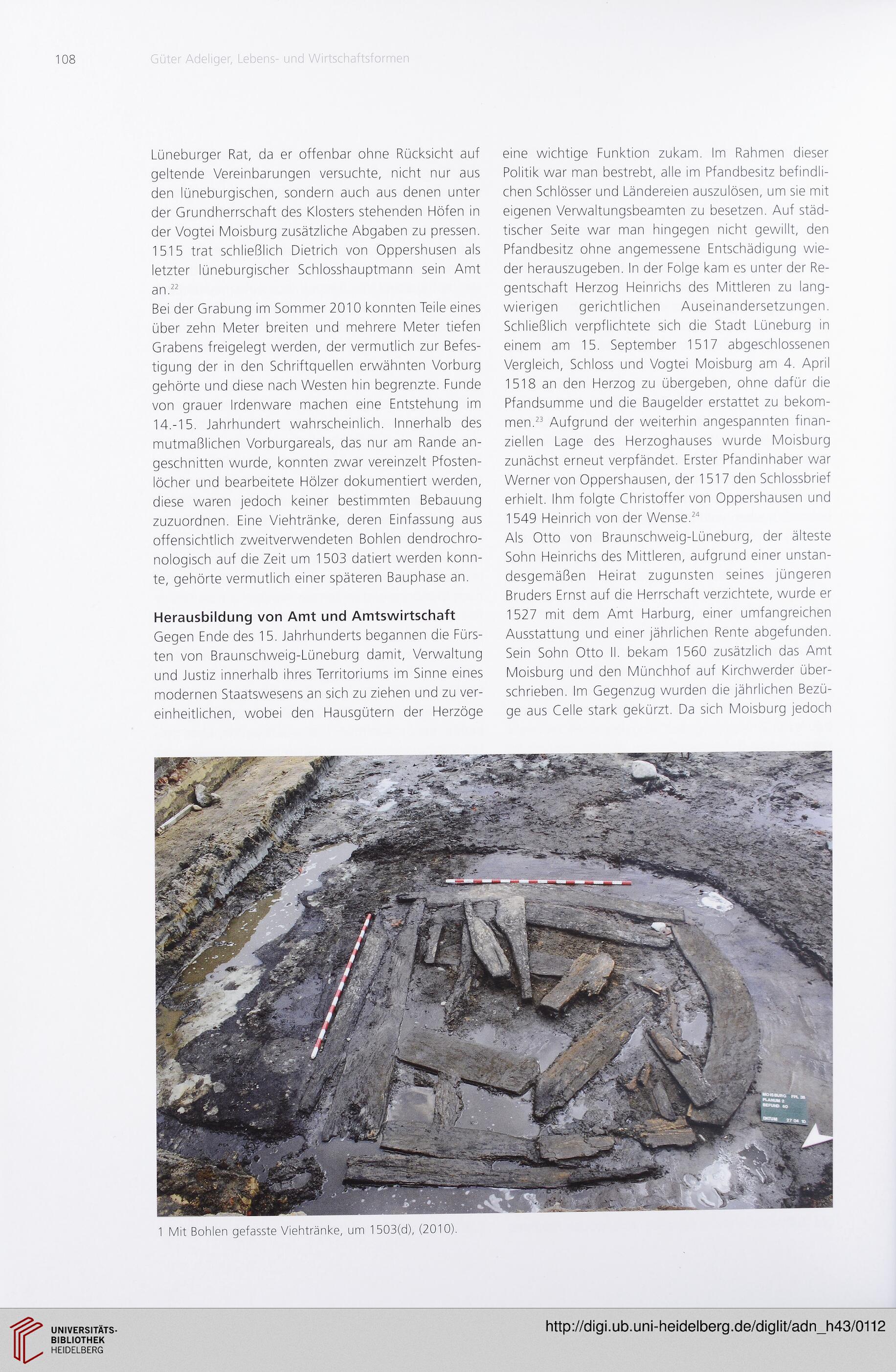108
Güter Adeliger, Lebens- und Wirtschaftsformen
Lüneburger Rat, da er offenbar ohne Rücksicht auf
geltende Vereinbarungen versuchte, nicht nur aus
den lüneburgischen, sondern auch aus denen unter
der Grundherrschaft des Klosters stehenden Höfen in
der Vogtei Moisburg zusätzliche Abgaben zu pressen.
1515 trat schließlich Dietrich von Oppershusen als
letzter lüneburgischer Schlosshauptmann sein Amt
an.22
Bei der Grabung im Sommer 2010 konnten Teile eines
über zehn Meter breiten und mehrere Meter tiefen
Grabens freigelegt werden, der vermutlich zur Befes-
tigung der in den Schriftquellen erwähnten Vorburg
gehörte und diese nach Westen hin begrenzte. Funde
von grauer Irdenware machen eine Entstehung im
14.-15. Jahrhundert wahrscheinlich. Innerhalb des
mutmaßlichen Vorburgareals, das nur am Rande an-
geschnitten wurde, konnten zwar vereinzelt Pfosten-
löcher und bearbeitete Hölzer dokumentiert werden,
diese waren jedoch keiner bestimmten Bebauung
zuzuordnen. Eine Viehtränke, deren Einfassung aus
offensichtlich zweitverwendeten Bohlen dendrochro-
nologisch auf die Zeit um 1503 datiert werden konn-
te, gehörte vermutlich einer späteren Bauphase an.
Herausbildung von Amt und Amtswirtschaft
Gegen Ende des 15. Jahrhunderts begannen die Fürs-
ten von Braunschweig-Lüneburg damit, Verwaltung
und Justiz innerhalb ihres Territoriums im Sinne eines
modernen Staatswesens an sich zu ziehen und zu ver-
einheitlichen, wobei den Hausgütern der Herzöge
eine wichtige Funktion zukam. Im Rahmen dieser
Politik war man bestrebt, alle im Pfandbesitz befindli-
chen Schlösser und Ländereien auszulösen, um sie mit
eigenen Verwaltungsbeamten zu besetzen. Auf städ-
tischer Seite war man hingegen nicht gewillt, den
Pfandbesitz ohne angemessene Entschädigung wie-
der herauszugeben. In der Folge kam es unter der Re-
gentschaft Herzog Heinrichs des Mittleren zu lang-
wierigen gerichtlichen Auseinandersetzungen.
Schließlich verpflichtete sich die Stadt Lüneburg in
einem am 15. September 1517 abgeschlossenen
Vergleich, Schloss und Vogtei Moisburg am 4. April
1518 an den Herzog zu übergeben, ohne dafür die
Pfandsumme und die Baugelder erstattet zu bekom-
men.23 Aufgrund der weiterhin angespannten finan-
ziellen Lage des Herzoghauses wurde Moisburg
zunächst erneut verpfändet. Erster Pfandinhaber war
Werner von Oppershausen, der 1517 den Schlossbrief
erhielt. Ihm folgte Christoffer von Oppershausen und
1549 Heinrich von der Wense.24
Als Otto von Braunschweig-Lüneburg, der älteste
Sohn Heinrichs des Mittleren, aufgrund einer unstan-
desgemäßen Heirat zugunsten seines jüngeren
Bruders Ernst auf die Herrschaft verzichtete, wurde er
1527 mit dem Amt Harburg, einer umfangreichen
Ausstattung und einer jährlichen Rente abgefunden.
Sein Sohn Otto II. bekam 1560 zusätzlich das Amt
Moisburg und den Münchhof auf Kirchwerder über-
schrieben. Im Gegenzug wurden die jährlichen Bezü-
ge aus Celle stark gekürzt. Da sich Moisburg jedoch
1 Mit Bohlen gefasste Viehtränke, um 1503(d), (2010).
Güter Adeliger, Lebens- und Wirtschaftsformen
Lüneburger Rat, da er offenbar ohne Rücksicht auf
geltende Vereinbarungen versuchte, nicht nur aus
den lüneburgischen, sondern auch aus denen unter
der Grundherrschaft des Klosters stehenden Höfen in
der Vogtei Moisburg zusätzliche Abgaben zu pressen.
1515 trat schließlich Dietrich von Oppershusen als
letzter lüneburgischer Schlosshauptmann sein Amt
an.22
Bei der Grabung im Sommer 2010 konnten Teile eines
über zehn Meter breiten und mehrere Meter tiefen
Grabens freigelegt werden, der vermutlich zur Befes-
tigung der in den Schriftquellen erwähnten Vorburg
gehörte und diese nach Westen hin begrenzte. Funde
von grauer Irdenware machen eine Entstehung im
14.-15. Jahrhundert wahrscheinlich. Innerhalb des
mutmaßlichen Vorburgareals, das nur am Rande an-
geschnitten wurde, konnten zwar vereinzelt Pfosten-
löcher und bearbeitete Hölzer dokumentiert werden,
diese waren jedoch keiner bestimmten Bebauung
zuzuordnen. Eine Viehtränke, deren Einfassung aus
offensichtlich zweitverwendeten Bohlen dendrochro-
nologisch auf die Zeit um 1503 datiert werden konn-
te, gehörte vermutlich einer späteren Bauphase an.
Herausbildung von Amt und Amtswirtschaft
Gegen Ende des 15. Jahrhunderts begannen die Fürs-
ten von Braunschweig-Lüneburg damit, Verwaltung
und Justiz innerhalb ihres Territoriums im Sinne eines
modernen Staatswesens an sich zu ziehen und zu ver-
einheitlichen, wobei den Hausgütern der Herzöge
eine wichtige Funktion zukam. Im Rahmen dieser
Politik war man bestrebt, alle im Pfandbesitz befindli-
chen Schlösser und Ländereien auszulösen, um sie mit
eigenen Verwaltungsbeamten zu besetzen. Auf städ-
tischer Seite war man hingegen nicht gewillt, den
Pfandbesitz ohne angemessene Entschädigung wie-
der herauszugeben. In der Folge kam es unter der Re-
gentschaft Herzog Heinrichs des Mittleren zu lang-
wierigen gerichtlichen Auseinandersetzungen.
Schließlich verpflichtete sich die Stadt Lüneburg in
einem am 15. September 1517 abgeschlossenen
Vergleich, Schloss und Vogtei Moisburg am 4. April
1518 an den Herzog zu übergeben, ohne dafür die
Pfandsumme und die Baugelder erstattet zu bekom-
men.23 Aufgrund der weiterhin angespannten finan-
ziellen Lage des Herzoghauses wurde Moisburg
zunächst erneut verpfändet. Erster Pfandinhaber war
Werner von Oppershausen, der 1517 den Schlossbrief
erhielt. Ihm folgte Christoffer von Oppershausen und
1549 Heinrich von der Wense.24
Als Otto von Braunschweig-Lüneburg, der älteste
Sohn Heinrichs des Mittleren, aufgrund einer unstan-
desgemäßen Heirat zugunsten seines jüngeren
Bruders Ernst auf die Herrschaft verzichtete, wurde er
1527 mit dem Amt Harburg, einer umfangreichen
Ausstattung und einer jährlichen Rente abgefunden.
Sein Sohn Otto II. bekam 1560 zusätzlich das Amt
Moisburg und den Münchhof auf Kirchwerder über-
schrieben. Im Gegenzug wurden die jährlichen Bezü-
ge aus Celle stark gekürzt. Da sich Moisburg jedoch
1 Mit Bohlen gefasste Viehtränke, um 1503(d), (2010).