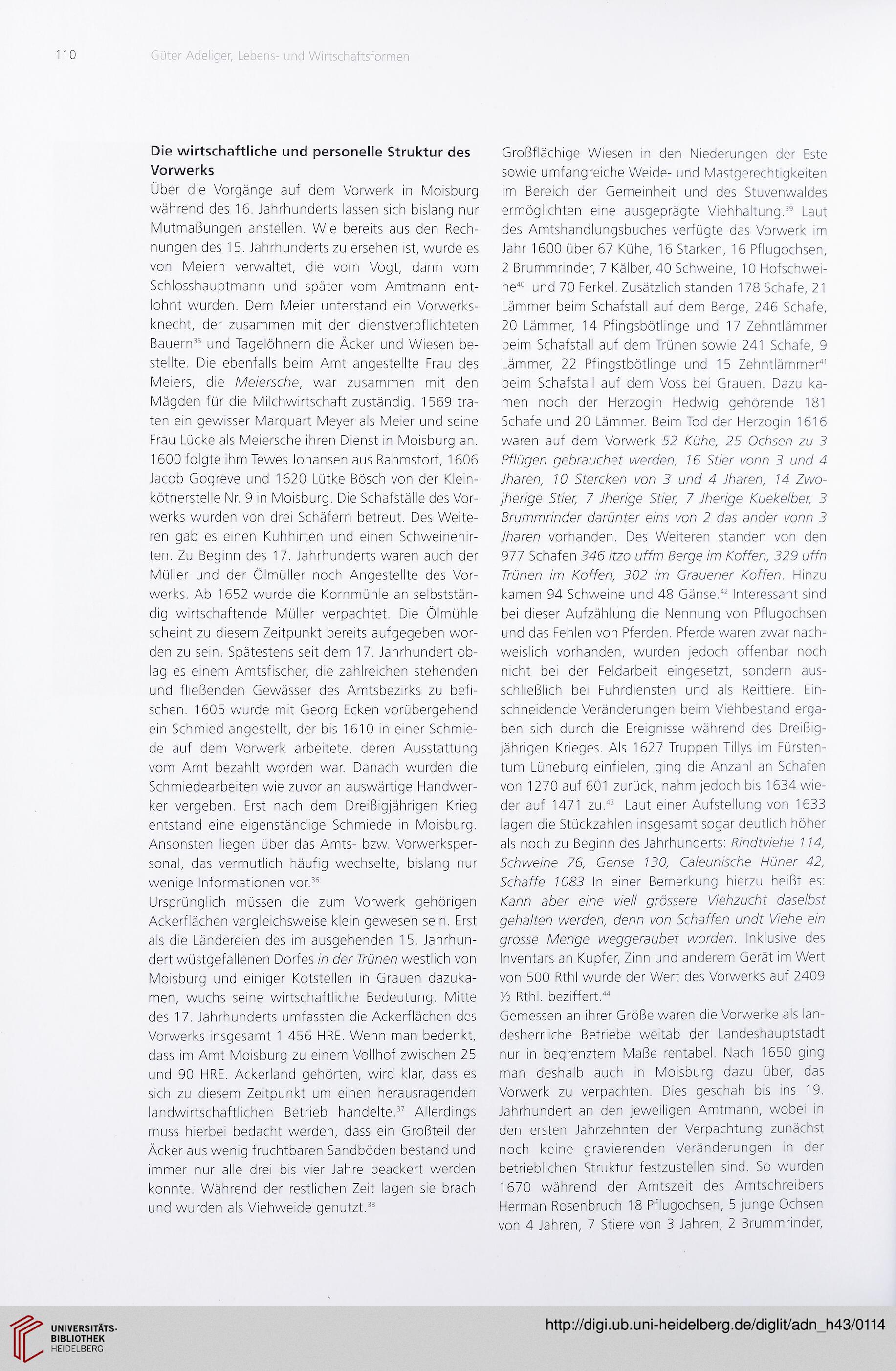110
Güter Adeliger, Lebens- und Wirtschaftsformen
Die wirtschaftliche und personelle Struktur des
Vorwerks
Über die Vorgänge auf dem Vorwerk in Moisburg
während des 16. Jahrhunderts lassen sich bislang nur
Mutmaßungen anstellen. Wie bereits aus den Rech-
nungen des 15. Jahrhunderts zu ersehen ist, wurde es
von Meiern verwaltet, die vom Vogt, dann vom
Schlosshauptmann und später vom Amtmann ent-
lohnt wurden. Dem Meier unterstand ein Vorwerks-
knecht, der zusammen mit den dienstverpflichteten
Bauern35 und Tagelöhnern die Äcker und Wiesen be-
stellte. Die ebenfalls beim Amt angestellte Frau des
Meiers, die Meiersche, war zusammen mit den
Mägden für die Milchwirtschaft zuständig. 1569 tra-
ten ein gewisser Marquart Meyer als Meier und seine
Frau Lücke als Meiersche ihren Dienst in Moisburg an.
1600 folgte ihm Tewes Johansen aus Rahmstorf, 1606
Jacob Gogreve und 1620 Lütke Bösch von der Klein-
kötnerstelle Nr. 9 in Moisburg. Die Schafställe des Vor-
werks wurden von drei Schäfern betreut. Des Weite-
ren gab es einen Kuhhirten und einen Schweinehir-
ten. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts waren auch der
Müller und der Ölmüller noch Angestellte des Vor-
werks. Ab 1652 wurde die Kornmühle an selbststän-
dig wirtschaftende Müller verpachtet. Die Ölmühle
scheint zu diesem Zeitpunkt bereits aufgegeben wor-
den zu sein. Spätestens seit dem 17. Jahrhundert ob-
lag es einem Amtsfischer, die zahlreichen stehenden
und fließenden Gewässer des Amtsbezirks zu befi-
schen. 1605 wurde mit Georg Ecken vorübergehend
ein Schmied angestellt, der bis 1610 in einer Schmie-
de auf dem Vorwerk arbeitete, deren Ausstattung
vom Amt bezahlt worden war. Danach wurden die
Schmiedearbeiten wie zuvor an auswärtige Handwer-
ker vergeben. Erst nach dem Dreißigjährigen Krieg
entstand eine eigenständige Schmiede in Moisburg.
Ansonsten liegen über das Amts- bzw. Vorwerksper-
sonal, das vermutlich häufig wechselte, bislang nur
wenige Informationen vor.36
Ursprünglich müssen die zum Vorwerk gehörigen
Ackerflächen vergleichsweise klein gewesen sein. Erst
als die Ländereien des im ausgehenden 15. Jahrhun-
dert wüstgefallenen Dorfes in der Trünen westlich von
Moisburg und einiger Kotstellen in Grauen dazuka-
men, wuchs seine wirtschaftliche Bedeutung. Mitte
des 17. Jahrhunderts umfassten die Ackerflächen des
Vorwerks insgesamt 1 456 HRE. Wenn man bedenkt,
dass im Amt Moisburg zu einem Vollhof zwischen 25
und 90 HRE. Ackerland gehörten, wird klar, dass es
sich zu diesem Zeitpunkt um einen herausragenden
landwirtschaftlichen Betrieb handelte.37 Allerdings
muss hierbei bedacht werden, dass ein Großteil der
Äcker aus wenig fruchtbaren Sandböden bestand und
immer nur alle drei bis vier Jahre beackert werden
konnte. Während der restlichen Zeit lagen sie brach
und wurden als Viehweide genutzt.38
Großflächige Wiesen in den Niederungen der Este
sowie umfangreiche Weide- und Mastgerechtigkeiten
im Bereich der Gemeinheit und des Stuvenwaldes
ermöglichten eine ausgeprägte Viehhaltung.39 Laut
des Amtshandlungsbuches verfügte das Vorwerk im
Jahr 1600 über 67 Kühe, 16 Starken, 16 Pflugochsen,
2 Brummrinder, 7 Kälber, 40 Schweine, 10 Hofschwei-
ne40 und 70 Ferkel. Zusätzlich standen 178 Schafe, 21
Lämmer beim Schafstall auf dem Berge, 246 Schafe,
20 Lämmer, 14 Pfingsbötlinge und 17 Zehntlämmer
beim Schafstall auf dem Trünen sowie 241 Schafe, 9
Lämmer, 22 Pfingstbötlinge und 15 Zehntlämmer41
beim Schafstall auf dem Voss bei Grauen. Dazu ka-
men noch der Herzogin Hedwig gehörende 181
Schafe und 20 Lämmer. Beim Tod der Herzogin 1616
waren auf dem Vorwerk 52 Kühe, 25 Ochsen zu 3
Pflügen gebrauchet werden, 16 Stier vonn 3 und 4
Jhären, 10 Stercken von 3 und 4 Jhären, 14 Zwo-
jherige Stier, 7 Jherige Stier, 7 Jherige Kuekelber, 3
Brummrinder darünter eins von 2 das ander vonn 3
Jharen vorhanden. Des Weiteren standen von den
977 Schafen 346 itzo uffm Berge im Koffen, 329 uffn
Trünen im Koffen, 302 im Grauener Koffen. Hinzu
kamen 94 Schweine und 48 Gänse.42 Interessant sind
bei dieser Aufzählung die Nennung von Pflugochsen
und das Fehlen von Pferden. Pferde waren zwar nach-
weislich vorhanden, wurden jedoch offenbar noch
nicht bei der Feldarbeit eingesetzt, sondern aus-
schließlich bei Fuhrdiensten und als Reittiere. Ein-
schneidende Veränderungen beim Viehbestand erga-
ben sich durch die Ereignisse während des Dreißig-
jährigen Krieges. Als 1627 Truppen Tillys im Fürsten-
tum Lüneburg einfielen, ging die Anzahl an Schafen
von 1270 auf 601 zurück, nahm jedoch bis 1634 wie-
der auf 1471 zu.43 Laut einer Aufstellung von 1633
lagen die Stückzahlen insgesamt sogar deutlich höher
als noch zu Beginn des Jahrhunderts: Rindtviehe 114,
Schweine 76, Gense 130, Caleunische Hüner 42,
Schaffe 1083 In einer Bemerkung hierzu heißt es:
Kann aber eine viell grössere Viehzucht daselbst
gehalten werden, denn von Schaffen undt Viehe ein
grosse Menge weggeraubet worden. Inklusive des
Inventars an Kupfer, Zinn und anderem Gerät im Wert
von 500 Rthl wurde der Wert des Vorwerks auf 2409
1/2 Rthl. beziffert.44
Gemessen an ihrer Größe waren die Vorwerke als lan-
desherrliche Betriebe weitab der Landeshauptstadt
nur in begrenztem Maße rentabel. Nach 1650 ging
man deshalb auch in Moisburg dazu über, das
Vorwerk zu verpachten. Dies geschah bis ins 19.
Jahrhundert an den jeweiligen Amtmann, wobei in
den ersten Jahrzehnten der Verpachtung zunächst
noch keine gravierenden Veränderungen in der
betrieblichen Struktur festzustellen sind. So wurden
1670 während der Amtszeit des Amtschreibers
Herman Rosenbruch 18 Pflugochsen, 5 junge Ochsen
von 4 Jahren, 7 Stiere von 3 Jahren, 2 Brummrinder,
Güter Adeliger, Lebens- und Wirtschaftsformen
Die wirtschaftliche und personelle Struktur des
Vorwerks
Über die Vorgänge auf dem Vorwerk in Moisburg
während des 16. Jahrhunderts lassen sich bislang nur
Mutmaßungen anstellen. Wie bereits aus den Rech-
nungen des 15. Jahrhunderts zu ersehen ist, wurde es
von Meiern verwaltet, die vom Vogt, dann vom
Schlosshauptmann und später vom Amtmann ent-
lohnt wurden. Dem Meier unterstand ein Vorwerks-
knecht, der zusammen mit den dienstverpflichteten
Bauern35 und Tagelöhnern die Äcker und Wiesen be-
stellte. Die ebenfalls beim Amt angestellte Frau des
Meiers, die Meiersche, war zusammen mit den
Mägden für die Milchwirtschaft zuständig. 1569 tra-
ten ein gewisser Marquart Meyer als Meier und seine
Frau Lücke als Meiersche ihren Dienst in Moisburg an.
1600 folgte ihm Tewes Johansen aus Rahmstorf, 1606
Jacob Gogreve und 1620 Lütke Bösch von der Klein-
kötnerstelle Nr. 9 in Moisburg. Die Schafställe des Vor-
werks wurden von drei Schäfern betreut. Des Weite-
ren gab es einen Kuhhirten und einen Schweinehir-
ten. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts waren auch der
Müller und der Ölmüller noch Angestellte des Vor-
werks. Ab 1652 wurde die Kornmühle an selbststän-
dig wirtschaftende Müller verpachtet. Die Ölmühle
scheint zu diesem Zeitpunkt bereits aufgegeben wor-
den zu sein. Spätestens seit dem 17. Jahrhundert ob-
lag es einem Amtsfischer, die zahlreichen stehenden
und fließenden Gewässer des Amtsbezirks zu befi-
schen. 1605 wurde mit Georg Ecken vorübergehend
ein Schmied angestellt, der bis 1610 in einer Schmie-
de auf dem Vorwerk arbeitete, deren Ausstattung
vom Amt bezahlt worden war. Danach wurden die
Schmiedearbeiten wie zuvor an auswärtige Handwer-
ker vergeben. Erst nach dem Dreißigjährigen Krieg
entstand eine eigenständige Schmiede in Moisburg.
Ansonsten liegen über das Amts- bzw. Vorwerksper-
sonal, das vermutlich häufig wechselte, bislang nur
wenige Informationen vor.36
Ursprünglich müssen die zum Vorwerk gehörigen
Ackerflächen vergleichsweise klein gewesen sein. Erst
als die Ländereien des im ausgehenden 15. Jahrhun-
dert wüstgefallenen Dorfes in der Trünen westlich von
Moisburg und einiger Kotstellen in Grauen dazuka-
men, wuchs seine wirtschaftliche Bedeutung. Mitte
des 17. Jahrhunderts umfassten die Ackerflächen des
Vorwerks insgesamt 1 456 HRE. Wenn man bedenkt,
dass im Amt Moisburg zu einem Vollhof zwischen 25
und 90 HRE. Ackerland gehörten, wird klar, dass es
sich zu diesem Zeitpunkt um einen herausragenden
landwirtschaftlichen Betrieb handelte.37 Allerdings
muss hierbei bedacht werden, dass ein Großteil der
Äcker aus wenig fruchtbaren Sandböden bestand und
immer nur alle drei bis vier Jahre beackert werden
konnte. Während der restlichen Zeit lagen sie brach
und wurden als Viehweide genutzt.38
Großflächige Wiesen in den Niederungen der Este
sowie umfangreiche Weide- und Mastgerechtigkeiten
im Bereich der Gemeinheit und des Stuvenwaldes
ermöglichten eine ausgeprägte Viehhaltung.39 Laut
des Amtshandlungsbuches verfügte das Vorwerk im
Jahr 1600 über 67 Kühe, 16 Starken, 16 Pflugochsen,
2 Brummrinder, 7 Kälber, 40 Schweine, 10 Hofschwei-
ne40 und 70 Ferkel. Zusätzlich standen 178 Schafe, 21
Lämmer beim Schafstall auf dem Berge, 246 Schafe,
20 Lämmer, 14 Pfingsbötlinge und 17 Zehntlämmer
beim Schafstall auf dem Trünen sowie 241 Schafe, 9
Lämmer, 22 Pfingstbötlinge und 15 Zehntlämmer41
beim Schafstall auf dem Voss bei Grauen. Dazu ka-
men noch der Herzogin Hedwig gehörende 181
Schafe und 20 Lämmer. Beim Tod der Herzogin 1616
waren auf dem Vorwerk 52 Kühe, 25 Ochsen zu 3
Pflügen gebrauchet werden, 16 Stier vonn 3 und 4
Jhären, 10 Stercken von 3 und 4 Jhären, 14 Zwo-
jherige Stier, 7 Jherige Stier, 7 Jherige Kuekelber, 3
Brummrinder darünter eins von 2 das ander vonn 3
Jharen vorhanden. Des Weiteren standen von den
977 Schafen 346 itzo uffm Berge im Koffen, 329 uffn
Trünen im Koffen, 302 im Grauener Koffen. Hinzu
kamen 94 Schweine und 48 Gänse.42 Interessant sind
bei dieser Aufzählung die Nennung von Pflugochsen
und das Fehlen von Pferden. Pferde waren zwar nach-
weislich vorhanden, wurden jedoch offenbar noch
nicht bei der Feldarbeit eingesetzt, sondern aus-
schließlich bei Fuhrdiensten und als Reittiere. Ein-
schneidende Veränderungen beim Viehbestand erga-
ben sich durch die Ereignisse während des Dreißig-
jährigen Krieges. Als 1627 Truppen Tillys im Fürsten-
tum Lüneburg einfielen, ging die Anzahl an Schafen
von 1270 auf 601 zurück, nahm jedoch bis 1634 wie-
der auf 1471 zu.43 Laut einer Aufstellung von 1633
lagen die Stückzahlen insgesamt sogar deutlich höher
als noch zu Beginn des Jahrhunderts: Rindtviehe 114,
Schweine 76, Gense 130, Caleunische Hüner 42,
Schaffe 1083 In einer Bemerkung hierzu heißt es:
Kann aber eine viell grössere Viehzucht daselbst
gehalten werden, denn von Schaffen undt Viehe ein
grosse Menge weggeraubet worden. Inklusive des
Inventars an Kupfer, Zinn und anderem Gerät im Wert
von 500 Rthl wurde der Wert des Vorwerks auf 2409
1/2 Rthl. beziffert.44
Gemessen an ihrer Größe waren die Vorwerke als lan-
desherrliche Betriebe weitab der Landeshauptstadt
nur in begrenztem Maße rentabel. Nach 1650 ging
man deshalb auch in Moisburg dazu über, das
Vorwerk zu verpachten. Dies geschah bis ins 19.
Jahrhundert an den jeweiligen Amtmann, wobei in
den ersten Jahrzehnten der Verpachtung zunächst
noch keine gravierenden Veränderungen in der
betrieblichen Struktur festzustellen sind. So wurden
1670 während der Amtszeit des Amtschreibers
Herman Rosenbruch 18 Pflugochsen, 5 junge Ochsen
von 4 Jahren, 7 Stiere von 3 Jahren, 2 Brummrinder,