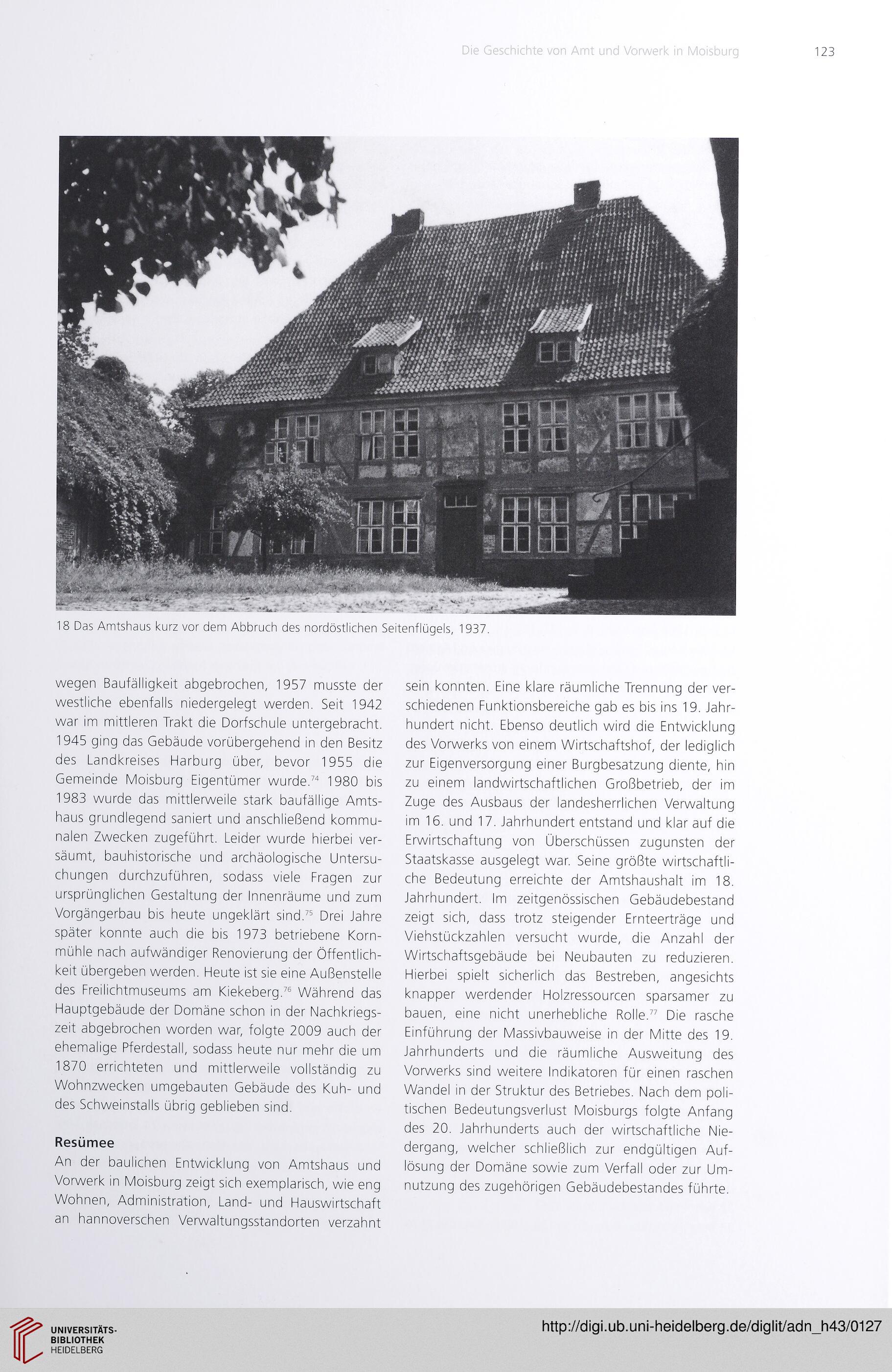Die Geschichte von Amt und Vorwerk in Moisburg
123
18 Das Amtshaus kurz vor dem Abbruch des nordöstlichen Seitenflügels, 1937.
wegen Baufälligkeit abgebrochen, 1957 musste der
westliche ebenfalls niedergelegt werden. Seit 1942
war im mittleren Trakt die Dorfschule untergebracht.
1945 ging das Gebäude vorübergehend in den Besitz
des Landkreises Harburg über, bevor 1955 die
Gemeinde Moisburg Eigentümer wurde.74 1980 bis
1983 wurde das mittlerweile stark baufällige Amts-
haus grundlegend saniert und anschließend kommu-
nalen Zwecken zugeführt. Leider wurde hierbei ver-
säumt, bauhistorische und archäologische Untersu-
chungen durchzuführen, sodass viele Fragen zur
ursprünglichen Gestaltung der Innenräume und zum
Vorgängerbau bis heute ungeklärt sind.75 Drei Jahre
später konnte auch die bis 1973 betriebene Korn-
mühle nach aufwändiger Renovierung der Öffentlich-
keit übergeben werden. Heute ist sie eine Außenstelle
des Freilichtmuseums am Kiekeberg.76 Während das
Hauptgebäude der Domäne schon in der Nachkriegs-
zeit abgebrochen worden war, folgte 2009 auch der
ehemalige Pferdestall, sodass heute nur mehr die um
1870 errichteten und mittlerweile vollständig zu
Wohnzwecken umgebauten Gebäude des Kuh- und
des Schweinstalls übrig geblieben sind.
Resümee
An der baulichen Entwicklung von Amtshaus und
Vorwerk in Moisburg zeigt sich exemplarisch, wie eng
Wohnen, Administration, Land- und Hauswirtschaft
an hannoverschen Verwaltungsstandorten verzahnt
sein konnten. Eine klare räumliche Trennung der ver-
schiedenen Funktionsbereiche gab es bis ins 19. Jahr-
hundert nicht. Ebenso deutlich wird die Entwicklung
des Vorwerks von einem Wirtschaftshof, der lediglich
zur Eigenversorgung einer Burgbesatzung diente, hin
zu einem landwirtschaftlichen Großbetrieb, der im
Zuge des Ausbaus der landesherrlichen Verwaltung
im 16. und 17. Jahrhundert entstand und klar auf die
Erwirtschaftung von Überschüssen zugunsten der
Staatskasse ausgelegt war. Seine größte wirtschaftli-
che Bedeutung erreichte der Amtshaushalt im 18.
Jahrhundert. Im zeitgenössischen Gebäudebestand
zeigt sich, dass trotz steigender Ernteerträge und
Viehstückzahlen versucht wurde, die Anzahl der
Wirtschaftsgebäude bei Neubauten zu reduzieren.
Hierbei spielt sicherlich das Bestreben, angesichts
knapper werdender Holzressourcen sparsamer zu
bauen, eine nicht unerhebliche Rolle.77 Die rasche
Einführung der Massivbauweise in der Mitte des 19.
Jahrhunderts und die räumliche Ausweitung des
Vorwerks sind weitere Indikatoren für einen raschen
Wandel in der Struktur des Betriebes. Nach dem poli-
tischen Bedeutungsverlust Moisburgs folgte Anfang
des 20. Jahrhunderts auch der wirtschaftliche Nie-
dergang, welcher schließlich zur endgültigen Auf-
lösung der Domäne sowie zum Verfall oder zur Um-
nutzung des zugehörigen Gebäudebestandes führte.
123
18 Das Amtshaus kurz vor dem Abbruch des nordöstlichen Seitenflügels, 1937.
wegen Baufälligkeit abgebrochen, 1957 musste der
westliche ebenfalls niedergelegt werden. Seit 1942
war im mittleren Trakt die Dorfschule untergebracht.
1945 ging das Gebäude vorübergehend in den Besitz
des Landkreises Harburg über, bevor 1955 die
Gemeinde Moisburg Eigentümer wurde.74 1980 bis
1983 wurde das mittlerweile stark baufällige Amts-
haus grundlegend saniert und anschließend kommu-
nalen Zwecken zugeführt. Leider wurde hierbei ver-
säumt, bauhistorische und archäologische Untersu-
chungen durchzuführen, sodass viele Fragen zur
ursprünglichen Gestaltung der Innenräume und zum
Vorgängerbau bis heute ungeklärt sind.75 Drei Jahre
später konnte auch die bis 1973 betriebene Korn-
mühle nach aufwändiger Renovierung der Öffentlich-
keit übergeben werden. Heute ist sie eine Außenstelle
des Freilichtmuseums am Kiekeberg.76 Während das
Hauptgebäude der Domäne schon in der Nachkriegs-
zeit abgebrochen worden war, folgte 2009 auch der
ehemalige Pferdestall, sodass heute nur mehr die um
1870 errichteten und mittlerweile vollständig zu
Wohnzwecken umgebauten Gebäude des Kuh- und
des Schweinstalls übrig geblieben sind.
Resümee
An der baulichen Entwicklung von Amtshaus und
Vorwerk in Moisburg zeigt sich exemplarisch, wie eng
Wohnen, Administration, Land- und Hauswirtschaft
an hannoverschen Verwaltungsstandorten verzahnt
sein konnten. Eine klare räumliche Trennung der ver-
schiedenen Funktionsbereiche gab es bis ins 19. Jahr-
hundert nicht. Ebenso deutlich wird die Entwicklung
des Vorwerks von einem Wirtschaftshof, der lediglich
zur Eigenversorgung einer Burgbesatzung diente, hin
zu einem landwirtschaftlichen Großbetrieb, der im
Zuge des Ausbaus der landesherrlichen Verwaltung
im 16. und 17. Jahrhundert entstand und klar auf die
Erwirtschaftung von Überschüssen zugunsten der
Staatskasse ausgelegt war. Seine größte wirtschaftli-
che Bedeutung erreichte der Amtshaushalt im 18.
Jahrhundert. Im zeitgenössischen Gebäudebestand
zeigt sich, dass trotz steigender Ernteerträge und
Viehstückzahlen versucht wurde, die Anzahl der
Wirtschaftsgebäude bei Neubauten zu reduzieren.
Hierbei spielt sicherlich das Bestreben, angesichts
knapper werdender Holzressourcen sparsamer zu
bauen, eine nicht unerhebliche Rolle.77 Die rasche
Einführung der Massivbauweise in der Mitte des 19.
Jahrhunderts und die räumliche Ausweitung des
Vorwerks sind weitere Indikatoren für einen raschen
Wandel in der Struktur des Betriebes. Nach dem poli-
tischen Bedeutungsverlust Moisburgs folgte Anfang
des 20. Jahrhunderts auch der wirtschaftliche Nie-
dergang, welcher schließlich zur endgültigen Auf-
lösung der Domäne sowie zum Verfall oder zur Um-
nutzung des zugehörigen Gebäudebestandes führte.