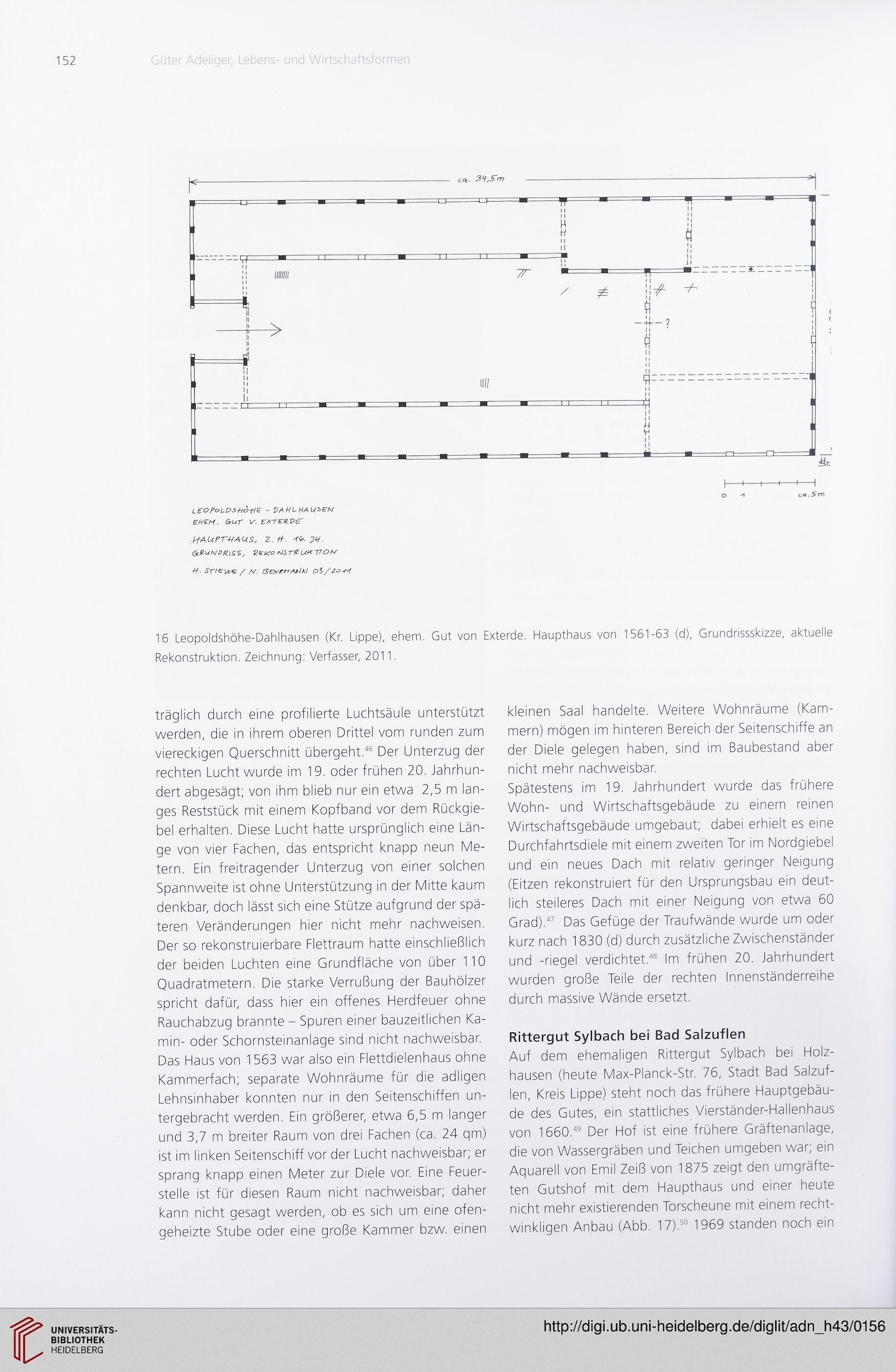152
Güter Adeliger, Lebens- und Wirtschaftsformen
ttAurr^Accs, 2. h. 7*/.
12 & ICO
■ff. S-rf&i&G z' rv. ßeo/mcjJtJ oS/zoc'f
16 Leopoldshöhe-Dahlhausen (Kr. Lippe), ehern. Gut von Exterde. Haupthaus von 1561-63 (d), Grundrissskizze, aktuelle
Rekonstruktion. Zeichnung: Verfasser, 2011.
fraglich durch eine profilierte Luchtsäule unterstützt
werden, die in ihrem oberen Drittel vom runden zum
viereckigen Querschnitt übergeht.46 Der Unterzug der
rechten Lucht wurde im 19. oder frühen 20. Jahrhun-
dert abgesägt; von ihm blieb nur ein etwa 2,5 m lan-
ges Reststück mit einem Kopfband vor dem Rückgie-
bel erhalten. Diese Lucht hatte ursprünglich eine Län-
ge von vier Fachen, das entspricht knapp neun Me-
tern. Ein freitragender Unterzug von einer solchen
Spannweite ist ohne Unterstützung in der Mitte kaum
denkbar, doch lässt sich eine Stütze aufgrund der spä-
teren Veränderungen hier nicht mehr nachweisen.
Der so rekonstruierbare Flettraum hatte einschließlich
der beiden Luchten eine Grundfläche von über 110
Quadratmetern. Die starke Verrußung der Bauhölzer
spricht dafür, dass hier ein offenes Herdfeuer ohne
Rauchabzug brannte - Spuren einer bauzeitlichen Ka-
min- oder Schornsteinanlage sind nicht nachweisbar.
Das Haus von 1563 war also ein Flettdielenhaus ohne
Kammerfach; separate Wohnräume für die adligen
Lehnsinhaber konnten nur in den Seitenschiffen un-
tergebracht werden. Ein größerer, etwa 6,5 m langer
und 3,7 m breiter Raum von drei Fachen (ca. 24 qm)
ist im linken Seitenschiff vor der Lucht nachweisbar; er
sprang knapp einen Meter zur Diele vor. Eine Feuer-
stelle ist für diesen Raum nicht nachweisbar; daher
kann nicht gesagt werden, ob es sich um eine ofen-
geheizte Stube oder eine große Kammer bzw. einen
kleinen Saal handelte. Weitere Wohnräume (Kam-
mern) mögen im hinteren Bereich der Seitenschiffe an
der Diele gelegen haben, sind im Baubestand aber
nicht mehr nachweisbar.
Spätestens im 19. Jahrhundert wurde das frühere
Wohn- und Wirtschaftsgebäude zu einem reinen
Wirtschaftsgebäude umgebaut; dabei erhielt es eine
Durchfahrtsdiele mit einem zweiten Tor im Nordgiebel
und ein neues Dach mit relativ geringer Neigung
(Eitzen rekonstruiert für den Ursprungsbau ein deut-
lich steileres Dach mit einer Neigung von etwa 60
Grad).47 Das Gefüge der Traufwände wurde um oder
kurz nach 1830 (d) durch zusätzliche Zwischenständer
und -riegel verdichtet.48 Im frühen 20. Jahrhundert
wurden große Teile der rechten Innenständerreihe
durch massive Wände ersetzt.
Rittergut Sylbach bei Bad Salzuflen
Auf dem ehemaligen Rittergut Sylbach bei Holz-
hausen (heute Max-Planck-Str. 76, Stadt Bad Salzuf-
len, Kreis Lippe) steht noch das frühere Hauptgebäu-
de des Gutes, ein stattliches Vierständer-Hallenhaus
von 1660.49 Der Hof ist eine frühere Gräftenanlage,
die von Wassergräben und Teichen umgeben war; ein
Aquarell von Emil Zeiß von 1875 zeigt den umgräfte-
ten Gutshof mit dem Haupthaus und einer heute
nicht mehr existierenden Torscheune mit einem recht-
winkligen Anbau (Abb. 17).50 1969 standen noch ein
Güter Adeliger, Lebens- und Wirtschaftsformen
ttAurr^Accs, 2. h. 7*/.
12 & ICO
■ff. S-rf&i&G z' rv. ßeo/mcjJtJ oS/zoc'f
16 Leopoldshöhe-Dahlhausen (Kr. Lippe), ehern. Gut von Exterde. Haupthaus von 1561-63 (d), Grundrissskizze, aktuelle
Rekonstruktion. Zeichnung: Verfasser, 2011.
fraglich durch eine profilierte Luchtsäule unterstützt
werden, die in ihrem oberen Drittel vom runden zum
viereckigen Querschnitt übergeht.46 Der Unterzug der
rechten Lucht wurde im 19. oder frühen 20. Jahrhun-
dert abgesägt; von ihm blieb nur ein etwa 2,5 m lan-
ges Reststück mit einem Kopfband vor dem Rückgie-
bel erhalten. Diese Lucht hatte ursprünglich eine Län-
ge von vier Fachen, das entspricht knapp neun Me-
tern. Ein freitragender Unterzug von einer solchen
Spannweite ist ohne Unterstützung in der Mitte kaum
denkbar, doch lässt sich eine Stütze aufgrund der spä-
teren Veränderungen hier nicht mehr nachweisen.
Der so rekonstruierbare Flettraum hatte einschließlich
der beiden Luchten eine Grundfläche von über 110
Quadratmetern. Die starke Verrußung der Bauhölzer
spricht dafür, dass hier ein offenes Herdfeuer ohne
Rauchabzug brannte - Spuren einer bauzeitlichen Ka-
min- oder Schornsteinanlage sind nicht nachweisbar.
Das Haus von 1563 war also ein Flettdielenhaus ohne
Kammerfach; separate Wohnräume für die adligen
Lehnsinhaber konnten nur in den Seitenschiffen un-
tergebracht werden. Ein größerer, etwa 6,5 m langer
und 3,7 m breiter Raum von drei Fachen (ca. 24 qm)
ist im linken Seitenschiff vor der Lucht nachweisbar; er
sprang knapp einen Meter zur Diele vor. Eine Feuer-
stelle ist für diesen Raum nicht nachweisbar; daher
kann nicht gesagt werden, ob es sich um eine ofen-
geheizte Stube oder eine große Kammer bzw. einen
kleinen Saal handelte. Weitere Wohnräume (Kam-
mern) mögen im hinteren Bereich der Seitenschiffe an
der Diele gelegen haben, sind im Baubestand aber
nicht mehr nachweisbar.
Spätestens im 19. Jahrhundert wurde das frühere
Wohn- und Wirtschaftsgebäude zu einem reinen
Wirtschaftsgebäude umgebaut; dabei erhielt es eine
Durchfahrtsdiele mit einem zweiten Tor im Nordgiebel
und ein neues Dach mit relativ geringer Neigung
(Eitzen rekonstruiert für den Ursprungsbau ein deut-
lich steileres Dach mit einer Neigung von etwa 60
Grad).47 Das Gefüge der Traufwände wurde um oder
kurz nach 1830 (d) durch zusätzliche Zwischenständer
und -riegel verdichtet.48 Im frühen 20. Jahrhundert
wurden große Teile der rechten Innenständerreihe
durch massive Wände ersetzt.
Rittergut Sylbach bei Bad Salzuflen
Auf dem ehemaligen Rittergut Sylbach bei Holz-
hausen (heute Max-Planck-Str. 76, Stadt Bad Salzuf-
len, Kreis Lippe) steht noch das frühere Hauptgebäu-
de des Gutes, ein stattliches Vierständer-Hallenhaus
von 1660.49 Der Hof ist eine frühere Gräftenanlage,
die von Wassergräben und Teichen umgeben war; ein
Aquarell von Emil Zeiß von 1875 zeigt den umgräfte-
ten Gutshof mit dem Haupthaus und einer heute
nicht mehr existierenden Torscheune mit einem recht-
winkligen Anbau (Abb. 17).50 1969 standen noch ein