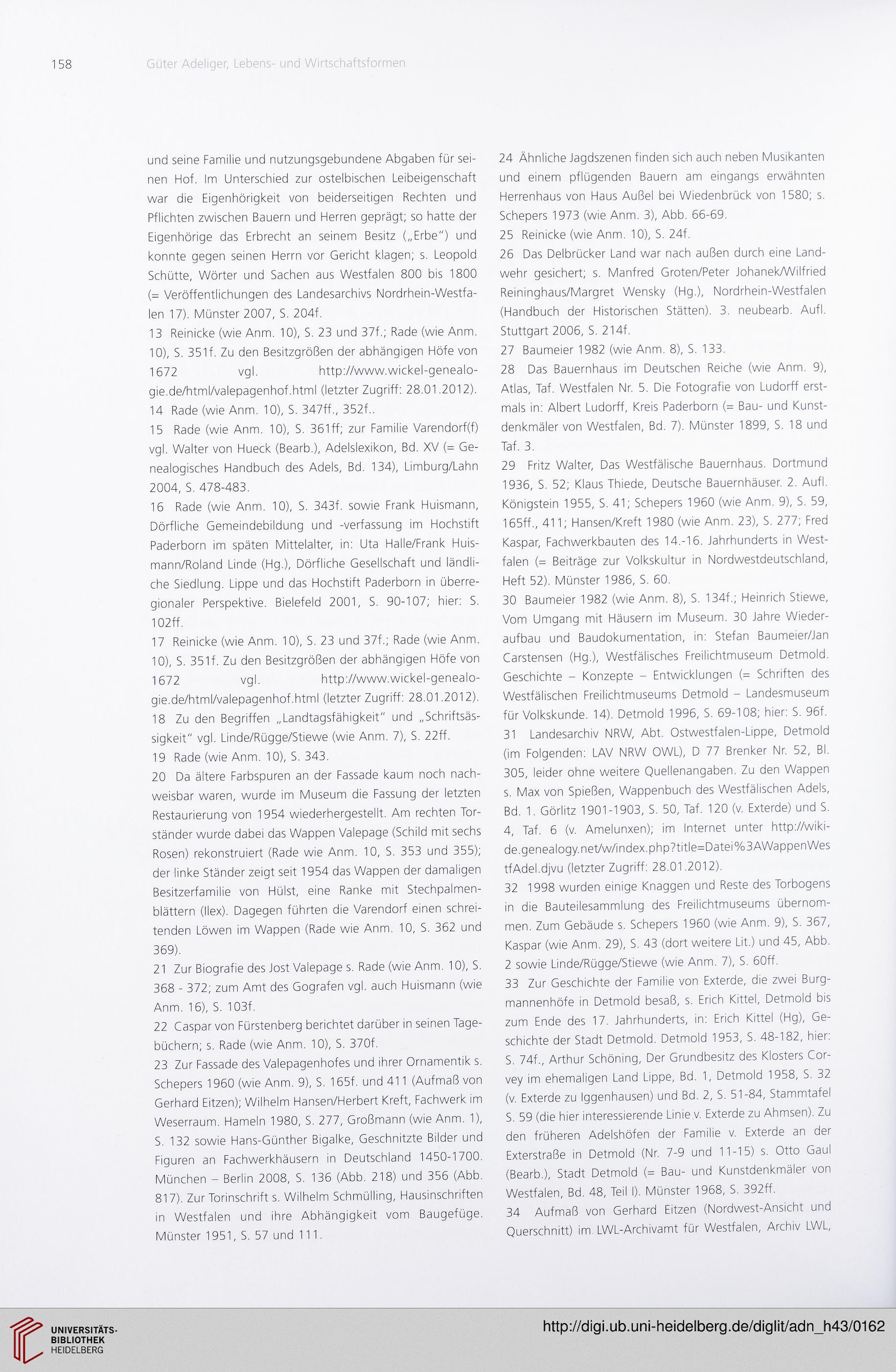158
Güter Adeliger, Lebens- und Wirtschaftsformen
und seine Familie und nutzungsgebundene Abgaben für sei-
nen Hof. Im Unterschied zur ostelbischen Leibeigenschaft
war die Eigenhörigkeit von beiderseitigen Rechten und
Pflichten zwischen Bauern und Herren geprägt; so hatte der
Eigenhörige das Erbrecht an seinem Besitz („Erbe") und
konnte gegen seinen Herrn vor Gericht klagen; s. Leopold
Schütte, Wörter und Sachen aus Westfalen 800 bis 1800
(= Veröffentlichungen des Landesarchivs Nordrhein-Westfa-
len 17). Münster 2007, S. 204f.
13 Reinicke (wie Anm. 10), S. 23 und 37f.; Rade (wie Anm.
10), S. 351 f. Zu den Besitzgrößen der abhängigen Höfe von
1672 vgl. http://www.wickel-genealo-
gie.de/html/valepagenhof.html (letzter Zugriff: 28.01.2012).
14 Rade (wie Anm. 10), S. 347ff., 352f..
15 Rade (wie Anm. 10), S. 361 ff; zur Familie Varendorf(f)
vgl. Walter von Hueck (Bearb.), Adelslexikon, Bd. XV (= Ge-
nealogisches Handbuch des Adels, Bd. 134), Limburg/Lahn
2004, S. 478-483.
16 Rade (wie Anm. 10), S. 343f. sowie Frank Huismann,
Dörfliche Gemeindebildung und -Verfassung im Hochstift
Paderborn im späten Mittelalter, in: Uta Halle/Frank Huis-
mann/Roland Linde (Hg.), Dörfliche Gesellschaft und ländli-
che Siedlung. Lippe und das Hochstift Paderborn in überre-
gionaler Perspektive. Bielefeld 2001, S. 90-107; hier: S.
102ff.
17 Reinicke (wie Anm. 10), S. 23 und 37f.; Rade (wie Anm.
10), S. 351 f. Zu den Besitzgrößen der abhängigen Höfe von
1672 vgl. http://www.wickel-genealo-
gie.de/html/valepagenhof.html (letzter Zugriff: 28.01.2012).
18 Zu den Begriffen „Landtagsfähigkeit" und „Schriftsäs-
sigkeit" vgl. Linde/Rügge/Stiewe (wie Anm. 7), S. 22ff.
19 Rade (wie Anm. 10), S. 343.
20 Da ältere Farbspuren an der Fassade kaum noch nach-
weisbar waren, wurde im Museum die Fassung der letzten
Restaurierung von 1954 wiederhergestellt. Am rechten Tor-
ständer wurde dabei das Wappen Valepage (Schild mit sechs
Rosen) rekonstruiert (Rade wie Anm. 10, S. 353 und 355);
der linke Ständer zeigt seit 1954 das Wappen der damaligen
Besitzerfamilie von Hülst, eine Ranke mit Stechpalmen-
blättern (Ilex). Dagegen führten die Varendorf einen schrei-
tenden Löwen im Wappen (Rade wie Anm. 10, S. 362 und
369).
21 Zur Biografie des Jost Valepage s. Rade (wie Anm. 10), S.
368 - 372; zum Amt des Gografen vgl. auch Huismann (wie
Anm. 16), S. 103f.
22 Caspar von Fürstenberg berichtet darüber in seinen Tage-
büchern; s. Rade (wie Anm. 10), S. 370f.
23 Zur Fassade des Valepagenhofes und ihrer Ornamentik s.
Schepers 1960 (wie Anm. 9), S. 165f. und 411 (Aufmaß von
Gerhard Eitzen); Wilhelm Hansen/Herbert Kreft, Fachwerk im
Weserraum. Hameln 1980, S. 277, Großmann (wie Anm. 1),
S. 132 sowie Hans-Günther Bigalke, Geschnitzte Bilder und
Figuren an Fachwerkhäusern in Deutschland 1450-1700.
München - Berlin 2008, S. 136 (Abb. 218) und 356 (Abb.
817). Zur Torinschrift s. Wilhelm Schmülling, Hausinschriften
in Westfalen und ihre Abhängigkeit vom Baugefüge.
Münster 1951, S. 57 und 111.
24 Ähnliche Jagdszenen finden sich auch neben Musikanten
und einem pflügenden Bauern am eingangs erwähnten
Herrenhaus von Haus Außel bei Wiedenbrück von 1580; s.
Schepers 1973 (wie Anm. 3), Abb. 66-69.
25 Reinicke (wie Anm. 10), S. 24f.
26 Das Delbrücker Land war nach außen durch eine Land-
wehr gesichert; s. Manfred Groten/Peter Johanek/Wilfried
Reininghaus/Margret Wensky (Hg.), Nordrhein-Westfalen
(Handbuch der Historischen Stätten). 3. neubearb. Aufl.
Stuttgart 2006, S. 214f.
27 Baumeier 1982 (wie Anm. 8), S. 133.
28 Das Bauernhaus im Deutschen Reiche (wie Anm. 9),
Atlas, Taf. Westfalen Nr. 5. Die Fotografie von Ludorff erst-
mals in: Albert Ludorff, Kreis Paderborn (= Bau- und Kunst-
denkmäler von Westfalen, Bd. 7). Münster 1899, S. 18 und
Taf. 3.
29 Fritz Walter, Das Westfälische Bauernhaus. Dortmund
1936, S. 52; Klaus Thiede, Deutsche Bauernhäuser. 2. Aufl.
Königstein 1955, S. 41; Schepers 1960 (wie Anm. 9), S. 59,
165ff„ 411; Hansen/Kreft 1980 (wie Anm. 23), S. 277; Fred
Kaspar, Fachwerkbauten des 14.-16. Jahrhunderts in West-
falen (= Beiträge zur Volkskultur in Nordwestdeutschland,
Heft 52). Münster 1986, S. 60.
30 Baumeier 1982 (wie Anm. 8), S. 134f.; Heinrich Stiewe,
Vom Umgang mit Häusern im Museum. 30 Jahre Wieder-
aufbau und Baudokumentation, in: Stefan Baumeier/Jan
Carstensen (Hg.), Westfälisches Freilichtmuseum Detmold.
Geschichte - Konzepte - Entwicklungen (= Schriften des
Westfälischen Freilichtmuseums Detmold - Landesmuseum
für Volkskunde. 14). Detmold 1996, S. 69-108; hier: S. 96f.
31 Landesarchiv NRW, Abt. Ostwestfalen-Lippe, Detmold
(im Folgenden: LAV NRW OWL), D 77 Brenker Nr. 52, BI.
305, leider ohne weitere Quellenangaben. Zu den Wappen
s. Max von Spießen, Wappenbuch des Westfälischen Adels,
Bd. 1. Görlitz 1901-1903, S. 50, Taf. 120 (v. Exterde) und S.
4, Taf. 6 (v. Amelunxen); im Internet unter http://wiki-
de.genealogy.net/w/index.php?title=Datei%3AWappenWes
tfAdel.djvu (letzter Zugriff: 28.01.2012).
32 1998 wurden einige Knaggen und Reste des Torbogens
in die Bauteilesammlung des Freilichtmuseums übernom-
men. Zum Gebäude s. Schepers 1960 (wie Anm. 9), S. 367,
Kaspar (wie Anm. 29), S. 43 (dort weitere Lit.) und 45, Abb.
2 sowie Linde/Rügge/Stiewe (wie Anm. 7), S. 60ff.
33 Zur Geschichte der Familie von Exterde, die zwei Burg-
mannenhöfe in Detmold besaß, s. Erich Kittel, Detmold bis
zum Ende des 17. Jahrhunderts, in: Erich Kittel (Hg), Ge-
schichte der Stadt Detmold. Detmold 1953, S. 48-182, hier:
5. 74f., Arthur Schöning, Der Grundbesitz des Klosters Cor-
vey im ehemaligen Land Lippe, Bd. 1, Detmold 1958, S. 32
(v. Exterde zu Iggenhausen) und Bd. 2, S. 51-84, Stammtafel
S. 59 (die hier interessierende Linie.v. Exterde zu Ahmsen). Zu
den früheren Adelshöfen der Familie v. Exterde an der
Exterstraße in Detmold (Nr. 7-9 und 11-15) s. Otto Gaul
(Bearb.), Stadt Detmold (= Bau- und Kunstdenkmäler von
Westfalen, Bd. 48, Teil I). Münster 1968, S. 392ff.
34 Aufmaß von Gerhard Eitzen (Nordwest-Ansicht und
Querschnitt) im LWL-Archivamt für Westfalen, Archiv LWL,
Güter Adeliger, Lebens- und Wirtschaftsformen
und seine Familie und nutzungsgebundene Abgaben für sei-
nen Hof. Im Unterschied zur ostelbischen Leibeigenschaft
war die Eigenhörigkeit von beiderseitigen Rechten und
Pflichten zwischen Bauern und Herren geprägt; so hatte der
Eigenhörige das Erbrecht an seinem Besitz („Erbe") und
konnte gegen seinen Herrn vor Gericht klagen; s. Leopold
Schütte, Wörter und Sachen aus Westfalen 800 bis 1800
(= Veröffentlichungen des Landesarchivs Nordrhein-Westfa-
len 17). Münster 2007, S. 204f.
13 Reinicke (wie Anm. 10), S. 23 und 37f.; Rade (wie Anm.
10), S. 351 f. Zu den Besitzgrößen der abhängigen Höfe von
1672 vgl. http://www.wickel-genealo-
gie.de/html/valepagenhof.html (letzter Zugriff: 28.01.2012).
14 Rade (wie Anm. 10), S. 347ff., 352f..
15 Rade (wie Anm. 10), S. 361 ff; zur Familie Varendorf(f)
vgl. Walter von Hueck (Bearb.), Adelslexikon, Bd. XV (= Ge-
nealogisches Handbuch des Adels, Bd. 134), Limburg/Lahn
2004, S. 478-483.
16 Rade (wie Anm. 10), S. 343f. sowie Frank Huismann,
Dörfliche Gemeindebildung und -Verfassung im Hochstift
Paderborn im späten Mittelalter, in: Uta Halle/Frank Huis-
mann/Roland Linde (Hg.), Dörfliche Gesellschaft und ländli-
che Siedlung. Lippe und das Hochstift Paderborn in überre-
gionaler Perspektive. Bielefeld 2001, S. 90-107; hier: S.
102ff.
17 Reinicke (wie Anm. 10), S. 23 und 37f.; Rade (wie Anm.
10), S. 351 f. Zu den Besitzgrößen der abhängigen Höfe von
1672 vgl. http://www.wickel-genealo-
gie.de/html/valepagenhof.html (letzter Zugriff: 28.01.2012).
18 Zu den Begriffen „Landtagsfähigkeit" und „Schriftsäs-
sigkeit" vgl. Linde/Rügge/Stiewe (wie Anm. 7), S. 22ff.
19 Rade (wie Anm. 10), S. 343.
20 Da ältere Farbspuren an der Fassade kaum noch nach-
weisbar waren, wurde im Museum die Fassung der letzten
Restaurierung von 1954 wiederhergestellt. Am rechten Tor-
ständer wurde dabei das Wappen Valepage (Schild mit sechs
Rosen) rekonstruiert (Rade wie Anm. 10, S. 353 und 355);
der linke Ständer zeigt seit 1954 das Wappen der damaligen
Besitzerfamilie von Hülst, eine Ranke mit Stechpalmen-
blättern (Ilex). Dagegen führten die Varendorf einen schrei-
tenden Löwen im Wappen (Rade wie Anm. 10, S. 362 und
369).
21 Zur Biografie des Jost Valepage s. Rade (wie Anm. 10), S.
368 - 372; zum Amt des Gografen vgl. auch Huismann (wie
Anm. 16), S. 103f.
22 Caspar von Fürstenberg berichtet darüber in seinen Tage-
büchern; s. Rade (wie Anm. 10), S. 370f.
23 Zur Fassade des Valepagenhofes und ihrer Ornamentik s.
Schepers 1960 (wie Anm. 9), S. 165f. und 411 (Aufmaß von
Gerhard Eitzen); Wilhelm Hansen/Herbert Kreft, Fachwerk im
Weserraum. Hameln 1980, S. 277, Großmann (wie Anm. 1),
S. 132 sowie Hans-Günther Bigalke, Geschnitzte Bilder und
Figuren an Fachwerkhäusern in Deutschland 1450-1700.
München - Berlin 2008, S. 136 (Abb. 218) und 356 (Abb.
817). Zur Torinschrift s. Wilhelm Schmülling, Hausinschriften
in Westfalen und ihre Abhängigkeit vom Baugefüge.
Münster 1951, S. 57 und 111.
24 Ähnliche Jagdszenen finden sich auch neben Musikanten
und einem pflügenden Bauern am eingangs erwähnten
Herrenhaus von Haus Außel bei Wiedenbrück von 1580; s.
Schepers 1973 (wie Anm. 3), Abb. 66-69.
25 Reinicke (wie Anm. 10), S. 24f.
26 Das Delbrücker Land war nach außen durch eine Land-
wehr gesichert; s. Manfred Groten/Peter Johanek/Wilfried
Reininghaus/Margret Wensky (Hg.), Nordrhein-Westfalen
(Handbuch der Historischen Stätten). 3. neubearb. Aufl.
Stuttgart 2006, S. 214f.
27 Baumeier 1982 (wie Anm. 8), S. 133.
28 Das Bauernhaus im Deutschen Reiche (wie Anm. 9),
Atlas, Taf. Westfalen Nr. 5. Die Fotografie von Ludorff erst-
mals in: Albert Ludorff, Kreis Paderborn (= Bau- und Kunst-
denkmäler von Westfalen, Bd. 7). Münster 1899, S. 18 und
Taf. 3.
29 Fritz Walter, Das Westfälische Bauernhaus. Dortmund
1936, S. 52; Klaus Thiede, Deutsche Bauernhäuser. 2. Aufl.
Königstein 1955, S. 41; Schepers 1960 (wie Anm. 9), S. 59,
165ff„ 411; Hansen/Kreft 1980 (wie Anm. 23), S. 277; Fred
Kaspar, Fachwerkbauten des 14.-16. Jahrhunderts in West-
falen (= Beiträge zur Volkskultur in Nordwestdeutschland,
Heft 52). Münster 1986, S. 60.
30 Baumeier 1982 (wie Anm. 8), S. 134f.; Heinrich Stiewe,
Vom Umgang mit Häusern im Museum. 30 Jahre Wieder-
aufbau und Baudokumentation, in: Stefan Baumeier/Jan
Carstensen (Hg.), Westfälisches Freilichtmuseum Detmold.
Geschichte - Konzepte - Entwicklungen (= Schriften des
Westfälischen Freilichtmuseums Detmold - Landesmuseum
für Volkskunde. 14). Detmold 1996, S. 69-108; hier: S. 96f.
31 Landesarchiv NRW, Abt. Ostwestfalen-Lippe, Detmold
(im Folgenden: LAV NRW OWL), D 77 Brenker Nr. 52, BI.
305, leider ohne weitere Quellenangaben. Zu den Wappen
s. Max von Spießen, Wappenbuch des Westfälischen Adels,
Bd. 1. Görlitz 1901-1903, S. 50, Taf. 120 (v. Exterde) und S.
4, Taf. 6 (v. Amelunxen); im Internet unter http://wiki-
de.genealogy.net/w/index.php?title=Datei%3AWappenWes
tfAdel.djvu (letzter Zugriff: 28.01.2012).
32 1998 wurden einige Knaggen und Reste des Torbogens
in die Bauteilesammlung des Freilichtmuseums übernom-
men. Zum Gebäude s. Schepers 1960 (wie Anm. 9), S. 367,
Kaspar (wie Anm. 29), S. 43 (dort weitere Lit.) und 45, Abb.
2 sowie Linde/Rügge/Stiewe (wie Anm. 7), S. 60ff.
33 Zur Geschichte der Familie von Exterde, die zwei Burg-
mannenhöfe in Detmold besaß, s. Erich Kittel, Detmold bis
zum Ende des 17. Jahrhunderts, in: Erich Kittel (Hg), Ge-
schichte der Stadt Detmold. Detmold 1953, S. 48-182, hier:
5. 74f., Arthur Schöning, Der Grundbesitz des Klosters Cor-
vey im ehemaligen Land Lippe, Bd. 1, Detmold 1958, S. 32
(v. Exterde zu Iggenhausen) und Bd. 2, S. 51-84, Stammtafel
S. 59 (die hier interessierende Linie.v. Exterde zu Ahmsen). Zu
den früheren Adelshöfen der Familie v. Exterde an der
Exterstraße in Detmold (Nr. 7-9 und 11-15) s. Otto Gaul
(Bearb.), Stadt Detmold (= Bau- und Kunstdenkmäler von
Westfalen, Bd. 48, Teil I). Münster 1968, S. 392ff.
34 Aufmaß von Gerhard Eitzen (Nordwest-Ansicht und
Querschnitt) im LWL-Archivamt für Westfalen, Archiv LWL,