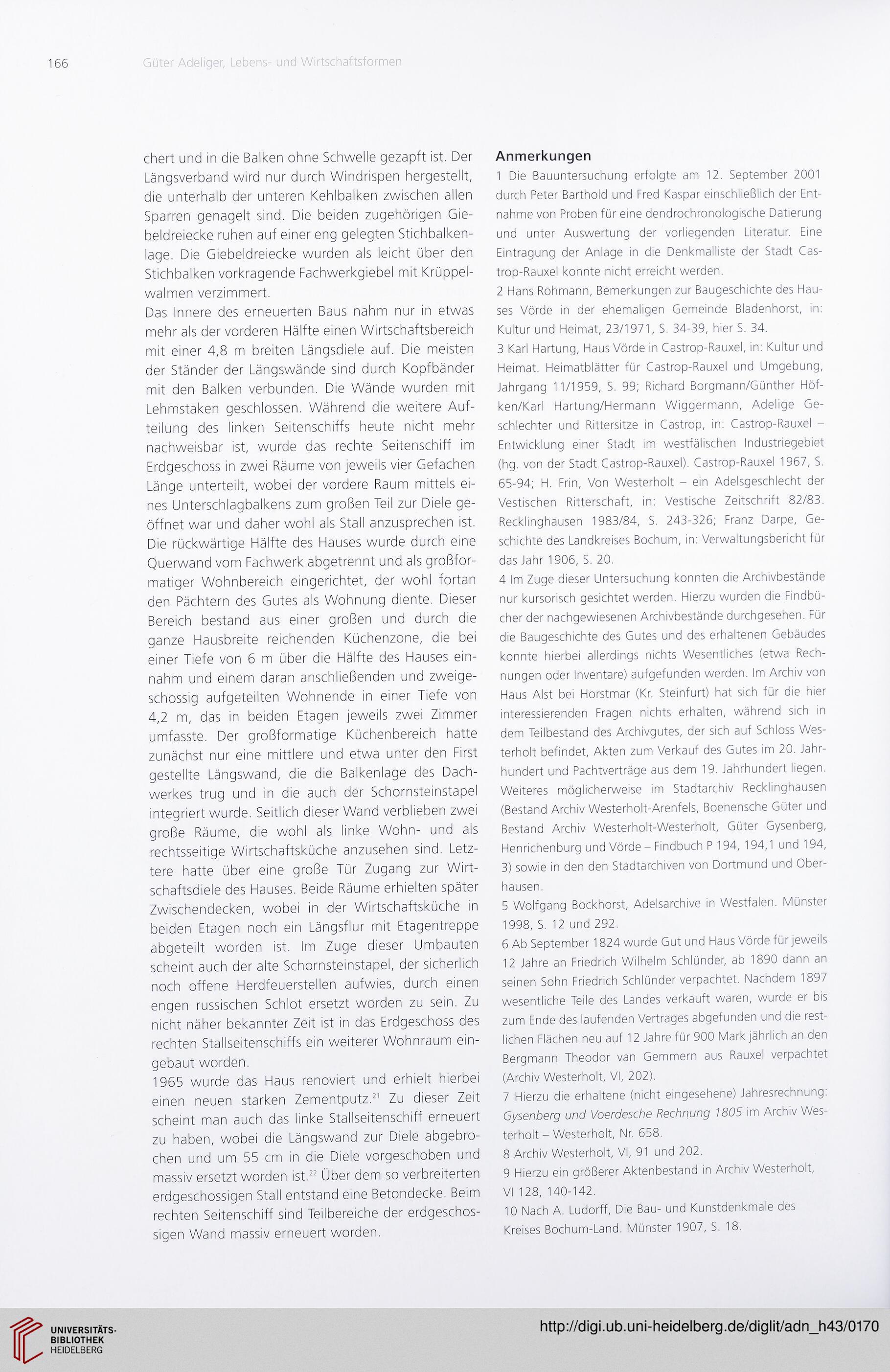166
Güter Adeliger, Lebens- und Wirtschaftsformen
chert und in die Balken ohne Schwelle gezapft ist. Der
Längsverband wird nur durch Windrispen hergestellt,
die unterhalb der unteren Kehlbalken zwischen allen
Sparren genagelt sind. Die beiden zugehörigen Gie-
beldreiecke ruhen auf einer eng gelegten Stichbalken-
lage. Die Giebeldreiecke wurden als leicht über den
Stichbalken vorkragende Fachwerkgiebel mit Krüppel-
walmen verzimmert.
Das Innere des erneuerten Baus nahm nur in etwas
mehr als der vorderen Hälfte einen Wirtschaftsbereich
mit einer 4,8 m breiten Längsdiele auf. Die meisten
der Ständer der Längswände sind durch Kopfbänder
mit den Balken verbunden. Die Wände wurden mit
Lehmstaken geschlossen. Während die weitere Auf-
teilung des linken Seitenschiffs heute nicht mehr
nachweisbar ist, wurde das rechte Seitenschiff im
Erdgeschoss in zwei Räume von jeweils vier Gefachen
Länge unterteilt, wobei der vordere Raum mittels ei-
nes Unterschlagbalkens zum großen Teil zur Diele ge-
öffnet war und daher wohl als Stall anzusprechen ist.
Die rückwärtige Hälfte des Hauses wurde durch eine
Querwand vom Fachwerk abgetrennt und als großfor-
matiger Wohnbereich eingerichtet, der wohl fortan
den Pächtern des Gutes als Wohnung diente. Dieser
Bereich bestand aus einer großen und durch die
ganze Hausbreite reichenden Küchenzone, die bei
einer Tiefe von 6 m über die Hälfte des Hauses ein-
nahm und einem daran anschließenden und zweige-
schossig aufgeteilten Wohnende in einer Tiefe von
4,2 m, das in beiden Etagen jeweils zwei Zimmer
umfasste. Der großformatige Küchenbereich hatte
zunächst nur eine mittlere und etwa unter den First
gestellte Längswand, die die Balkenlage des Dach-
werkes trug und in die auch der Schornsteinstapel
integriert wurde. Seitlich dieser Wand verblieben zwei
große Räume, die wohl als linke Wohn- und als
rechtsseitige Wirtschaftsküche anzusehen sind. Letz-
tere hatte über eine große Tür Zugang zur Wirt-
schaftsdiele des Hauses. Beide Räume erhielten später
Zwischendecken, wobei in der Wirtschaftsküche in
beiden Etagen noch ein Längsflur mit Etagentreppe
abgeteilt worden ist. Im Zuge dieser Umbauten
scheint auch der alte Schornsteinstapel, der sicherlich
noch offene Herdfeuerstellen aufwies, durch einen
engen russischen Schlot ersetzt worden zu sein. Zu
nicht näher bekannter Zeit ist in das Erdgeschoss des
rechten Stallseitenschiffs ein weiterer Wohnraum ein-
gebaut worden.
1965 wurde das Haus renoviert und erhielt hierbei
einen neuen starken Zementputz.21 Zu dieser Zeit
scheint man auch das linke Stallseitenschiff erneuert
zu haben, wobei die Längswand zur Diele abgebro-
chen und um 55 cm in die Diele vorgeschoben und
massiv ersetzt worden ist.22 Über dem so verbreiterten
erdgeschossigen Stall entstand eine Betondecke. Beim
rechten Seitenschiff sind Teilbereiche der erdgeschos-
sigen Wand massiv erneuert worden.
Anmerkungen
1 Die Bauuntersuchung erfolgte am 12. September 2001
durch Peter Barthold und Fred Kaspar einschließlich der Ent-
nahme von Proben für eine dendrochronologische Datierung
und unter Auswertung der vorliegenden Literatur. Eine
Eintragung der Anlage in die Denkmalliste der Stadt Cas-
trop-Rauxel konnte nicht erreicht werden.
2 Hans Rohmann, Bemerkungen zur Baugeschichte des Hau-
ses Vörde in der ehemaligen Gemeinde Bladenhorst, in:
Kultur und Heimat, 23/1971, S. 34-39, hier S. 34.
3 Karl Hartung, Haus Vörde in Castrop-Rauxel, in: Kultur und
Heimat. Heimatblätter für Castrop-Rauxel und Umgebung,
Jahrgang 1 1/1959, S. 99; Richard Borgmann/Günther Höf-
ken/Karl Hartung/Hermann Wiggermann, Adelige Ge-
schlechter und Rittersitze in Castrop, in: Castrop-Rauxel -
Entwicklung einer Stadt im westfälischen Industriegebiet
(hg. von der Stadt Castrop-Rauxel). Castrop-Rauxel 1967, S.
65-94; H. Frin, Von Westerholt - ein Adelsgeschlecht der
Vestischen Ritterschaft, in: Vestische Zeitschrift 82/83.
Recklinghausen 1983/84, S. 243-326; Franz Darpe, Ge-
schichte des Landkreises Bochum, in: Verwaltungsbericht für
das Jahr 1906, S. 20.
4 Im Zuge dieser Untersuchung konnten die Archivbestände
nur kursorisch gesichtet werden. Hierzu wurden die Findbü-
cher der nachgewiesenen Archivbestände durchgesehen. Für
die Baugeschichte des Gutes und des erhaltenen Gebäudes
konnte hierbei allerdings nichts Wesentliches (etwa Rech-
nungen oder Inventare) aufgefunden werden. Im Archiv von
Haus Alst bei Horstmar (Kr. Steinfurt) hat sich für die hier
interessierenden Fragen nichts erhalten, während sich in
dem Teilbestand des Archivgutes, der sich auf Schloss Wes-
terholt befindet, Akten zum Verkauf des Gutes im 20. Jahr-
hundert und Pachtverträge aus dem 19. Jahrhundert liegen.
Weiteres möglicherweise im Stadtarchiv Recklinghausen
(Bestand Archiv Westerholt-Arenfels, Boenensche Güter und
Bestand Archiv Westerholt-Westerholt, Güter Gysenberg,
Henrichenburg und Vörde - Findbuch P 194, 194,1 und 194,
3) sowie in den den Stadtarchiven von Dortmund und Ober-
hausen.
5 Wolfgang Bockhorst, Adelsarchive in Westfalen. Münster
1998, S. 12 und 292.
6 Ab September 1824 wurde Gut und Haus Vörde für jeweils
12 Jahre an Friedrich Wilhelm Schlünder, ab 1890 dann an
seinen Sohn Friedrich Schlünder verpachtet. Nachdem 1897
wesentliche Teile des Landes verkauft waren, wurde er bis
zum Ende des laufenden Vertrages abgefunden und die rest-
lichen Flächen neu auf 12 Jahre für 900 Mark jährlich an den
Bergmann Theodor van Gemmern aus Rauxel verpachtet
(Archiv Westerholt, VI, 202).
7 Hierzu die erhaltene (nicht eingesehene) Jahresrechnung:
Gysenberg und Voerdesche Rechnung 1805 im Archiv Wes-
terholt - Westerholt, Nr. 658.
8 Archiv Westerholt, VI, 91 und 202.
9 Hierzu ein größerer Aktenbestand in Archiv Westerholt,
VI 128, 140-142.
10 Nach A. Ludorff, Die Bau- und Kunstdenkmale des
Kreises Bochum-Land. Münster 1907, S. 18.
Güter Adeliger, Lebens- und Wirtschaftsformen
chert und in die Balken ohne Schwelle gezapft ist. Der
Längsverband wird nur durch Windrispen hergestellt,
die unterhalb der unteren Kehlbalken zwischen allen
Sparren genagelt sind. Die beiden zugehörigen Gie-
beldreiecke ruhen auf einer eng gelegten Stichbalken-
lage. Die Giebeldreiecke wurden als leicht über den
Stichbalken vorkragende Fachwerkgiebel mit Krüppel-
walmen verzimmert.
Das Innere des erneuerten Baus nahm nur in etwas
mehr als der vorderen Hälfte einen Wirtschaftsbereich
mit einer 4,8 m breiten Längsdiele auf. Die meisten
der Ständer der Längswände sind durch Kopfbänder
mit den Balken verbunden. Die Wände wurden mit
Lehmstaken geschlossen. Während die weitere Auf-
teilung des linken Seitenschiffs heute nicht mehr
nachweisbar ist, wurde das rechte Seitenschiff im
Erdgeschoss in zwei Räume von jeweils vier Gefachen
Länge unterteilt, wobei der vordere Raum mittels ei-
nes Unterschlagbalkens zum großen Teil zur Diele ge-
öffnet war und daher wohl als Stall anzusprechen ist.
Die rückwärtige Hälfte des Hauses wurde durch eine
Querwand vom Fachwerk abgetrennt und als großfor-
matiger Wohnbereich eingerichtet, der wohl fortan
den Pächtern des Gutes als Wohnung diente. Dieser
Bereich bestand aus einer großen und durch die
ganze Hausbreite reichenden Küchenzone, die bei
einer Tiefe von 6 m über die Hälfte des Hauses ein-
nahm und einem daran anschließenden und zweige-
schossig aufgeteilten Wohnende in einer Tiefe von
4,2 m, das in beiden Etagen jeweils zwei Zimmer
umfasste. Der großformatige Küchenbereich hatte
zunächst nur eine mittlere und etwa unter den First
gestellte Längswand, die die Balkenlage des Dach-
werkes trug und in die auch der Schornsteinstapel
integriert wurde. Seitlich dieser Wand verblieben zwei
große Räume, die wohl als linke Wohn- und als
rechtsseitige Wirtschaftsküche anzusehen sind. Letz-
tere hatte über eine große Tür Zugang zur Wirt-
schaftsdiele des Hauses. Beide Räume erhielten später
Zwischendecken, wobei in der Wirtschaftsküche in
beiden Etagen noch ein Längsflur mit Etagentreppe
abgeteilt worden ist. Im Zuge dieser Umbauten
scheint auch der alte Schornsteinstapel, der sicherlich
noch offene Herdfeuerstellen aufwies, durch einen
engen russischen Schlot ersetzt worden zu sein. Zu
nicht näher bekannter Zeit ist in das Erdgeschoss des
rechten Stallseitenschiffs ein weiterer Wohnraum ein-
gebaut worden.
1965 wurde das Haus renoviert und erhielt hierbei
einen neuen starken Zementputz.21 Zu dieser Zeit
scheint man auch das linke Stallseitenschiff erneuert
zu haben, wobei die Längswand zur Diele abgebro-
chen und um 55 cm in die Diele vorgeschoben und
massiv ersetzt worden ist.22 Über dem so verbreiterten
erdgeschossigen Stall entstand eine Betondecke. Beim
rechten Seitenschiff sind Teilbereiche der erdgeschos-
sigen Wand massiv erneuert worden.
Anmerkungen
1 Die Bauuntersuchung erfolgte am 12. September 2001
durch Peter Barthold und Fred Kaspar einschließlich der Ent-
nahme von Proben für eine dendrochronologische Datierung
und unter Auswertung der vorliegenden Literatur. Eine
Eintragung der Anlage in die Denkmalliste der Stadt Cas-
trop-Rauxel konnte nicht erreicht werden.
2 Hans Rohmann, Bemerkungen zur Baugeschichte des Hau-
ses Vörde in der ehemaligen Gemeinde Bladenhorst, in:
Kultur und Heimat, 23/1971, S. 34-39, hier S. 34.
3 Karl Hartung, Haus Vörde in Castrop-Rauxel, in: Kultur und
Heimat. Heimatblätter für Castrop-Rauxel und Umgebung,
Jahrgang 1 1/1959, S. 99; Richard Borgmann/Günther Höf-
ken/Karl Hartung/Hermann Wiggermann, Adelige Ge-
schlechter und Rittersitze in Castrop, in: Castrop-Rauxel -
Entwicklung einer Stadt im westfälischen Industriegebiet
(hg. von der Stadt Castrop-Rauxel). Castrop-Rauxel 1967, S.
65-94; H. Frin, Von Westerholt - ein Adelsgeschlecht der
Vestischen Ritterschaft, in: Vestische Zeitschrift 82/83.
Recklinghausen 1983/84, S. 243-326; Franz Darpe, Ge-
schichte des Landkreises Bochum, in: Verwaltungsbericht für
das Jahr 1906, S. 20.
4 Im Zuge dieser Untersuchung konnten die Archivbestände
nur kursorisch gesichtet werden. Hierzu wurden die Findbü-
cher der nachgewiesenen Archivbestände durchgesehen. Für
die Baugeschichte des Gutes und des erhaltenen Gebäudes
konnte hierbei allerdings nichts Wesentliches (etwa Rech-
nungen oder Inventare) aufgefunden werden. Im Archiv von
Haus Alst bei Horstmar (Kr. Steinfurt) hat sich für die hier
interessierenden Fragen nichts erhalten, während sich in
dem Teilbestand des Archivgutes, der sich auf Schloss Wes-
terholt befindet, Akten zum Verkauf des Gutes im 20. Jahr-
hundert und Pachtverträge aus dem 19. Jahrhundert liegen.
Weiteres möglicherweise im Stadtarchiv Recklinghausen
(Bestand Archiv Westerholt-Arenfels, Boenensche Güter und
Bestand Archiv Westerholt-Westerholt, Güter Gysenberg,
Henrichenburg und Vörde - Findbuch P 194, 194,1 und 194,
3) sowie in den den Stadtarchiven von Dortmund und Ober-
hausen.
5 Wolfgang Bockhorst, Adelsarchive in Westfalen. Münster
1998, S. 12 und 292.
6 Ab September 1824 wurde Gut und Haus Vörde für jeweils
12 Jahre an Friedrich Wilhelm Schlünder, ab 1890 dann an
seinen Sohn Friedrich Schlünder verpachtet. Nachdem 1897
wesentliche Teile des Landes verkauft waren, wurde er bis
zum Ende des laufenden Vertrages abgefunden und die rest-
lichen Flächen neu auf 12 Jahre für 900 Mark jährlich an den
Bergmann Theodor van Gemmern aus Rauxel verpachtet
(Archiv Westerholt, VI, 202).
7 Hierzu die erhaltene (nicht eingesehene) Jahresrechnung:
Gysenberg und Voerdesche Rechnung 1805 im Archiv Wes-
terholt - Westerholt, Nr. 658.
8 Archiv Westerholt, VI, 91 und 202.
9 Hierzu ein größerer Aktenbestand in Archiv Westerholt,
VI 128, 140-142.
10 Nach A. Ludorff, Die Bau- und Kunstdenkmale des
Kreises Bochum-Land. Münster 1907, S. 18.