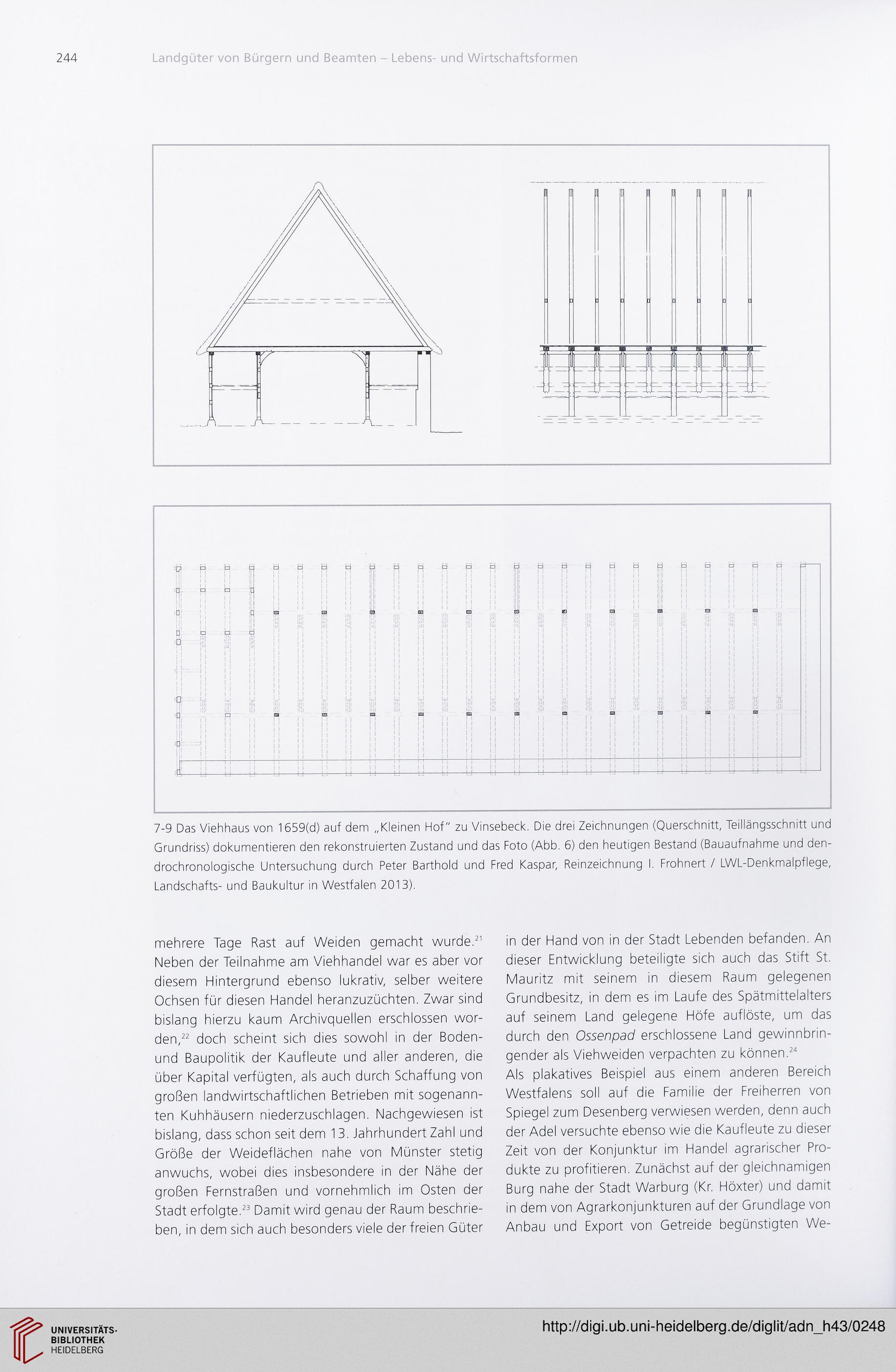244
Landgüter von Bürgern und Beamten - Lebens- und Wirtschaftsformen
7-9 Das Viehhaus von 1659(d) auf dem „Kleinen Hof" zu Vinsebeck. Die drei Zeichnungen (Querschnitt, Teillängsschnitt und
Grundriss) dokumentieren den rekonstruierten Zustand und das Foto (Abb. 6) den heutigen Bestand (Bauaufnahme und den-
drochronologische Untersuchung durch Peter Barthold und Fred Kaspar, Reinzeichnung I. Frohnert / LWL-Denkmalpflege,
Landschafts- und Baukultur in Westfalen 2013).
mehrere Tage Rast auf Weiden gemacht wurde.21
Neben der Teilnahme am Viehhandel war es aber vor
diesem Hintergrund ebenso lukrativ, selber weitere
Ochsen für diesen Handel heranzuzüchten. Zwar sind
bislang hierzu kaum Archivquellen erschlossen wor-
den,22 doch scheint sich dies sowohl in der Boden-
und Baupolitik der Kaufleute und aller anderen, die
über Kapital verfügten, als auch durch Schaffung von
großen landwirtschaftlichen Betrieben mit sogenann-
ten Kuhhäusern niederzuschlagen. Nachgewiesen ist
bislang, dass schon seit dem 13. Jahrhundert Zahl und
Größe der Weideflächen nahe von Münster stetig
anwuchs, wobei dies insbesondere in der Nähe der
großen Fernstraßen und vornehmlich im Osten der
Stadt erfolgte.23 Damit wird genau der Raum beschrie-
ben, in dem sich auch besonders viele der freien Güter
in der Hand von in der Stadt Lebenden befanden. An
dieser Entwicklung beteiligte sich auch das Stift St.
Mauritz mit seinem in diesem Raum gelegenen
Grundbesitz, in dem es im Laufe des Spätmittelalters
auf seinem Land gelegene Höfe auflöste, um das
durch den Ossenpad erschlossene Land gewinnbrin-
gender als Viehweiden verpachten zu können.24
Als plakatives Beispiel aus einem anderen Bereich
Westfalens soll auf die Familie der Freiherren von
Spiegel zum Desenberg verwiesen werden, denn auch
der Adel versuchte ebenso wie die Kaufleute zu dieser
Zeit von der Konjunktur im Handel agrarischer Pro-
dukte zu profitieren. Zunächst auf der gleichnamigen
Burg nahe der Stadt Warburg (Kr. Höxter) und damit
in dem von Agrarkonjunkturen auf der Grundlage von
Anbau und Export von Getreide begünstigten We-
Landgüter von Bürgern und Beamten - Lebens- und Wirtschaftsformen
7-9 Das Viehhaus von 1659(d) auf dem „Kleinen Hof" zu Vinsebeck. Die drei Zeichnungen (Querschnitt, Teillängsschnitt und
Grundriss) dokumentieren den rekonstruierten Zustand und das Foto (Abb. 6) den heutigen Bestand (Bauaufnahme und den-
drochronologische Untersuchung durch Peter Barthold und Fred Kaspar, Reinzeichnung I. Frohnert / LWL-Denkmalpflege,
Landschafts- und Baukultur in Westfalen 2013).
mehrere Tage Rast auf Weiden gemacht wurde.21
Neben der Teilnahme am Viehhandel war es aber vor
diesem Hintergrund ebenso lukrativ, selber weitere
Ochsen für diesen Handel heranzuzüchten. Zwar sind
bislang hierzu kaum Archivquellen erschlossen wor-
den,22 doch scheint sich dies sowohl in der Boden-
und Baupolitik der Kaufleute und aller anderen, die
über Kapital verfügten, als auch durch Schaffung von
großen landwirtschaftlichen Betrieben mit sogenann-
ten Kuhhäusern niederzuschlagen. Nachgewiesen ist
bislang, dass schon seit dem 13. Jahrhundert Zahl und
Größe der Weideflächen nahe von Münster stetig
anwuchs, wobei dies insbesondere in der Nähe der
großen Fernstraßen und vornehmlich im Osten der
Stadt erfolgte.23 Damit wird genau der Raum beschrie-
ben, in dem sich auch besonders viele der freien Güter
in der Hand von in der Stadt Lebenden befanden. An
dieser Entwicklung beteiligte sich auch das Stift St.
Mauritz mit seinem in diesem Raum gelegenen
Grundbesitz, in dem es im Laufe des Spätmittelalters
auf seinem Land gelegene Höfe auflöste, um das
durch den Ossenpad erschlossene Land gewinnbrin-
gender als Viehweiden verpachten zu können.24
Als plakatives Beispiel aus einem anderen Bereich
Westfalens soll auf die Familie der Freiherren von
Spiegel zum Desenberg verwiesen werden, denn auch
der Adel versuchte ebenso wie die Kaufleute zu dieser
Zeit von der Konjunktur im Handel agrarischer Pro-
dukte zu profitieren. Zunächst auf der gleichnamigen
Burg nahe der Stadt Warburg (Kr. Höxter) und damit
in dem von Agrarkonjunkturen auf der Grundlage von
Anbau und Export von Getreide begünstigten We-