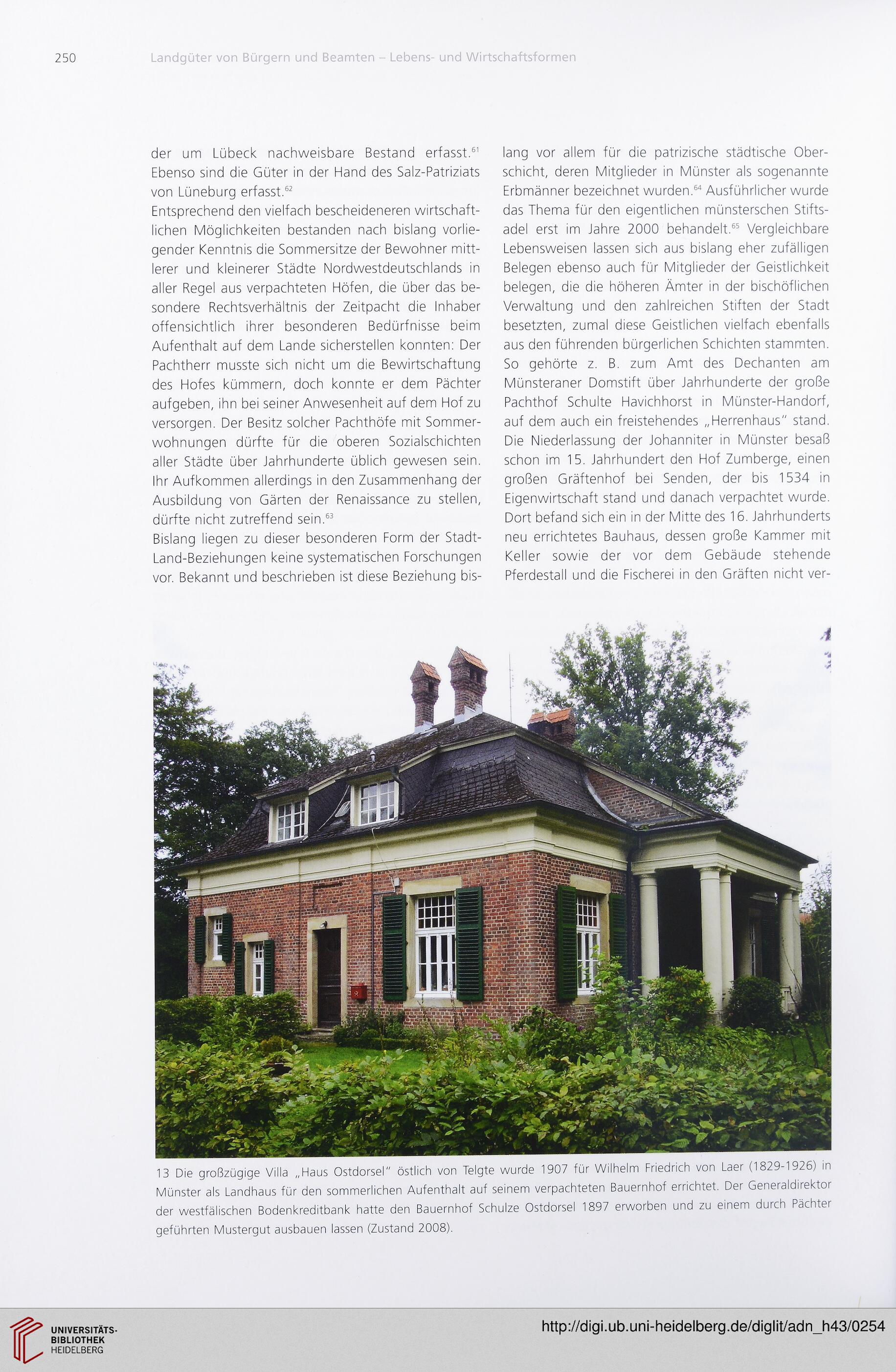250
Landgüter von Bürgern und Beamten - Lebens- und Wirtschaftsformen
der um Lübeck nachweisbare Bestand erfasst.61
Ebenso sind die Güter in der Hand des Salz-Patriziats
von Lüneburg erfasst.62
Entsprechend den vielfach bescheideneren wirtschaft-
lichen Möglichkeiten bestanden nach bislang vorlie-
gender Kenntnis die Sommersitze der Bewohner mitt-
lerer und kleinerer Städte Nordwestdeutschlands in
aller Regel aus verpachteten Höfen, die über das be-
sondere Rechtsverhältnis der Zeitpacht die Inhaber
offensichtlich ihrer besonderen Bedürfnisse beim
Aufenthalt auf dem Lande sicherstellen konnten: Der
Pachtherr musste sich nicht um die Bewirtschaftung
des Hofes kümmern, doch konnte er dem Pächter
aufgeben, ihn bei seiner Anwesenheit auf dem Hof zu
versorgen. Der Besitz solcher Pachthöfe mit Sommer-
wohnungen dürfte für die oberen Sozialschichten
aller Städte über Jahrhunderte üblich gewesen sein.
Ihr Aufkommen allerdings in den Zusammenhang der
Ausbildung von Gärten der Renaissance zu stellen,
dürfte nicht zutreffend sein.63
Bislang liegen zu dieser besonderen Form der Stadt-
Land-Beziehungen keine systematischen Forschungen
vor. Bekannt und beschrieben ist diese Beziehung bis-
lang vor allem für die patrizische städtische Ober-
schicht, deren Mitglieder in Münster als sogenannte
Erbmänner bezeichnet wurden.64 Ausführlicher wurde
das Thema für den eigentlichen münsterschen Stifts-
adel erst im Jahre 2000 behandelt.65 Vergleichbare
Lebensweisen lassen sich aus bislang eher zufälligen
Belegen ebenso auch für Mitglieder der Geistlichkeit
belegen, die die höheren Ämter in der bischöflichen
Verwaltung und den zahlreichen Stiften der Stadt
besetzten, zumal diese Geistlichen vielfach ebenfalls
aus den führenden bürgerlichen Schichten stammten.
So gehörte z. B. zum Amt des Dechanten am
Münsteraner Domstift über Jahrhunderte der große
Pachthof Schulte Havichhorst in Münster-Handorf,
auf dem auch ein freistehendes „Herrenhaus" stand.
Die Niederlassung der Johanniter in Münster besaß
schon im 15. Jahrhundert den Hof Zumberge, einen
großen Gräftenhof bei Senden, der bis 1534 in
Eigenwirtschaft stand und danach verpachtet wurde.
Dort befand sich ein in der Mitte des 16. Jahrhunderts
neu errichtetes Bauhaus, dessen große Kammer mit
Keller sowie der vor dem Gebäude stehende
Pferdestall und die Fischerei in den Gräften nicht ver-
13 Die großzügige Villa „Haus Ostdorsel" östlich von Telgte wurde 1907 für Wilhelm Friedrich von Laer (1829-1926) in
Münster als Landhaus für den sommerlichen Aufenthalt auf seinem verpachteten Bauernhof errichtet. Der Generaldirektor
der westfälischen Bodenkreditbank hatte den Bauernhof Schulze Ostdorsel 1897 erworben und zu einem durch Pächter
geführten Mustergut ausbauen lassen (Zustand 2008).
Landgüter von Bürgern und Beamten - Lebens- und Wirtschaftsformen
der um Lübeck nachweisbare Bestand erfasst.61
Ebenso sind die Güter in der Hand des Salz-Patriziats
von Lüneburg erfasst.62
Entsprechend den vielfach bescheideneren wirtschaft-
lichen Möglichkeiten bestanden nach bislang vorlie-
gender Kenntnis die Sommersitze der Bewohner mitt-
lerer und kleinerer Städte Nordwestdeutschlands in
aller Regel aus verpachteten Höfen, die über das be-
sondere Rechtsverhältnis der Zeitpacht die Inhaber
offensichtlich ihrer besonderen Bedürfnisse beim
Aufenthalt auf dem Lande sicherstellen konnten: Der
Pachtherr musste sich nicht um die Bewirtschaftung
des Hofes kümmern, doch konnte er dem Pächter
aufgeben, ihn bei seiner Anwesenheit auf dem Hof zu
versorgen. Der Besitz solcher Pachthöfe mit Sommer-
wohnungen dürfte für die oberen Sozialschichten
aller Städte über Jahrhunderte üblich gewesen sein.
Ihr Aufkommen allerdings in den Zusammenhang der
Ausbildung von Gärten der Renaissance zu stellen,
dürfte nicht zutreffend sein.63
Bislang liegen zu dieser besonderen Form der Stadt-
Land-Beziehungen keine systematischen Forschungen
vor. Bekannt und beschrieben ist diese Beziehung bis-
lang vor allem für die patrizische städtische Ober-
schicht, deren Mitglieder in Münster als sogenannte
Erbmänner bezeichnet wurden.64 Ausführlicher wurde
das Thema für den eigentlichen münsterschen Stifts-
adel erst im Jahre 2000 behandelt.65 Vergleichbare
Lebensweisen lassen sich aus bislang eher zufälligen
Belegen ebenso auch für Mitglieder der Geistlichkeit
belegen, die die höheren Ämter in der bischöflichen
Verwaltung und den zahlreichen Stiften der Stadt
besetzten, zumal diese Geistlichen vielfach ebenfalls
aus den führenden bürgerlichen Schichten stammten.
So gehörte z. B. zum Amt des Dechanten am
Münsteraner Domstift über Jahrhunderte der große
Pachthof Schulte Havichhorst in Münster-Handorf,
auf dem auch ein freistehendes „Herrenhaus" stand.
Die Niederlassung der Johanniter in Münster besaß
schon im 15. Jahrhundert den Hof Zumberge, einen
großen Gräftenhof bei Senden, der bis 1534 in
Eigenwirtschaft stand und danach verpachtet wurde.
Dort befand sich ein in der Mitte des 16. Jahrhunderts
neu errichtetes Bauhaus, dessen große Kammer mit
Keller sowie der vor dem Gebäude stehende
Pferdestall und die Fischerei in den Gräften nicht ver-
13 Die großzügige Villa „Haus Ostdorsel" östlich von Telgte wurde 1907 für Wilhelm Friedrich von Laer (1829-1926) in
Münster als Landhaus für den sommerlichen Aufenthalt auf seinem verpachteten Bauernhof errichtet. Der Generaldirektor
der westfälischen Bodenkreditbank hatte den Bauernhof Schulze Ostdorsel 1897 erworben und zu einem durch Pächter
geführten Mustergut ausbauen lassen (Zustand 2008).