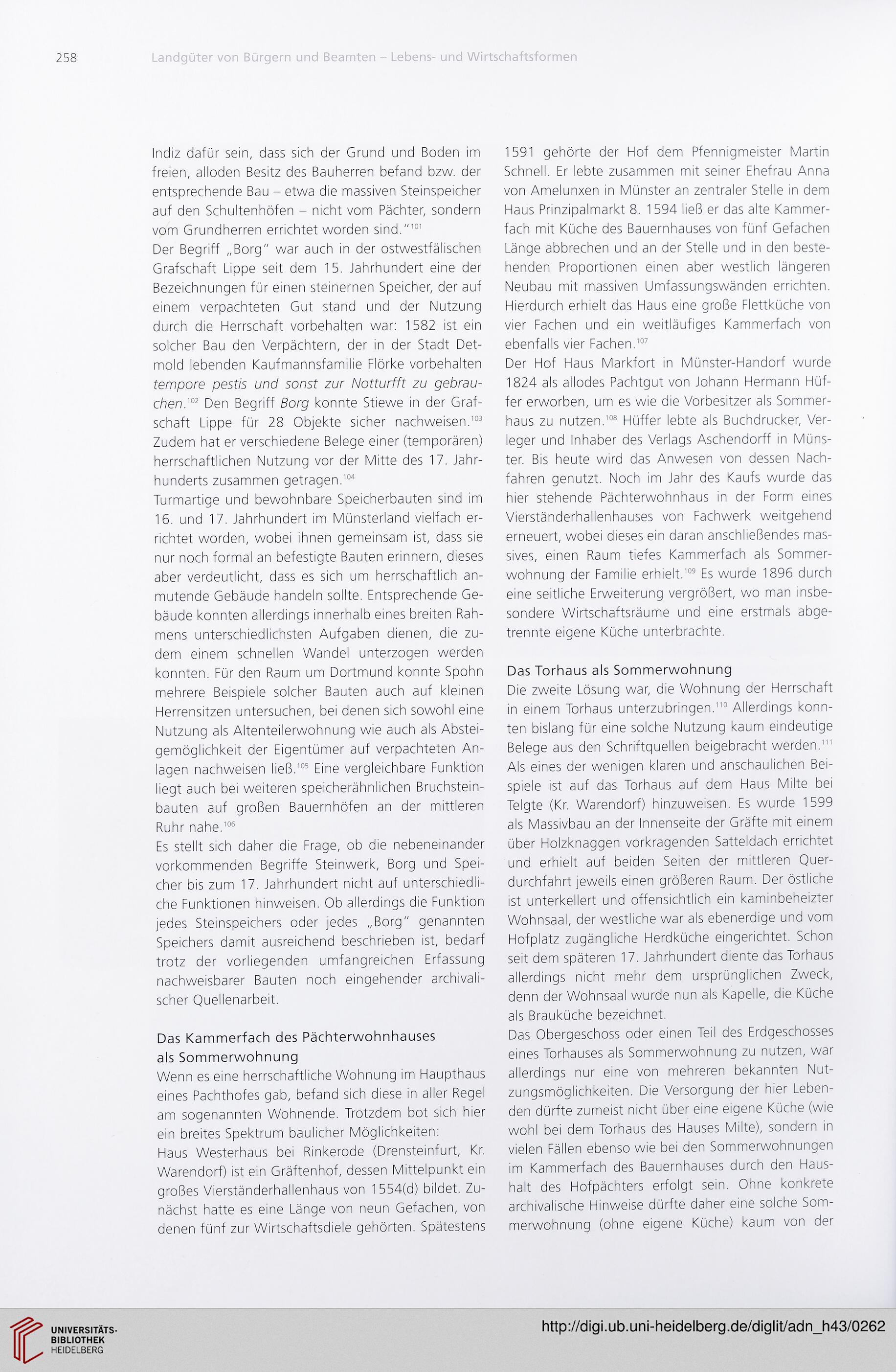258
Landgüter von Bürgern und Beamten - Lebens- und Wirtschaftsformen
Indiz dafür sein, dass sich der Grund und Boden im
freien, alloden Besitz des Bauherren befand bzw. der
entsprechende Bau - etwa die massiven Steinspeicher
auf den Schultenhöfen - nicht vom Pächter, sondern
vom Grundherren errichtet worden sind."10'
Der Begriff „Borg" war auch in der ostwestfälischen
Grafschaft Lippe seit dem 15. Jahrhundert eine der
Bezeichnungen für einen steinernen Speicher, der auf
einem verpachteten Gut stand und der Nutzung
durch die Herrschaft vorbehalten war: 1582 ist ein
solcher Bau den Verpächtern, der in der Stadt Det-
mold lebenden Kaufmannsfamilie Flörke vorbehalten
tempore pestis und sonst zur Notturfft zu gebrau-
chen.'02 Den Begriff Borg konnte Stiewe in der Graf-
schaft Lippe für 28 Objekte sicher nachweisen.'03
Zudem hat er verschiedene Belege einer (temporären)
herrschaftlichen Nutzung vor der Mitte des 17. Jahr-
hunderts zusammen getragen.104
Turmartige und bewohnbare Speicherbauten sind im
16. und 17. Jahrhundert im Münsterland vielfach er-
richtet worden, wobei ihnen gemeinsam ist, dass sie
nur noch formal an befestigte Bauten erinnern, dieses
aber verdeutlicht, dass es sich um herrschaftlich an-
mutende Gebäude handeln sollte. Entsprechende Ge-
bäude konnten allerdings innerhalb eines breiten Rah-
mens unterschiedlichsten Aufgaben dienen, die zu-
dem einem schnellen Wandel unterzogen werden
konnten. Für den Raum um Dortmund konnte Spohn
mehrere Beispiele solcher Bauten auch auf kleinen
Herrensitzen untersuchen, bei denen sich sowohl eine
Nutzung als Altenteilerwohnung wie auch als Abstei-
gemöglichkeit der Eigentümer auf verpachteten An-
lagen nachweisen ließ.105 Eine vergleichbare Funktion
liegt auch bei weiteren speicherähnlichen Bruchstein-
bauten auf großen Bauernhöfen an der mittleren
Ruhr nahe.106
Es stellt sich daher die Frage, ob die nebeneinander
vorkommenden Begriffe Steinwerk, Borg und Spei-
cher bis zum 17. Jahrhundert nicht auf unterschiedli-
che Funktionen hinweisen. Ob allerdings die Funktion
jedes Steinspeichers oder jedes „Borg" genannten
Speichers damit ausreichend beschrieben ist, bedarf
trotz der vorliegenden umfangreichen Erfassung
nachweisbarer Bauten noch eingehender archivali-
scher Quellenarbeit.
Das Kammerfach des Pächterwohnhauses
als Sommerwohnung
Wenn es eine herrschaftliche Wohnung im Haupthaus
eines Pachthofes gab, befand sich diese in aller Regel
am sogenannten Wohnende. Trotzdem bot sich hier
ein breites Spektrum baulicher Möglichkeiten:
Haus Westerhaus bei Rinkerode (Drensteinfurt, Kr.
Warendorf) ist ein Gräftenhof, dessen Mittelpunkt ein
großes Vierständerhallenhaus von 1554(d) bildet. Zu-
nächst hatte es eine Länge von neun Gefachen, von
denen fünf zur Wirtschaftsdiele gehörten. Spätestens
1591 gehörte der Hof dem Pfennigmeister Martin
Schnell. Er lebte zusammen mit seiner Ehefrau Anna
von Amelunxen in Münster an zentraler Stelle in dem
Haus Prinzipalmarkt 8. 1594 ließ er das alte Kammer-
fach mit Küche des Bauernhauses von fünf Gefachen
Länge abbrechen und an der Stelle und in den beste-
henden Proportionen einen aber westlich längeren
Neubau mit massiven Umfassungswänden errichten.
Hierdurch erhielt das Haus eine große Flettküche von
vier Fachen und ein weitläufiges Kammerfach von
ebenfalls vier Fachen.107
Der Hof Haus Markfort in Münster-Handorf wurde
1824 als allodes Pachtgut von Johann Hermann Hüf-
fer erworben, um es wie die Vorbesitzer als Sommer-
haus zu nutzen.108 Hüffer lebte als Buchdrucker, Ver-
leger und Inhaber des Verlags Aschendorff in Müns-
ter. Bis heute wird das Anwesen von dessen Nach-
fahren genutzt. Noch im Jahr des Kaufs wurde das
hier stehende Pächterwohnhaus in der Form eines
Vierständerhallenhauses von Fachwerk weitgehend
erneuert, wobei dieses ein daran anschließendes mas-
sives, einen Raum tiefes Kammerfach als Sommer-
wohnung der Familie erhielt.109 Es wurde 1896 durch
eine seitliche Erweiterung vergrößert, wo man insbe-
sondere Wirtschaftsräume und eine erstmals abge-
trennte eigene Küche unterbrachte.
Das Torhaus als Sommerwohnung
Die zweite Lösung war, die Wohnung der Herrschaft
in einem Torhaus unterzubringen."0 Allerdings konn-
ten bislang für eine solche Nutzung kaum eindeutige
Belege aus den Schriftquellen beigebracht werden.'"
Als eines der wenigen klaren und anschaulichen Bei-
spiele ist auf das Torhaus auf dem Haus Milte bei
Telgte (Kr. Warendorf) hinzuweisen. Es wurde 1599
als Massivbau an der Innenseite der Gräfte mit einem
über Holzknaggen vorkragenden Satteldach errichtet
und erhielt auf beiden Seiten der mittleren Quer-
durchfahrt jeweils einen größeren Raum. Der östliche
ist unterkellert und offensichtlich ein kaminbeheizter
Wohnsaal, der westliche war als ebenerdige und vom
Hofplatz zugängliche Herdküche eingerichtet. Schon
seit dem späteren 17. Jahrhundert diente das Torhaus
allerdings nicht mehr dem ursprünglichen Zweck,
denn der Wohnsaal wurde nun als Kapelle, die Küche
als Brauküche bezeichnet.
Das Obergeschoss oder einen Teil des Erdgeschosses
eines Torhauses als Sommerwohnung zu nutzen, war
allerdings nur eine von mehreren bekannten Nut-
zungsmöglichkeiten. Die Versorgung der hier Leben-
den dürfte zumeist nicht über eine eigene Küche (wie
wohl bei dem Torhaus des Hauses Milte), sondern in
vielen Fällen ebenso wie bei den Sommerwohnungen
im Kammerfach des Bauernhauses durch den Haus-
halt des Hofpächters erfolgt sein. Ohne konkrete
archivalische Hinweise dürfte daher eine solche Som-
merwohnung (ohne eigene Küche) kaum von der
Landgüter von Bürgern und Beamten - Lebens- und Wirtschaftsformen
Indiz dafür sein, dass sich der Grund und Boden im
freien, alloden Besitz des Bauherren befand bzw. der
entsprechende Bau - etwa die massiven Steinspeicher
auf den Schultenhöfen - nicht vom Pächter, sondern
vom Grundherren errichtet worden sind."10'
Der Begriff „Borg" war auch in der ostwestfälischen
Grafschaft Lippe seit dem 15. Jahrhundert eine der
Bezeichnungen für einen steinernen Speicher, der auf
einem verpachteten Gut stand und der Nutzung
durch die Herrschaft vorbehalten war: 1582 ist ein
solcher Bau den Verpächtern, der in der Stadt Det-
mold lebenden Kaufmannsfamilie Flörke vorbehalten
tempore pestis und sonst zur Notturfft zu gebrau-
chen.'02 Den Begriff Borg konnte Stiewe in der Graf-
schaft Lippe für 28 Objekte sicher nachweisen.'03
Zudem hat er verschiedene Belege einer (temporären)
herrschaftlichen Nutzung vor der Mitte des 17. Jahr-
hunderts zusammen getragen.104
Turmartige und bewohnbare Speicherbauten sind im
16. und 17. Jahrhundert im Münsterland vielfach er-
richtet worden, wobei ihnen gemeinsam ist, dass sie
nur noch formal an befestigte Bauten erinnern, dieses
aber verdeutlicht, dass es sich um herrschaftlich an-
mutende Gebäude handeln sollte. Entsprechende Ge-
bäude konnten allerdings innerhalb eines breiten Rah-
mens unterschiedlichsten Aufgaben dienen, die zu-
dem einem schnellen Wandel unterzogen werden
konnten. Für den Raum um Dortmund konnte Spohn
mehrere Beispiele solcher Bauten auch auf kleinen
Herrensitzen untersuchen, bei denen sich sowohl eine
Nutzung als Altenteilerwohnung wie auch als Abstei-
gemöglichkeit der Eigentümer auf verpachteten An-
lagen nachweisen ließ.105 Eine vergleichbare Funktion
liegt auch bei weiteren speicherähnlichen Bruchstein-
bauten auf großen Bauernhöfen an der mittleren
Ruhr nahe.106
Es stellt sich daher die Frage, ob die nebeneinander
vorkommenden Begriffe Steinwerk, Borg und Spei-
cher bis zum 17. Jahrhundert nicht auf unterschiedli-
che Funktionen hinweisen. Ob allerdings die Funktion
jedes Steinspeichers oder jedes „Borg" genannten
Speichers damit ausreichend beschrieben ist, bedarf
trotz der vorliegenden umfangreichen Erfassung
nachweisbarer Bauten noch eingehender archivali-
scher Quellenarbeit.
Das Kammerfach des Pächterwohnhauses
als Sommerwohnung
Wenn es eine herrschaftliche Wohnung im Haupthaus
eines Pachthofes gab, befand sich diese in aller Regel
am sogenannten Wohnende. Trotzdem bot sich hier
ein breites Spektrum baulicher Möglichkeiten:
Haus Westerhaus bei Rinkerode (Drensteinfurt, Kr.
Warendorf) ist ein Gräftenhof, dessen Mittelpunkt ein
großes Vierständerhallenhaus von 1554(d) bildet. Zu-
nächst hatte es eine Länge von neun Gefachen, von
denen fünf zur Wirtschaftsdiele gehörten. Spätestens
1591 gehörte der Hof dem Pfennigmeister Martin
Schnell. Er lebte zusammen mit seiner Ehefrau Anna
von Amelunxen in Münster an zentraler Stelle in dem
Haus Prinzipalmarkt 8. 1594 ließ er das alte Kammer-
fach mit Küche des Bauernhauses von fünf Gefachen
Länge abbrechen und an der Stelle und in den beste-
henden Proportionen einen aber westlich längeren
Neubau mit massiven Umfassungswänden errichten.
Hierdurch erhielt das Haus eine große Flettküche von
vier Fachen und ein weitläufiges Kammerfach von
ebenfalls vier Fachen.107
Der Hof Haus Markfort in Münster-Handorf wurde
1824 als allodes Pachtgut von Johann Hermann Hüf-
fer erworben, um es wie die Vorbesitzer als Sommer-
haus zu nutzen.108 Hüffer lebte als Buchdrucker, Ver-
leger und Inhaber des Verlags Aschendorff in Müns-
ter. Bis heute wird das Anwesen von dessen Nach-
fahren genutzt. Noch im Jahr des Kaufs wurde das
hier stehende Pächterwohnhaus in der Form eines
Vierständerhallenhauses von Fachwerk weitgehend
erneuert, wobei dieses ein daran anschließendes mas-
sives, einen Raum tiefes Kammerfach als Sommer-
wohnung der Familie erhielt.109 Es wurde 1896 durch
eine seitliche Erweiterung vergrößert, wo man insbe-
sondere Wirtschaftsräume und eine erstmals abge-
trennte eigene Küche unterbrachte.
Das Torhaus als Sommerwohnung
Die zweite Lösung war, die Wohnung der Herrschaft
in einem Torhaus unterzubringen."0 Allerdings konn-
ten bislang für eine solche Nutzung kaum eindeutige
Belege aus den Schriftquellen beigebracht werden.'"
Als eines der wenigen klaren und anschaulichen Bei-
spiele ist auf das Torhaus auf dem Haus Milte bei
Telgte (Kr. Warendorf) hinzuweisen. Es wurde 1599
als Massivbau an der Innenseite der Gräfte mit einem
über Holzknaggen vorkragenden Satteldach errichtet
und erhielt auf beiden Seiten der mittleren Quer-
durchfahrt jeweils einen größeren Raum. Der östliche
ist unterkellert und offensichtlich ein kaminbeheizter
Wohnsaal, der westliche war als ebenerdige und vom
Hofplatz zugängliche Herdküche eingerichtet. Schon
seit dem späteren 17. Jahrhundert diente das Torhaus
allerdings nicht mehr dem ursprünglichen Zweck,
denn der Wohnsaal wurde nun als Kapelle, die Küche
als Brauküche bezeichnet.
Das Obergeschoss oder einen Teil des Erdgeschosses
eines Torhauses als Sommerwohnung zu nutzen, war
allerdings nur eine von mehreren bekannten Nut-
zungsmöglichkeiten. Die Versorgung der hier Leben-
den dürfte zumeist nicht über eine eigene Küche (wie
wohl bei dem Torhaus des Hauses Milte), sondern in
vielen Fällen ebenso wie bei den Sommerwohnungen
im Kammerfach des Bauernhauses durch den Haus-
halt des Hofpächters erfolgt sein. Ohne konkrete
archivalische Hinweise dürfte daher eine solche Som-
merwohnung (ohne eigene Küche) kaum von der