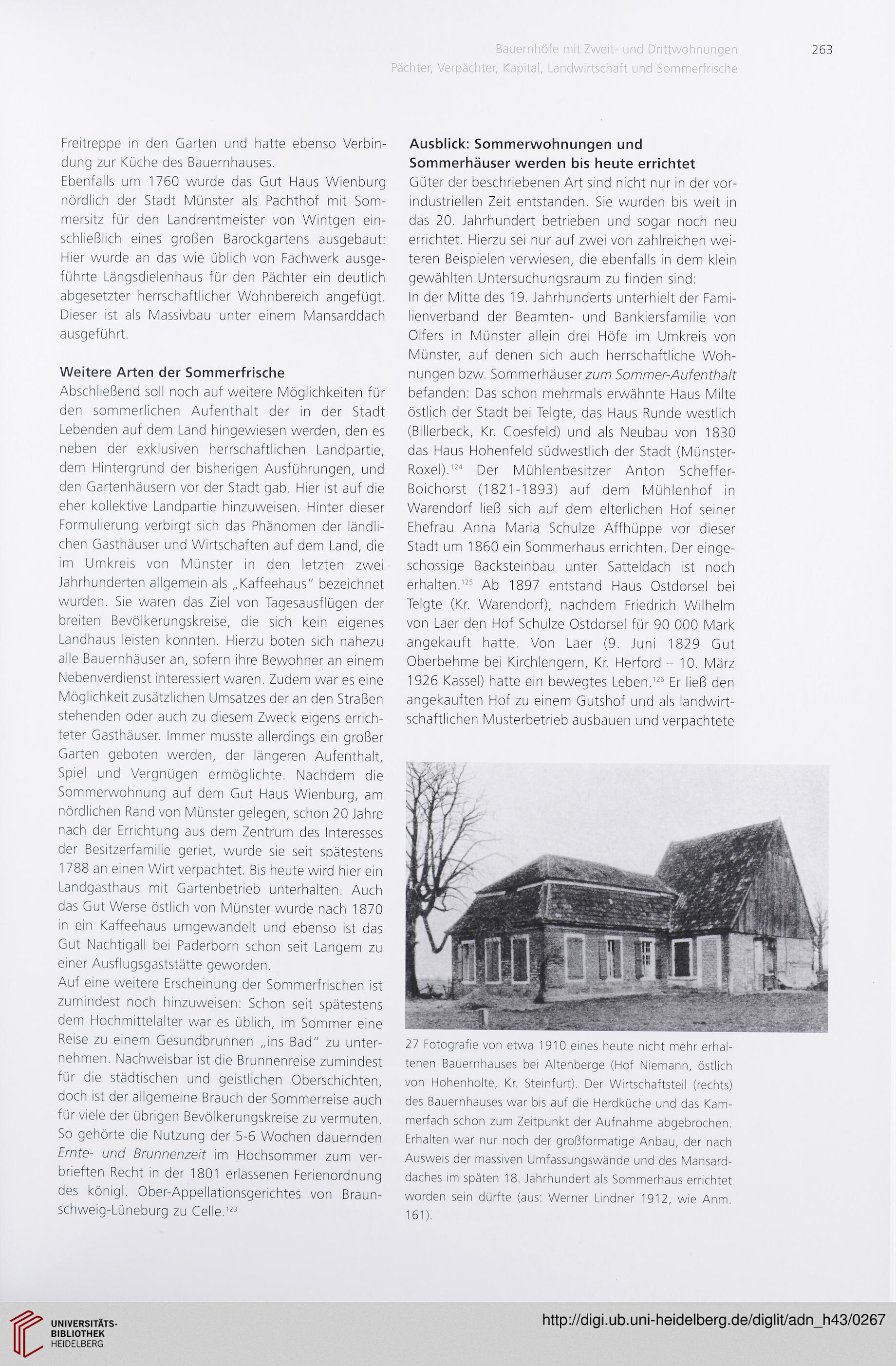Bauernhöfe mit Zweit- und Drittwohnungen
Pächter, Verpächter, Kapital, Landwirtschaft und Sommerfrische
263
Freitreppe in den Garten und hatte ebenso Verbin-
dung zur Küche des Bauernhauses.
Ebenfalls um 1760 wurde das Gut Haus Wienburg
nördlich der Stadt Münster als Pachthof mit Som-
mersitz für den Landrentmeister von Wintgen ein-
schließlich eines großen Barockgartens ausgebaut:
Hier wurde an das wie üblich von Fachwerk ausge-
führte Längsdielenhaus für den Pächter ein deutlich
abgesetzter herrschaftlicher Wohnbereich angefügt.
Dieser ist als Massivbau unter einem Mansarddach
ausgeführt.
Weitere Arten der Sommerfrische
Abschließend soll noch auf weitere Möglichkeiten für
den sommerlichen Aufenthalt der in der Stadt
Lebenden auf dem Land hingewiesen werden, den es
neben der exklusiven herrschaftlichen Landpartie,
dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen, und
den Gartenhäusern vor der Stadt gab. Hier ist auf die
eher kollektive Landpartie hinzuweisen. Hinter dieser
Formulierung verbirgt sich das Phänomen der ländli-
chen Gasthäuser und Wirtschaften auf dem Land, die
im Umkreis von Münster in den letzten zwei
Jahrhunderten allgemein als „Kaffeehaus" bezeichnet
wurden. Sie waren das Ziel von Tagesausflügen der
breiten Bevölkerungskreise, die sich kein eigenes
Landhaus leisten konnten. Hierzu boten sich nahezu
alle Bauernhäuser an, sofern ihre Bewohner an einem
Nebenverdienst interessiert waren. Zudem war es eine
Möglichkeit zusätzlichen Umsatzes der an den Straßen
stehenden oder auch zu diesem Zweck eigens errich-
teter Gasthäuser. Immer musste allerdings ein großer
Garten geboten werden, der längeren Aufenthalt,
Spiel und Vergnügen ermöglichte. Nachdem die
Sommerwohnung auf dem Gut Haus Wienburg, am
nördlichen Rand von Münster gelegen, schon 20 Jahre
nach der Errichtung aus dem Zentrum des Interesses
der Besitzerfamilie geriet, wurde sie seit spätestens
1788 an einen Wirt verpachtet. Bis heute wird hier ein
Landgasthaus mit Gartenbetrieb unterhalten. Auch
das Gut Werse östlich von Münster wurde nach 1870
in ein Kaffeehaus umgewandelt und ebenso ist das
Gut Nachtigall bei Paderborn schon seit Langem zu
einer Ausflugsgaststätte geworden.
Auf eine weitere Erscheinung der Sommerfrischen ist
zumindest noch hinzuweisen: Schon seit spätestens
dem Hochmittelalter war es üblich, im Sommer eine
Reise zu einem Gesundbrunnen „ins Bad" zu unter-
nehmen. Nachweisbar ist die Brunnenreise zumindest
für die städtischen und geistlichen Oberschichten,
doch ist der allgemeine Brauch der Sommerreise auch
für viele der übrigen Bevölkerungskreise zu vermuten.
So gehörte die Nutzung der 5-6 Wochen dauernden
Ernte- und Brunnenzeit im Hochsommer zum ver-
brieften Recht in der 1801 erlassenen Ferienordnung
des königl. Ober-Appellationsgerichtes von Braun-
schweig-Lüneburg zu Celle.123
Ausblick: Sommerwohnungen und
Sommerhäuser werden bis heute errichtet
Güter der beschriebenen Art sind nicht nur in der vor-
industriellen Zeit entstanden. Sie wurden bis weit in
das 20. Jahrhundert betrieben und sogar noch neu
errichtet. Hierzu sei nur auf zwei von zahlreichen wei-
teren Beispielen verwiesen, die ebenfalls in dem klein
gewählten Untersuchungsraum zu finden sind:
In der Mitte des 19. Jahrhunderts unterhielt der Fami-
lienverband der Beamten- und Bankiersfamilie von
Olfers in Münster allein drei Höfe im Umkreis von
Münster, auf denen sich auch herrschaftliche Woh-
nungen bzw. Sommerhäuser zum Sommer-Aufenthalt
befanden: Das schon mehrmals erwähnte Haus Milte
östlich der Stadt bei Telgte, das Haus Runde westlich
(Billerbeck, Kr. Coesfeld) und als Neubau von 1830
das Haus Hohenfeld südwestlich der Stadt (Münster-
Roxel).124 Der Mühlenbesitzer Anton Scheffer-
Boichorst (1821-1893) auf dem Mühlenhof in
Warendorf ließ sich auf dem elterlichen Hof seiner
Ehefrau Anna Maria Schulze Affhüppe vor dieser
Stadt um 1860 ein Sommerhaus errichten. Der einge-
schossige Backsteinbau unter Satteldach ist noch
erhalten.125 Ab 1897 entstand Haus Ostdorsel bei
Telgte (Kr. Warendorf), nachdem Friedrich Wilhelm
von Laer den Hof Schulze Ostdorsel für 90 000 Mark
angekauft hatte. Von Laer (9. Juni 1829 Gut
Oberbehme bei Kirchlengern, Kr. Herford - 10. März
1926 Kassel) hatte ein bewegtes Leben.126 Er ließ den
angekauften Hof zu einem Gutshof und als landwirt-
schaftlichen Musterbetrieb ausbauen und verpachtete
27 Fotografie von etwa 1910 eines heute nicht mehr erhal-
tenen Bauernhauses bei Altenberge (Hof Niemann, östlich
von Hohenholte, Kr. Steinfurt). Der Wirtschaftsteil (rechts)
des Bauernhauses war bis auf die Herdküche und das Kam-
merfach schon zum Zeitpunkt der Aufnahme abgebrochen.
Erhalten war nur noch der großformatige Anbau, der nach
Ausweis der massiven Umfassungswände und des Mansard-
daches im späten 18. Jahrhundert als Sommerhaus errichtet
worden sein dürfte (aus: Werner Lindner 1912, wie Anm.
161).
Pächter, Verpächter, Kapital, Landwirtschaft und Sommerfrische
263
Freitreppe in den Garten und hatte ebenso Verbin-
dung zur Küche des Bauernhauses.
Ebenfalls um 1760 wurde das Gut Haus Wienburg
nördlich der Stadt Münster als Pachthof mit Som-
mersitz für den Landrentmeister von Wintgen ein-
schließlich eines großen Barockgartens ausgebaut:
Hier wurde an das wie üblich von Fachwerk ausge-
führte Längsdielenhaus für den Pächter ein deutlich
abgesetzter herrschaftlicher Wohnbereich angefügt.
Dieser ist als Massivbau unter einem Mansarddach
ausgeführt.
Weitere Arten der Sommerfrische
Abschließend soll noch auf weitere Möglichkeiten für
den sommerlichen Aufenthalt der in der Stadt
Lebenden auf dem Land hingewiesen werden, den es
neben der exklusiven herrschaftlichen Landpartie,
dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen, und
den Gartenhäusern vor der Stadt gab. Hier ist auf die
eher kollektive Landpartie hinzuweisen. Hinter dieser
Formulierung verbirgt sich das Phänomen der ländli-
chen Gasthäuser und Wirtschaften auf dem Land, die
im Umkreis von Münster in den letzten zwei
Jahrhunderten allgemein als „Kaffeehaus" bezeichnet
wurden. Sie waren das Ziel von Tagesausflügen der
breiten Bevölkerungskreise, die sich kein eigenes
Landhaus leisten konnten. Hierzu boten sich nahezu
alle Bauernhäuser an, sofern ihre Bewohner an einem
Nebenverdienst interessiert waren. Zudem war es eine
Möglichkeit zusätzlichen Umsatzes der an den Straßen
stehenden oder auch zu diesem Zweck eigens errich-
teter Gasthäuser. Immer musste allerdings ein großer
Garten geboten werden, der längeren Aufenthalt,
Spiel und Vergnügen ermöglichte. Nachdem die
Sommerwohnung auf dem Gut Haus Wienburg, am
nördlichen Rand von Münster gelegen, schon 20 Jahre
nach der Errichtung aus dem Zentrum des Interesses
der Besitzerfamilie geriet, wurde sie seit spätestens
1788 an einen Wirt verpachtet. Bis heute wird hier ein
Landgasthaus mit Gartenbetrieb unterhalten. Auch
das Gut Werse östlich von Münster wurde nach 1870
in ein Kaffeehaus umgewandelt und ebenso ist das
Gut Nachtigall bei Paderborn schon seit Langem zu
einer Ausflugsgaststätte geworden.
Auf eine weitere Erscheinung der Sommerfrischen ist
zumindest noch hinzuweisen: Schon seit spätestens
dem Hochmittelalter war es üblich, im Sommer eine
Reise zu einem Gesundbrunnen „ins Bad" zu unter-
nehmen. Nachweisbar ist die Brunnenreise zumindest
für die städtischen und geistlichen Oberschichten,
doch ist der allgemeine Brauch der Sommerreise auch
für viele der übrigen Bevölkerungskreise zu vermuten.
So gehörte die Nutzung der 5-6 Wochen dauernden
Ernte- und Brunnenzeit im Hochsommer zum ver-
brieften Recht in der 1801 erlassenen Ferienordnung
des königl. Ober-Appellationsgerichtes von Braun-
schweig-Lüneburg zu Celle.123
Ausblick: Sommerwohnungen und
Sommerhäuser werden bis heute errichtet
Güter der beschriebenen Art sind nicht nur in der vor-
industriellen Zeit entstanden. Sie wurden bis weit in
das 20. Jahrhundert betrieben und sogar noch neu
errichtet. Hierzu sei nur auf zwei von zahlreichen wei-
teren Beispielen verwiesen, die ebenfalls in dem klein
gewählten Untersuchungsraum zu finden sind:
In der Mitte des 19. Jahrhunderts unterhielt der Fami-
lienverband der Beamten- und Bankiersfamilie von
Olfers in Münster allein drei Höfe im Umkreis von
Münster, auf denen sich auch herrschaftliche Woh-
nungen bzw. Sommerhäuser zum Sommer-Aufenthalt
befanden: Das schon mehrmals erwähnte Haus Milte
östlich der Stadt bei Telgte, das Haus Runde westlich
(Billerbeck, Kr. Coesfeld) und als Neubau von 1830
das Haus Hohenfeld südwestlich der Stadt (Münster-
Roxel).124 Der Mühlenbesitzer Anton Scheffer-
Boichorst (1821-1893) auf dem Mühlenhof in
Warendorf ließ sich auf dem elterlichen Hof seiner
Ehefrau Anna Maria Schulze Affhüppe vor dieser
Stadt um 1860 ein Sommerhaus errichten. Der einge-
schossige Backsteinbau unter Satteldach ist noch
erhalten.125 Ab 1897 entstand Haus Ostdorsel bei
Telgte (Kr. Warendorf), nachdem Friedrich Wilhelm
von Laer den Hof Schulze Ostdorsel für 90 000 Mark
angekauft hatte. Von Laer (9. Juni 1829 Gut
Oberbehme bei Kirchlengern, Kr. Herford - 10. März
1926 Kassel) hatte ein bewegtes Leben.126 Er ließ den
angekauften Hof zu einem Gutshof und als landwirt-
schaftlichen Musterbetrieb ausbauen und verpachtete
27 Fotografie von etwa 1910 eines heute nicht mehr erhal-
tenen Bauernhauses bei Altenberge (Hof Niemann, östlich
von Hohenholte, Kr. Steinfurt). Der Wirtschaftsteil (rechts)
des Bauernhauses war bis auf die Herdküche und das Kam-
merfach schon zum Zeitpunkt der Aufnahme abgebrochen.
Erhalten war nur noch der großformatige Anbau, der nach
Ausweis der massiven Umfassungswände und des Mansard-
daches im späten 18. Jahrhundert als Sommerhaus errichtet
worden sein dürfte (aus: Werner Lindner 1912, wie Anm.
161).