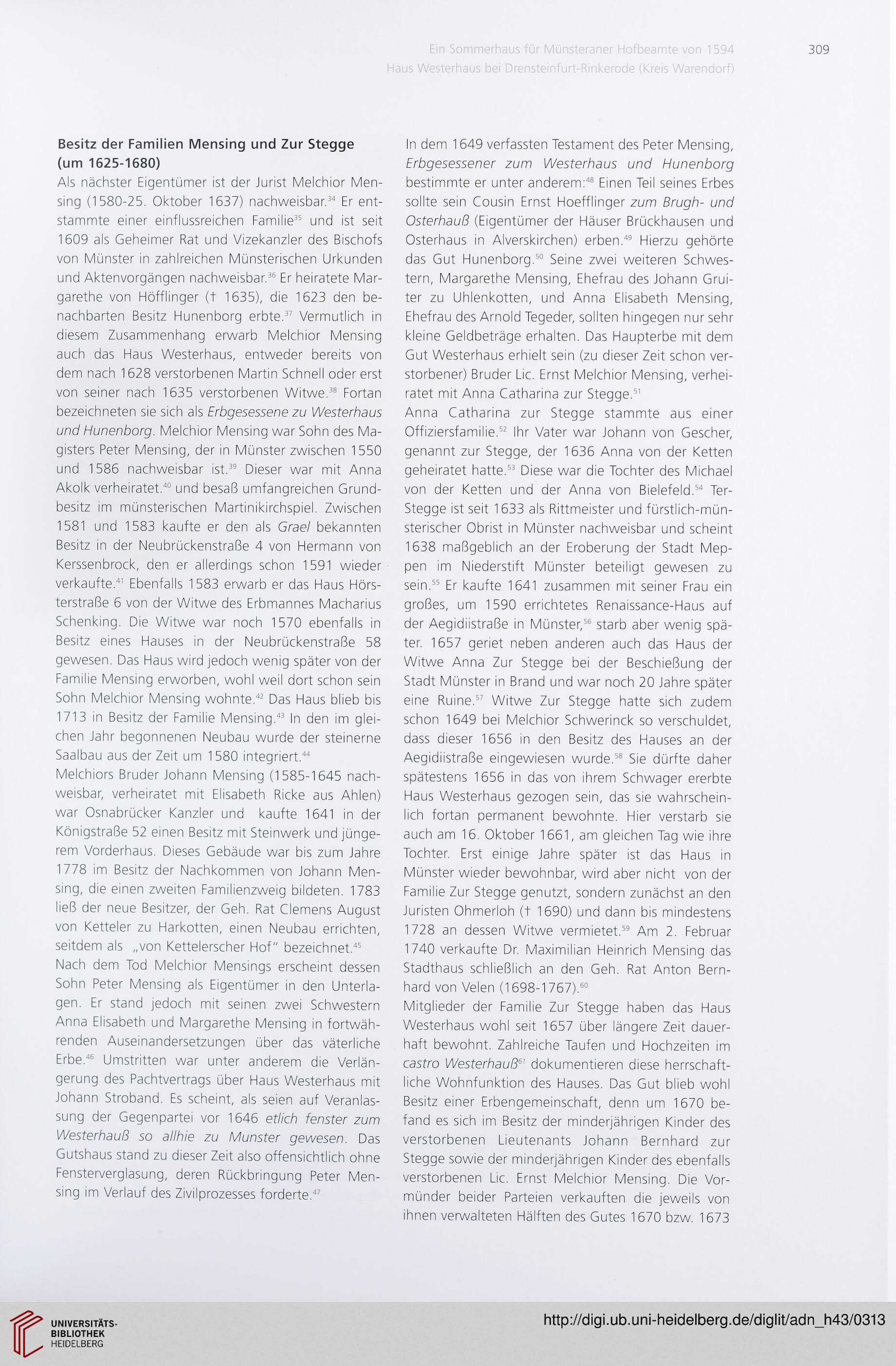Ein Sommerhaus für Münsteraner Hofbeamte von 1594
Haus Westerhaus bei Drensteinfurt-Rinkerode (Kreis Warendorf)
Besitz der Familien Mensing und Zur Stegge
(um 1625-1680)
Als nächster Eigentümer ist der Jurist Melchior Men-
sing (1580-25. Oktober 1637) nachweisbar.34 Er ent-
stammte einer einflussreichen Familie35 und ist seit
1609 als Geheimer Rat und Vizekanzler des Bischofs
von Münster in zahlreichen Münsterischen Urkunden
und Aktenvorgängen nachweisbar.36 Er heiratete Mar-
garethe von Höfflinger (+ 1635), die 1623 den be-
nachbarten Besitz Hunenborg erbte.37 Vermutlich in
diesem Zusammenhang erwarb Melchior Mensing
auch das Haus Westerhaus, entweder bereits von
dem nach 1628 verstorbenen Martin Schnell oder erst
von seiner nach 1635 verstorbenen Witwe.38 Fortan
bezeichneten sie sich als Erbgesessene zu Westerhaus
und Hunenborg. Melchior Mensing war Sohn des Ma-
gisters Peter Mensing, der in Münster zwischen 1550
und 1586 nachweisbar ist.39 Dieser war mit Anna
Akolk verheiratet.40 und besaß umfangreichen Grund-
besitz im münsterischen Martinikirchspiel. Zwischen
1581 und 1583 kaufte er den als Grael bekannten
Besitz in der Neubrückenstraße 4 von Hermann von
Kerssenbrock, den er allerdings schon 1591 wieder
verkaufte.41 Ebenfalls 1583 erwarb er das Haus Hörs-
terstraße 6 von der Witwe des Erbmannes Macharius
Schenking. Die Witwe war noch 1570 ebenfalls in
Besitz eines Hauses in der Neubrückenstraße 58
gewesen. Das Haus wird jedoch wenig später von der
Familie Mensing erworben, wohl weil dort schon sein
Sohn Melchior Mensing wohnte.42 Das Haus blieb bis
1713 in Besitz der Familie Mensing.43 In den im glei-
chen Jahr begonnenen Neubau wurde der steinerne
Saalbau aus der Zeit um 1580 integriert.44
Melchiors Bruder Johann Mensing (1585-1645 nach-
weisbar, verheiratet mit Elisabeth Ricke aus Ahlen)
war Osnabrücker Kanzler und kaufte 1641 in der
Königstraße 52 einen Besitz mit Steinwerk und jünge-
rem Vorderhaus. Dieses Gebäude war bis zum Jahre
1778 im Besitz der Nachkommen von Johann Men-
sing, die einen zweiten Familienzweig bildeten. 1783
ließ der neue Besitzer, der Geh. Rat Clemens August
von Ketteier zu Harkotten, einen Neubau errichten,
seitdem als „von Kettelerscher Hof" bezeichnet.45
Nach dem Tod Melchior Mensings erscheint dessen
Sohn Peter Mensing als Eigentümer in den Unterla-
gen. Er stand jedoch mit seinen zwei Schwestern
Anna Elisabeth und Margarethe Mensing in fortwäh-
renden Auseinandersetzungen über das väterliche
Erbe.46 Umstritten war unter anderem die Verlän-
gerung des Pachtvertrags über Haus Westerhaus mit
Johann Stroband. Es scheint, als seien auf Veranlas-
sung der Gegenpartei vor 1646 etlich fenster zum
Westerhauß so allhie zu Munster gewesen. Das
Gutshaus stand zu dieser Zeit also offensichtlich ohne
Fensterverglasung, deren Rückbringung Peter Men-
sing im Verlauf des Zivilprozesses forderte.47
In dem 1649 verfassten Testament des Peter Mensing,
Erbgesessener zum Westerhaus und Hunenborg
bestimmte er unter anderem:48 Einen Teil seines Erbes
sollte sein Cousin Ernst Hoefflinger zum Brugh- und
Osterhauß (Eigentümer der Häuser Brückhausen und
Osterhaus in Alverskirchen) erben.49 Hierzu gehörte
das Gut Hunenborg.50 Seine zwei weiteren Schwes-
tern, Margarethe Mensing, Ehefrau des Johann Grui-
ter zu Uhlenkotten, und Anna Elisabeth Mensing,
Ehefrau des Arnold Tegeder, sollten hingegen nur sehr
kleine Geldbeträge erhalten. Das Haupterbe mit dem
Gut Westerhaus erhielt sein (zu dieser Zeit schon ver-
storbener) Bruder Lic. Ernst Melchior Mensing, verhei-
ratet mit Anna Catharina zur Stegge.51
Anna Catharina zur Stegge stammte aus einer
Offiziersfamilie.52 Ihr Vater war Johann von Gescher,
genannt zur Stegge, der 1636 Anna von der Ketten
geheiratet hatte.53 Diese war die Tochter des Michael
von der Ketten und der Anna von Bielefeld.54 Ter-
Stegge ist seit 1633 als Rittmeister und fürstlich-mün-
sterischer Obrist in Münster nachweisbar und scheint
1638 maßgeblich an der Eroberung der Stadt Mep-
pen im Niederstift Münster beteiligt gewesen zu
sein.55 Er kaufte 1641 zusammen mit seiner Frau ein
großes, um 1590 errichtetes Renaissance-Haus auf
der Aegidiistraße in Münster,56 starb aber wenig spä-
ter. 1657 geriet neben anderen auch das Haus der
Witwe Anna Zur Stegge bei der Beschießung der
Stadt Münster in Brand und war noch 20 Jahre später
eine Ruine.57 Witwe Zur Stegge hatte sich zudem
schon 1649 bei Melchior Schwerinck so verschuldet,
dass dieser 1656 in den Besitz des Hauses an der
Aegidiistraße eingewiesen wurde.58 Sie dürfte daher
spätestens 1656 in das von ihrem Schwager ererbte
Haus Westerhaus gezogen sein, das sie wahrschein-
lich fortan permanent bewohnte. Hier verstarb sie
auch am 16. Oktober 1661, am gleichen Tag wie ihre
Tochter. Erst einige Jahre später ist das Haus in
Münster wieder bewohnbar, wird aber nicht von der
Familie Zur Stegge genutzt, sondern zunächst an den
Juristen Ohmerloh (+ 1690) und dann bis mindestens
1728 an dessen Witwe vermietet.59 Am 2. Februar
1740 verkaufte Dr. Maximilian Heinrich Mensing das
Stadthaus schließlich an den Geh. Rat Anton Bern-
hard von Velen (1698-1767).60
Mitglieder der Familie Zur Stegge haben das Haus
Westerhaus wohl seit 1657 über längere Zeit dauer-
haft bewohnt. Zahlreiche Taufen und Hochzeiten im
Castro Westerhauß6' dokumentieren diese herrschaft-
liche Wohnfunktion des Hauses. Das Gut blieb wohl
Besitz einer Erbengemeinschaft, denn um 1670 be-
fand es sich im Besitz der minderjährigen Kinder des
verstorbenen Lieutenants Johann Bernhard zur
Stegge sowie der minderjährigen Kinder des ebenfalls
verstorbenen Lic. Ernst Melchior Mensing. Die Vor-
münder beider Parteien verkauften die jeweils von
ihnen verwalteten Hälften des Gutes 1670 bzw. 1673
309
Haus Westerhaus bei Drensteinfurt-Rinkerode (Kreis Warendorf)
Besitz der Familien Mensing und Zur Stegge
(um 1625-1680)
Als nächster Eigentümer ist der Jurist Melchior Men-
sing (1580-25. Oktober 1637) nachweisbar.34 Er ent-
stammte einer einflussreichen Familie35 und ist seit
1609 als Geheimer Rat und Vizekanzler des Bischofs
von Münster in zahlreichen Münsterischen Urkunden
und Aktenvorgängen nachweisbar.36 Er heiratete Mar-
garethe von Höfflinger (+ 1635), die 1623 den be-
nachbarten Besitz Hunenborg erbte.37 Vermutlich in
diesem Zusammenhang erwarb Melchior Mensing
auch das Haus Westerhaus, entweder bereits von
dem nach 1628 verstorbenen Martin Schnell oder erst
von seiner nach 1635 verstorbenen Witwe.38 Fortan
bezeichneten sie sich als Erbgesessene zu Westerhaus
und Hunenborg. Melchior Mensing war Sohn des Ma-
gisters Peter Mensing, der in Münster zwischen 1550
und 1586 nachweisbar ist.39 Dieser war mit Anna
Akolk verheiratet.40 und besaß umfangreichen Grund-
besitz im münsterischen Martinikirchspiel. Zwischen
1581 und 1583 kaufte er den als Grael bekannten
Besitz in der Neubrückenstraße 4 von Hermann von
Kerssenbrock, den er allerdings schon 1591 wieder
verkaufte.41 Ebenfalls 1583 erwarb er das Haus Hörs-
terstraße 6 von der Witwe des Erbmannes Macharius
Schenking. Die Witwe war noch 1570 ebenfalls in
Besitz eines Hauses in der Neubrückenstraße 58
gewesen. Das Haus wird jedoch wenig später von der
Familie Mensing erworben, wohl weil dort schon sein
Sohn Melchior Mensing wohnte.42 Das Haus blieb bis
1713 in Besitz der Familie Mensing.43 In den im glei-
chen Jahr begonnenen Neubau wurde der steinerne
Saalbau aus der Zeit um 1580 integriert.44
Melchiors Bruder Johann Mensing (1585-1645 nach-
weisbar, verheiratet mit Elisabeth Ricke aus Ahlen)
war Osnabrücker Kanzler und kaufte 1641 in der
Königstraße 52 einen Besitz mit Steinwerk und jünge-
rem Vorderhaus. Dieses Gebäude war bis zum Jahre
1778 im Besitz der Nachkommen von Johann Men-
sing, die einen zweiten Familienzweig bildeten. 1783
ließ der neue Besitzer, der Geh. Rat Clemens August
von Ketteier zu Harkotten, einen Neubau errichten,
seitdem als „von Kettelerscher Hof" bezeichnet.45
Nach dem Tod Melchior Mensings erscheint dessen
Sohn Peter Mensing als Eigentümer in den Unterla-
gen. Er stand jedoch mit seinen zwei Schwestern
Anna Elisabeth und Margarethe Mensing in fortwäh-
renden Auseinandersetzungen über das väterliche
Erbe.46 Umstritten war unter anderem die Verlän-
gerung des Pachtvertrags über Haus Westerhaus mit
Johann Stroband. Es scheint, als seien auf Veranlas-
sung der Gegenpartei vor 1646 etlich fenster zum
Westerhauß so allhie zu Munster gewesen. Das
Gutshaus stand zu dieser Zeit also offensichtlich ohne
Fensterverglasung, deren Rückbringung Peter Men-
sing im Verlauf des Zivilprozesses forderte.47
In dem 1649 verfassten Testament des Peter Mensing,
Erbgesessener zum Westerhaus und Hunenborg
bestimmte er unter anderem:48 Einen Teil seines Erbes
sollte sein Cousin Ernst Hoefflinger zum Brugh- und
Osterhauß (Eigentümer der Häuser Brückhausen und
Osterhaus in Alverskirchen) erben.49 Hierzu gehörte
das Gut Hunenborg.50 Seine zwei weiteren Schwes-
tern, Margarethe Mensing, Ehefrau des Johann Grui-
ter zu Uhlenkotten, und Anna Elisabeth Mensing,
Ehefrau des Arnold Tegeder, sollten hingegen nur sehr
kleine Geldbeträge erhalten. Das Haupterbe mit dem
Gut Westerhaus erhielt sein (zu dieser Zeit schon ver-
storbener) Bruder Lic. Ernst Melchior Mensing, verhei-
ratet mit Anna Catharina zur Stegge.51
Anna Catharina zur Stegge stammte aus einer
Offiziersfamilie.52 Ihr Vater war Johann von Gescher,
genannt zur Stegge, der 1636 Anna von der Ketten
geheiratet hatte.53 Diese war die Tochter des Michael
von der Ketten und der Anna von Bielefeld.54 Ter-
Stegge ist seit 1633 als Rittmeister und fürstlich-mün-
sterischer Obrist in Münster nachweisbar und scheint
1638 maßgeblich an der Eroberung der Stadt Mep-
pen im Niederstift Münster beteiligt gewesen zu
sein.55 Er kaufte 1641 zusammen mit seiner Frau ein
großes, um 1590 errichtetes Renaissance-Haus auf
der Aegidiistraße in Münster,56 starb aber wenig spä-
ter. 1657 geriet neben anderen auch das Haus der
Witwe Anna Zur Stegge bei der Beschießung der
Stadt Münster in Brand und war noch 20 Jahre später
eine Ruine.57 Witwe Zur Stegge hatte sich zudem
schon 1649 bei Melchior Schwerinck so verschuldet,
dass dieser 1656 in den Besitz des Hauses an der
Aegidiistraße eingewiesen wurde.58 Sie dürfte daher
spätestens 1656 in das von ihrem Schwager ererbte
Haus Westerhaus gezogen sein, das sie wahrschein-
lich fortan permanent bewohnte. Hier verstarb sie
auch am 16. Oktober 1661, am gleichen Tag wie ihre
Tochter. Erst einige Jahre später ist das Haus in
Münster wieder bewohnbar, wird aber nicht von der
Familie Zur Stegge genutzt, sondern zunächst an den
Juristen Ohmerloh (+ 1690) und dann bis mindestens
1728 an dessen Witwe vermietet.59 Am 2. Februar
1740 verkaufte Dr. Maximilian Heinrich Mensing das
Stadthaus schließlich an den Geh. Rat Anton Bern-
hard von Velen (1698-1767).60
Mitglieder der Familie Zur Stegge haben das Haus
Westerhaus wohl seit 1657 über längere Zeit dauer-
haft bewohnt. Zahlreiche Taufen und Hochzeiten im
Castro Westerhauß6' dokumentieren diese herrschaft-
liche Wohnfunktion des Hauses. Das Gut blieb wohl
Besitz einer Erbengemeinschaft, denn um 1670 be-
fand es sich im Besitz der minderjährigen Kinder des
verstorbenen Lieutenants Johann Bernhard zur
Stegge sowie der minderjährigen Kinder des ebenfalls
verstorbenen Lic. Ernst Melchior Mensing. Die Vor-
münder beider Parteien verkauften die jeweils von
ihnen verwalteten Hälften des Gutes 1670 bzw. 1673
309