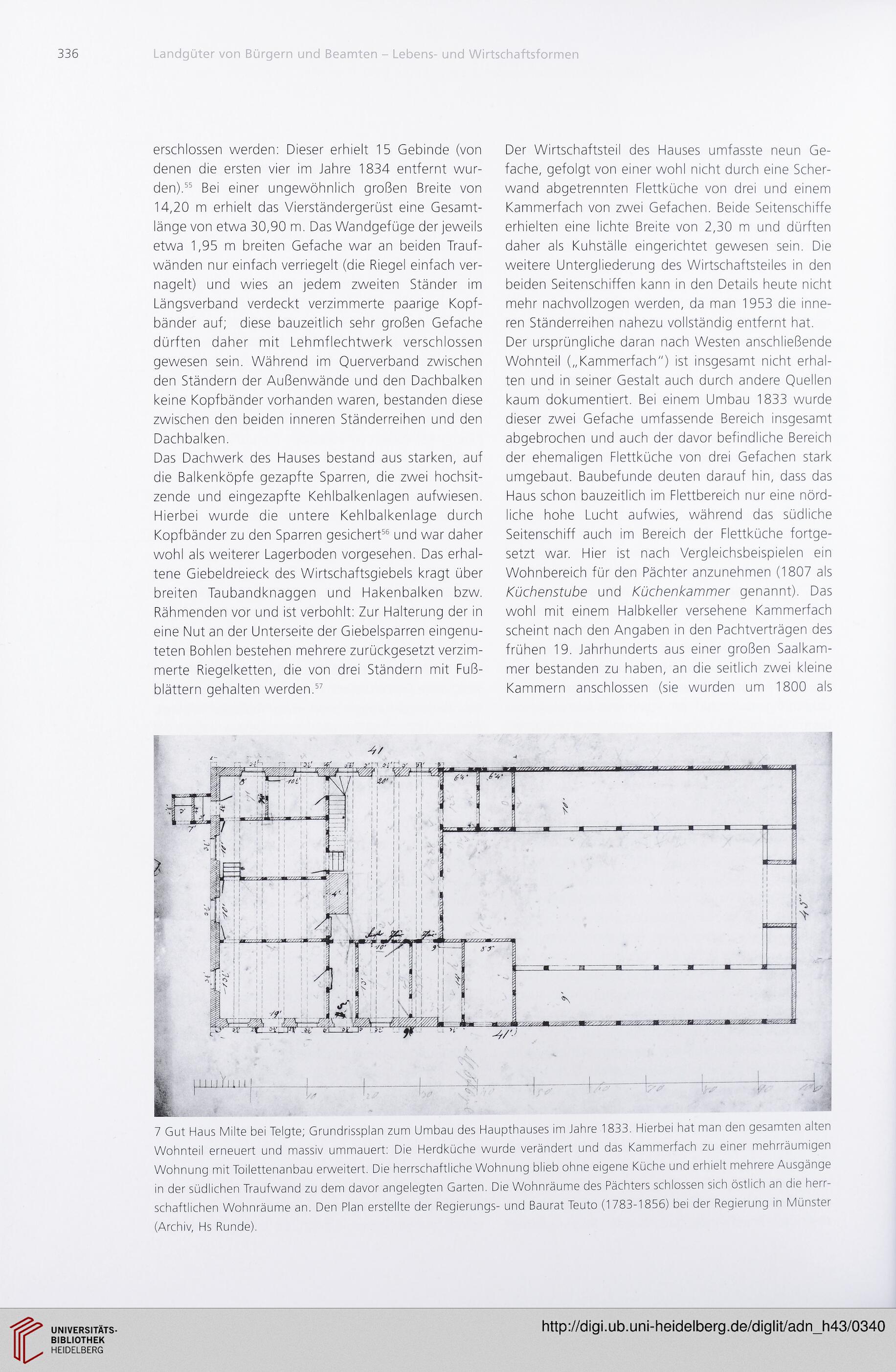336
Landgüter von Bürgern und Beamten - Lebens- und Wirtschaftsformen
erschlossen werden: Dieser erhielt 15 Gebinde (von
denen die ersten vier im Jahre 1834 entfernt wur-
den).55 Bei einer ungewöhnlich großen Breite von
14,20 m erhielt das Vierständergerüst eine Gesamt-
länge von etwa 30,90 m. Das Wandgefüge der jeweils
etwa 1,95 m breiten Gefache war an beiden Trauf-
wänden nur einfach verriegelt (die Riegel einfach ver-
nagelt) und wies an jedem zweiten Ständer im
Längsverband verdeckt verzimmerte paarige Kopf-
bänder auf; diese bauzeitlich sehr großen Gefache
dürften daher mit Lehmflechtwerk verschlossen
gewesen sein. Während im Querverband zwischen
den Ständern der Außenwände und den Dachbalken
keine Kopfbänder vorhanden waren, bestanden diese
zwischen den beiden inneren Ständerreihen und den
Dachbalken.
Das Dachwerk des Hauses bestand aus starken, auf
die Balkenköpfe gezapfte Sparren, die zwei hochsit-
zende und eingezapfte Kehlbalkenlagen aufwiesen.
Hierbei wurde die untere Kehlbalkenlage durch
Kopfbänder zu den Sparren gesichert56 und war daher
wohl als weiterer Lagerboden vorgesehen. Das erhal-
tene Giebeldreieck des Wirtschaftsgiebels kragt über
breiten Taubandknaggen und Hakenbalken bzw.
Rühmenden vor und ist verbohlt: Zur Halterung der in
eine Nut an der Unterseite der Giebelsparren eingenu-
teten Bohlen bestehen mehrere zurückgesetzt verzim-
merte Riegelketten, die von drei Ständern mit Fuß-
blättern gehalten werden.57
Der Wirtschaftsteil des Hauses umfasste neun Ge-
fache, gefolgt von einer wohl nicht durch eine Scher-
wand abgetrennten Flettküche von drei und einem
Kammerfach von zwei Gefachen. Beide Seitenschiffe
erhielten eine lichte Breite von 2,30 m und dürften
daher als Kuhställe eingerichtet gewesen sein. Die
weitere Untergliederung des Wirtschaftsteiles in den
beiden Seitenschiffen kann in den Details heute nicht
mehr nachvollzogen werden, da man 1953 die inne-
ren Ständerreihen nahezu vollständig entfernt hat.
Der ursprüngliche daran nach Westen anschließende
Wohnteil („Kammerfach") ist insgesamt nicht erhal-
ten und in seiner Gestalt auch durch andere Quellen
kaum dokumentiert. Bei einem Umbau 1833 wurde
dieser zwei Gefache umfassende Bereich insgesamt
abgebrochen und auch der davor befindliche Bereich
der ehemaligen Flettküche von drei Gefachen stark
umgebaut. Baubefunde deuten darauf hin, dass das
Haus schon bauzeitlich im Flettbereich nur eine nörd-
liche hohe Lucht aufwies, während das südliche
Seitenschiff auch im Bereich der Flettküche fortge-
setzt war. Hier ist nach Vergleichsbeispielen ein
Wohnbereich für den Pächter anzunehmen (1807 als
Küchenstube und Küchenkammer genannt). Das
wohl mit einem Halbkeller versehene Kammerfach
scheint nach den Angaben in den Pachtverträgen des
frühen 19. Jahrhunderts aus einer großen Saalkam-
mer bestanden zu haben, an die seitlich zwei kleine
Kammern anschlossen (sie wurden um 1800 als
7 Gut Haus Milte bei Telgte; Grundrissplan zum Umbau des Haupthauses im Jahre 1833. Hierbei hat man den gesamten alten
Wohnteil erneuert und massiv ummauert: Die Herdküche wurde verändert und das Kammerfach zu einer mehrräumigen
Wohnung mit Toilettenanbau erweitert. Die herrschaftliche Wohnung blieb ohne eigene Küche und erhielt mehrere Ausgänge
in der südlichen Traufwand zu dem davor angelegten Garten. Die Wohnräume des Pächters schlossen sich östlich an die herr-
schaftlichen Wohnräume an. Den Plan erstellte der Regierungs- und Baurat Teuto (1783-1856) bei der Regierung in Münster
(Archiv, Hs Runde).
Landgüter von Bürgern und Beamten - Lebens- und Wirtschaftsformen
erschlossen werden: Dieser erhielt 15 Gebinde (von
denen die ersten vier im Jahre 1834 entfernt wur-
den).55 Bei einer ungewöhnlich großen Breite von
14,20 m erhielt das Vierständergerüst eine Gesamt-
länge von etwa 30,90 m. Das Wandgefüge der jeweils
etwa 1,95 m breiten Gefache war an beiden Trauf-
wänden nur einfach verriegelt (die Riegel einfach ver-
nagelt) und wies an jedem zweiten Ständer im
Längsverband verdeckt verzimmerte paarige Kopf-
bänder auf; diese bauzeitlich sehr großen Gefache
dürften daher mit Lehmflechtwerk verschlossen
gewesen sein. Während im Querverband zwischen
den Ständern der Außenwände und den Dachbalken
keine Kopfbänder vorhanden waren, bestanden diese
zwischen den beiden inneren Ständerreihen und den
Dachbalken.
Das Dachwerk des Hauses bestand aus starken, auf
die Balkenköpfe gezapfte Sparren, die zwei hochsit-
zende und eingezapfte Kehlbalkenlagen aufwiesen.
Hierbei wurde die untere Kehlbalkenlage durch
Kopfbänder zu den Sparren gesichert56 und war daher
wohl als weiterer Lagerboden vorgesehen. Das erhal-
tene Giebeldreieck des Wirtschaftsgiebels kragt über
breiten Taubandknaggen und Hakenbalken bzw.
Rühmenden vor und ist verbohlt: Zur Halterung der in
eine Nut an der Unterseite der Giebelsparren eingenu-
teten Bohlen bestehen mehrere zurückgesetzt verzim-
merte Riegelketten, die von drei Ständern mit Fuß-
blättern gehalten werden.57
Der Wirtschaftsteil des Hauses umfasste neun Ge-
fache, gefolgt von einer wohl nicht durch eine Scher-
wand abgetrennten Flettküche von drei und einem
Kammerfach von zwei Gefachen. Beide Seitenschiffe
erhielten eine lichte Breite von 2,30 m und dürften
daher als Kuhställe eingerichtet gewesen sein. Die
weitere Untergliederung des Wirtschaftsteiles in den
beiden Seitenschiffen kann in den Details heute nicht
mehr nachvollzogen werden, da man 1953 die inne-
ren Ständerreihen nahezu vollständig entfernt hat.
Der ursprüngliche daran nach Westen anschließende
Wohnteil („Kammerfach") ist insgesamt nicht erhal-
ten und in seiner Gestalt auch durch andere Quellen
kaum dokumentiert. Bei einem Umbau 1833 wurde
dieser zwei Gefache umfassende Bereich insgesamt
abgebrochen und auch der davor befindliche Bereich
der ehemaligen Flettküche von drei Gefachen stark
umgebaut. Baubefunde deuten darauf hin, dass das
Haus schon bauzeitlich im Flettbereich nur eine nörd-
liche hohe Lucht aufwies, während das südliche
Seitenschiff auch im Bereich der Flettküche fortge-
setzt war. Hier ist nach Vergleichsbeispielen ein
Wohnbereich für den Pächter anzunehmen (1807 als
Küchenstube und Küchenkammer genannt). Das
wohl mit einem Halbkeller versehene Kammerfach
scheint nach den Angaben in den Pachtverträgen des
frühen 19. Jahrhunderts aus einer großen Saalkam-
mer bestanden zu haben, an die seitlich zwei kleine
Kammern anschlossen (sie wurden um 1800 als
7 Gut Haus Milte bei Telgte; Grundrissplan zum Umbau des Haupthauses im Jahre 1833. Hierbei hat man den gesamten alten
Wohnteil erneuert und massiv ummauert: Die Herdküche wurde verändert und das Kammerfach zu einer mehrräumigen
Wohnung mit Toilettenanbau erweitert. Die herrschaftliche Wohnung blieb ohne eigene Küche und erhielt mehrere Ausgänge
in der südlichen Traufwand zu dem davor angelegten Garten. Die Wohnräume des Pächters schlossen sich östlich an die herr-
schaftlichen Wohnräume an. Den Plan erstellte der Regierungs- und Baurat Teuto (1783-1856) bei der Regierung in Münster
(Archiv, Hs Runde).