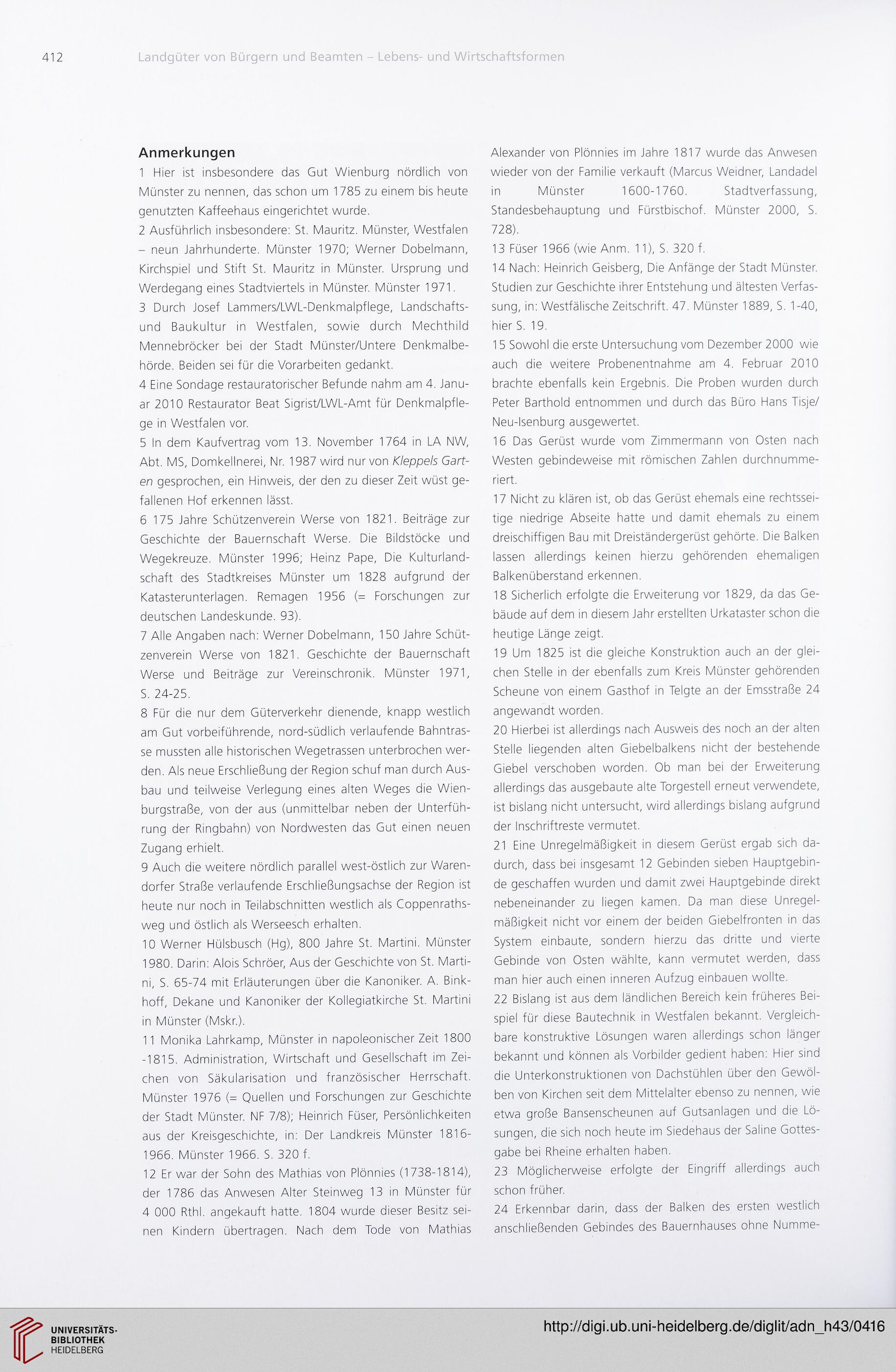412
Landgüter von Bürgern und Beamten - Lebens- und Wirtschaftsformen
Anmerkungen
1 Hier ist insbesondere das Gut Wienburg nördlich von
Münster zu nennen, das schon um 1785 zu einem bis heute
genutzten Kaffeehaus eingerichtet wurde.
2 Ausführlich insbesondere: St. Mauritz. Münster, Westfalen
- neun Jahrhunderte. Münster 1970; Werner Dobelmann,
Kirchspiel und Stift St. Mauritz in Münster. Ursprung und
Werdegang eines Stadtviertels in Münster. Münster 1971.
3 Durch Josef Lammers/LWL-Denkmalpflege, Landschafts-
und Baukultur in Westfalen, sowie durch Mechthild
Mennebröcker bei der Stadt Münster/Untere Denkmalbe-
hörde. Beiden sei für die Vorarbeiten gedankt.
4 Eine Sondage restauratorischer Befunde nahm am 4. Janu-
ar 2010 Restaurator Beat Sigrist/LWL-Amt für Denkmalpfle-
ge in Westfalen vor.
5 In dem Kaufvertrag vom 13. November 1764 in LA NW,
Abt. MS, Domkellnerei, Nr. 1987 wird nur von Kleppels Gart-
en gesprochen, ein Hinweis, der den zu dieser Zeit wüst ge-
fallenen Hof erkennen lässt.
6 175 Jahre Schützenverein Werse von 1821. Beiträge zur
Geschichte der Bauernschaft Werse. Die Bildstöcke und
Wegekreuze. Münster 1996; Heinz Pape, Die Kulturland-
schaft des Stadtkreises Münster um 1828 aufgrund der
Katasterunterlagen. Remagen 1956 (= Forschungen zur
deutschen Landeskunde. 93).
7 Alle Angaben nach: Werner Dobelmann, 150 Jahre Schüt-
zenverein Werse von 1821. Geschichte der Bauernschaft
Werse und Beiträge zur Vereinschronik. Münster 1971,
S. 24-25.
8 Für die nur dem Güterverkehr dienende, knapp westlich
am Gut vorbeiführende, nord-südlich verlaufende Bahntras-
se mussten alle historischen Wegetrassen unterbrochen wer-
den. Als neue Erschließung der Region schuf man durch Aus-
bau und teilweise Verlegung eines alten Weges die Wien-
burgstraße, von der aus (unmittelbar neben der Unterfüh-
rung der Ringbahn) von Nordwesten das Gut einen neuen
Zugang erhielt.
9 Auch die weitere nördlich parallel west-östlich zur Waren-
dorfer Straße verlaufende Erschließungsachse der Region ist
heute nur noch in Teilabschnitten westlich als Coppenraths-
weg und östlich als Werseesch erhalten.
10 Werner Hülsbusch (Hg), 800 Jahre St. Martini. Münster
1980. Darin: Alois Schröer, Aus der Geschichte von St. Marti-
ni, S. 65-74 mit Erläuterungen über die Kanoniker. A. Bink-
hoff, Dekane und Kanoniker der Kollegiatkirche St. Martini
in Münster (Mskr.).
11 Monika Lahrkamp, Münster in napoleonischer Zeit 1800
-1815. Administration, Wirtschaft und Gesellschaft im Zei-
chen von Säkularisation und französischer Herrschaft.
Münster 1976 (= Quellen und Forschungen zur Geschichte
der Stadt Münster. NF 7/8); Heinrich Füser, Persönlichkeiten
aus der Kreisgeschichte, in: Der Landkreis Münster 1816-
1966. Münster 1966. S. 320 f.
12 Er war der Sohn des Mathias von Plönnies (1738-1814),
der 1786 das Anwesen Alter Steinweg 13 in Münster für
4 000 Rthl. angekauft hatte. 1804 wurde dieser Besitz sei-
nen Kindern übertragen. Nach dem Tode von Mathias
Alexander von Plönnies im Jahre 1817 wurde das Anwesen
wieder von der Familie verkauft (Marcus Weidner, Landadel
in Münster 1600-1760. Stadtverfassung,
Standesbehauptung und Fürstbischof. Münster 2000, S.
728).
13 Füser 1966 (wie Anm. 11), S. 320 f.
14 Nach: Heinrich Geisberg, Die Anfänge der Stadt Münster.
Studien zur Geschichte ihrer Entstehung und ältesten Verfas-
sung, in: Westfälische Zeitschrift. 47. Münster 1889, S. 1-40,
hier S. 19.
15 Sowohl die erste Untersuchung vom Dezember 2000 wie
auch die weitere Probenentnahme am 4. Februar 2010
brachte ebenfalls kein Ergebnis. Die Proben wurden durch
Peter Barthold entnommen und durch das Büro Hans Tisje/
Neu-Isenburg ausgewertet.
16 Das Gerüst wurde vom Zimmermann von Osten nach
Westen gebindeweise mit römischen Zahlen durchnumme-
riert.
17 Nicht zu klären ist, ob das Gerüst ehemals eine rechtssei-
tige niedrige Abseite hatte und damit ehemals zu einem
dreischiffigen Bau mit Dreiständergerüst gehörte. Die Balken
lassen allerdings keinen hierzu gehörenden ehemaligen
Balkenüberstand erkennen.
18 Sicherlich erfolgte die Erweiterung vor 1829, da das Ge-
bäude auf dem in diesem Jahr erstellten Urkataster schon die
heutige Länge zeigt.
19 Um 1825 ist die gleiche Konstruktion auch an der glei-
chen Stelle in der ebenfalls zum Kreis Münster gehörenden
Scheune von einem Gasthof in Telgte an der Emsstraße 24
angewandt worden.
20 Hierbei ist allerdings nach Ausweis des noch an der alten
Stelle liegenden alten Giebelbalkens nicht der bestehende
Giebel verschoben worden. Ob man bei der Erweiterung
allerdings das ausgebaute alte Torgestell erneut verwendete,
ist bislang nicht untersucht, wird allerdings bislang aufgrund
der Inschriftreste vermutet.
21 Eine Unregelmäßigkeit in diesem Gerüst ergab sich da-
durch, dass bei insgesamt 12 Gebinden sieben Hauptgebin-
de geschaffen wurden und damit zwei Hauptgebinde direkt
nebeneinander zu liegen kamen. Da man diese Unregel-
mäßigkeit nicht vor einem der beiden Giebelfronten in das
System einbaute, sondern hierzu das dritte und vierte
Gebinde von Osten wählte, kann vermutet werden, dass
man hier auch einen inneren Aufzug einbauen wollte.
22 Bislang ist aus dem ländlichen Bereich kein früheres Bei-
spiel für diese Bautechnik in Westfalen bekannt. Vergleich-
bare konstruktive Lösungen waren allerdings schon länger
bekannt und können als Vorbilder gedient haben: Hier sind
die Unterkonstruktionen von Dachstühlen über den Gewöl-
ben von Kirchen seit dem Mittelalter ebenso zu nennen, wie
etwa große Bansenscheunen auf Gutsanlagen und die Lö-
sungen, die sich noch heute im Siedehaus der Saline Gottes-
gabe bei Rheine erhalten haben.
23 Möglicherweise erfolgte der Eingriff allerdings auch
schon früher.
24 Erkennbar darin, dass der Balken des ersten westlich
anschließenden Gebindes des Bauernhauses ohne Numme-
Landgüter von Bürgern und Beamten - Lebens- und Wirtschaftsformen
Anmerkungen
1 Hier ist insbesondere das Gut Wienburg nördlich von
Münster zu nennen, das schon um 1785 zu einem bis heute
genutzten Kaffeehaus eingerichtet wurde.
2 Ausführlich insbesondere: St. Mauritz. Münster, Westfalen
- neun Jahrhunderte. Münster 1970; Werner Dobelmann,
Kirchspiel und Stift St. Mauritz in Münster. Ursprung und
Werdegang eines Stadtviertels in Münster. Münster 1971.
3 Durch Josef Lammers/LWL-Denkmalpflege, Landschafts-
und Baukultur in Westfalen, sowie durch Mechthild
Mennebröcker bei der Stadt Münster/Untere Denkmalbe-
hörde. Beiden sei für die Vorarbeiten gedankt.
4 Eine Sondage restauratorischer Befunde nahm am 4. Janu-
ar 2010 Restaurator Beat Sigrist/LWL-Amt für Denkmalpfle-
ge in Westfalen vor.
5 In dem Kaufvertrag vom 13. November 1764 in LA NW,
Abt. MS, Domkellnerei, Nr. 1987 wird nur von Kleppels Gart-
en gesprochen, ein Hinweis, der den zu dieser Zeit wüst ge-
fallenen Hof erkennen lässt.
6 175 Jahre Schützenverein Werse von 1821. Beiträge zur
Geschichte der Bauernschaft Werse. Die Bildstöcke und
Wegekreuze. Münster 1996; Heinz Pape, Die Kulturland-
schaft des Stadtkreises Münster um 1828 aufgrund der
Katasterunterlagen. Remagen 1956 (= Forschungen zur
deutschen Landeskunde. 93).
7 Alle Angaben nach: Werner Dobelmann, 150 Jahre Schüt-
zenverein Werse von 1821. Geschichte der Bauernschaft
Werse und Beiträge zur Vereinschronik. Münster 1971,
S. 24-25.
8 Für die nur dem Güterverkehr dienende, knapp westlich
am Gut vorbeiführende, nord-südlich verlaufende Bahntras-
se mussten alle historischen Wegetrassen unterbrochen wer-
den. Als neue Erschließung der Region schuf man durch Aus-
bau und teilweise Verlegung eines alten Weges die Wien-
burgstraße, von der aus (unmittelbar neben der Unterfüh-
rung der Ringbahn) von Nordwesten das Gut einen neuen
Zugang erhielt.
9 Auch die weitere nördlich parallel west-östlich zur Waren-
dorfer Straße verlaufende Erschließungsachse der Region ist
heute nur noch in Teilabschnitten westlich als Coppenraths-
weg und östlich als Werseesch erhalten.
10 Werner Hülsbusch (Hg), 800 Jahre St. Martini. Münster
1980. Darin: Alois Schröer, Aus der Geschichte von St. Marti-
ni, S. 65-74 mit Erläuterungen über die Kanoniker. A. Bink-
hoff, Dekane und Kanoniker der Kollegiatkirche St. Martini
in Münster (Mskr.).
11 Monika Lahrkamp, Münster in napoleonischer Zeit 1800
-1815. Administration, Wirtschaft und Gesellschaft im Zei-
chen von Säkularisation und französischer Herrschaft.
Münster 1976 (= Quellen und Forschungen zur Geschichte
der Stadt Münster. NF 7/8); Heinrich Füser, Persönlichkeiten
aus der Kreisgeschichte, in: Der Landkreis Münster 1816-
1966. Münster 1966. S. 320 f.
12 Er war der Sohn des Mathias von Plönnies (1738-1814),
der 1786 das Anwesen Alter Steinweg 13 in Münster für
4 000 Rthl. angekauft hatte. 1804 wurde dieser Besitz sei-
nen Kindern übertragen. Nach dem Tode von Mathias
Alexander von Plönnies im Jahre 1817 wurde das Anwesen
wieder von der Familie verkauft (Marcus Weidner, Landadel
in Münster 1600-1760. Stadtverfassung,
Standesbehauptung und Fürstbischof. Münster 2000, S.
728).
13 Füser 1966 (wie Anm. 11), S. 320 f.
14 Nach: Heinrich Geisberg, Die Anfänge der Stadt Münster.
Studien zur Geschichte ihrer Entstehung und ältesten Verfas-
sung, in: Westfälische Zeitschrift. 47. Münster 1889, S. 1-40,
hier S. 19.
15 Sowohl die erste Untersuchung vom Dezember 2000 wie
auch die weitere Probenentnahme am 4. Februar 2010
brachte ebenfalls kein Ergebnis. Die Proben wurden durch
Peter Barthold entnommen und durch das Büro Hans Tisje/
Neu-Isenburg ausgewertet.
16 Das Gerüst wurde vom Zimmermann von Osten nach
Westen gebindeweise mit römischen Zahlen durchnumme-
riert.
17 Nicht zu klären ist, ob das Gerüst ehemals eine rechtssei-
tige niedrige Abseite hatte und damit ehemals zu einem
dreischiffigen Bau mit Dreiständergerüst gehörte. Die Balken
lassen allerdings keinen hierzu gehörenden ehemaligen
Balkenüberstand erkennen.
18 Sicherlich erfolgte die Erweiterung vor 1829, da das Ge-
bäude auf dem in diesem Jahr erstellten Urkataster schon die
heutige Länge zeigt.
19 Um 1825 ist die gleiche Konstruktion auch an der glei-
chen Stelle in der ebenfalls zum Kreis Münster gehörenden
Scheune von einem Gasthof in Telgte an der Emsstraße 24
angewandt worden.
20 Hierbei ist allerdings nach Ausweis des noch an der alten
Stelle liegenden alten Giebelbalkens nicht der bestehende
Giebel verschoben worden. Ob man bei der Erweiterung
allerdings das ausgebaute alte Torgestell erneut verwendete,
ist bislang nicht untersucht, wird allerdings bislang aufgrund
der Inschriftreste vermutet.
21 Eine Unregelmäßigkeit in diesem Gerüst ergab sich da-
durch, dass bei insgesamt 12 Gebinden sieben Hauptgebin-
de geschaffen wurden und damit zwei Hauptgebinde direkt
nebeneinander zu liegen kamen. Da man diese Unregel-
mäßigkeit nicht vor einem der beiden Giebelfronten in das
System einbaute, sondern hierzu das dritte und vierte
Gebinde von Osten wählte, kann vermutet werden, dass
man hier auch einen inneren Aufzug einbauen wollte.
22 Bislang ist aus dem ländlichen Bereich kein früheres Bei-
spiel für diese Bautechnik in Westfalen bekannt. Vergleich-
bare konstruktive Lösungen waren allerdings schon länger
bekannt und können als Vorbilder gedient haben: Hier sind
die Unterkonstruktionen von Dachstühlen über den Gewöl-
ben von Kirchen seit dem Mittelalter ebenso zu nennen, wie
etwa große Bansenscheunen auf Gutsanlagen und die Lö-
sungen, die sich noch heute im Siedehaus der Saline Gottes-
gabe bei Rheine erhalten haben.
23 Möglicherweise erfolgte der Eingriff allerdings auch
schon früher.
24 Erkennbar darin, dass der Balken des ersten westlich
anschließenden Gebindes des Bauernhauses ohne Numme-