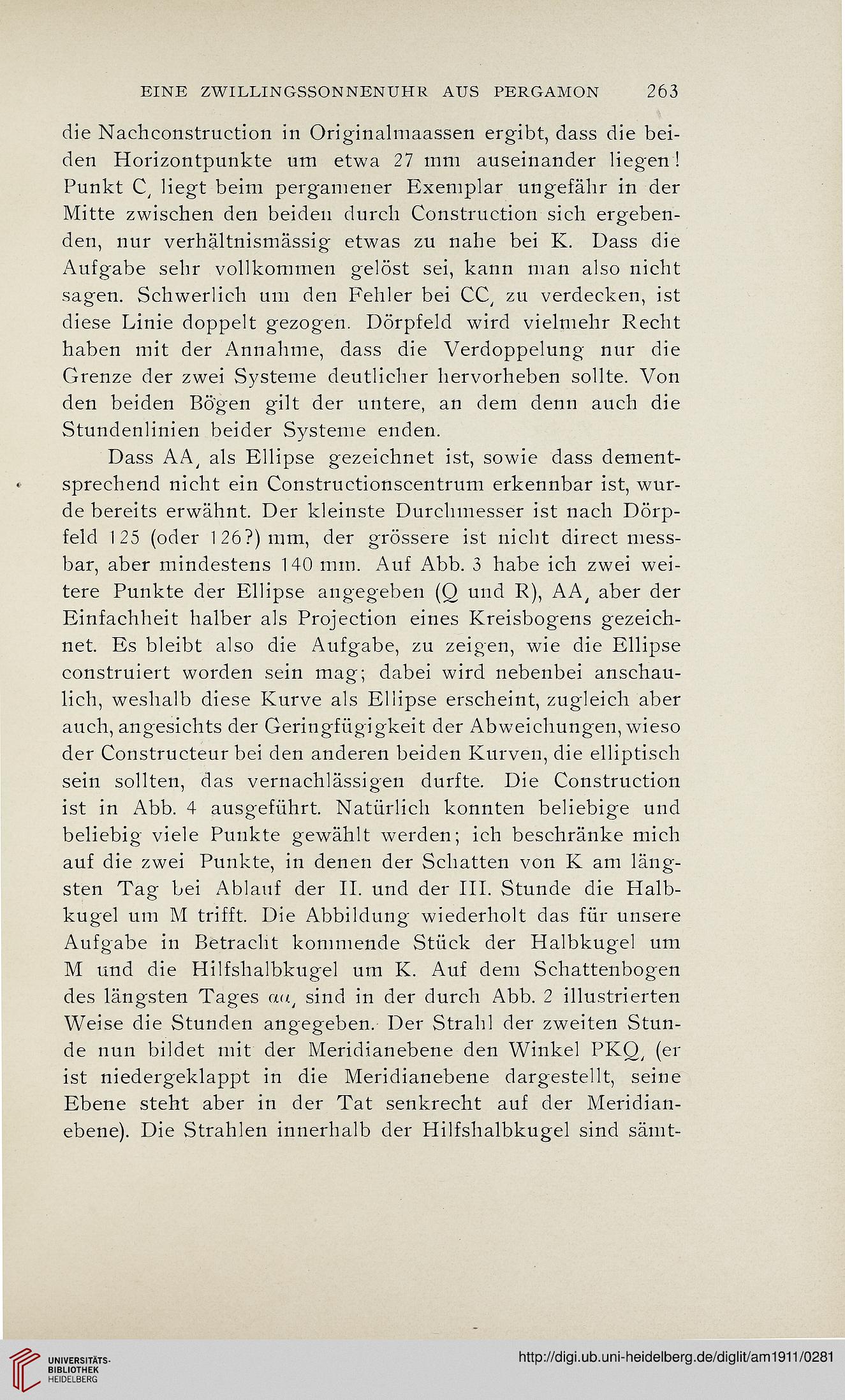EINE ZWILLINGSSONNENUHR AUS PERGAMON
263
die Nachconstruction in Originalmaassen ergibt, dass die bei-
den Horizontpunkte um etwa 27 mm auseinander liegen!
Punkt C, liegt beim pergamener Exemplar ungefähr in der
Mitte zwischen den beiden durch Construction sich ergeben-
den, nur verhältnismässig etwas zu nahe bei K. Dass die
Aufgabe sehr vollkommen gelöst sei, kann man also nicht
sagen. Schwerlich um den Fehler bei CC, zu verdecken, ist
diese Linie doppelt gezogen. Dörpfeld wird vielmehr Recht
haben mit der Annahme, dass die Verdoppelung nur die
Grenze der zwei Systeme deutlicher hervorheben sollte. Von
den beiden Bögen gilt der untere, an dem denn auch die
Stundenlinien beider Systeme enden.
Dass AA, als Ellipse gezeichnet ist, sowie dass dement-
sprechend nicht ein Constructionscentrum erkennbar ist, wur-
de bereits erwähnt. Der kleinste Durchmesser ist nach Dörp-
feld 125 (oder 126?) mm, der grössere ist nicht direct mess-
bar, aber mindestens 140 mm. Auf Abb. 3 habe ich zwei wei-
tere Punkte der Ellipse angegeben (Q und R), AA, aber der
Einfachheit halber als Projection eines Kreisbogens gezeich-
net. Es bleibt also die Aufgabe, zu zeigen, wie die Ellipse
construiert worden sein mag; dabei wird nebenbei anschau-
lich, weshalb diese Kurve als Ellipse erscheint, zugleich aber
auch, angesichts der Geringfügigkeit der Abweichungen, wieso
der Constructeur bei den anderen beiden Kurven, die elliptisch
sein sollten, das vernachlässigen durfte. Die Construction
ist in Abb. 4 ausgeführt. Natürlich konnten beliebige und
beliebig viele Punkte gewählt werden; ich beschränke mich
auf die zwei Punkte, in denen der Schatten von K am läng-
sten Tag bei Ablauf der II. und der III. Stunde die Halb-
kugel um M trifft. Die Abbildung wiederholt das für unsere
Aufgabe in Betracht kommende Stück der Halbkugel um
M und die Hilfshalbkugel um K. Auf dem Schattenbogen
des längsten Tages an, sind in der durch Abb. 2 illustrierten
Weise die Stunden angegeben. Der Strahl der zweiten Stun-
de nun bildet mit der Meridianebene den Winkel PKQ, (er
ist niedergeklappt in die Meridianebene dargestellt, seine
Ebene steht aber in der Tat senkrecht auf der Meridian-
ebene). Die Strahlen innerhalb der Hilfshalbkugel sind sämt-
263
die Nachconstruction in Originalmaassen ergibt, dass die bei-
den Horizontpunkte um etwa 27 mm auseinander liegen!
Punkt C, liegt beim pergamener Exemplar ungefähr in der
Mitte zwischen den beiden durch Construction sich ergeben-
den, nur verhältnismässig etwas zu nahe bei K. Dass die
Aufgabe sehr vollkommen gelöst sei, kann man also nicht
sagen. Schwerlich um den Fehler bei CC, zu verdecken, ist
diese Linie doppelt gezogen. Dörpfeld wird vielmehr Recht
haben mit der Annahme, dass die Verdoppelung nur die
Grenze der zwei Systeme deutlicher hervorheben sollte. Von
den beiden Bögen gilt der untere, an dem denn auch die
Stundenlinien beider Systeme enden.
Dass AA, als Ellipse gezeichnet ist, sowie dass dement-
sprechend nicht ein Constructionscentrum erkennbar ist, wur-
de bereits erwähnt. Der kleinste Durchmesser ist nach Dörp-
feld 125 (oder 126?) mm, der grössere ist nicht direct mess-
bar, aber mindestens 140 mm. Auf Abb. 3 habe ich zwei wei-
tere Punkte der Ellipse angegeben (Q und R), AA, aber der
Einfachheit halber als Projection eines Kreisbogens gezeich-
net. Es bleibt also die Aufgabe, zu zeigen, wie die Ellipse
construiert worden sein mag; dabei wird nebenbei anschau-
lich, weshalb diese Kurve als Ellipse erscheint, zugleich aber
auch, angesichts der Geringfügigkeit der Abweichungen, wieso
der Constructeur bei den anderen beiden Kurven, die elliptisch
sein sollten, das vernachlässigen durfte. Die Construction
ist in Abb. 4 ausgeführt. Natürlich konnten beliebige und
beliebig viele Punkte gewählt werden; ich beschränke mich
auf die zwei Punkte, in denen der Schatten von K am läng-
sten Tag bei Ablauf der II. und der III. Stunde die Halb-
kugel um M trifft. Die Abbildung wiederholt das für unsere
Aufgabe in Betracht kommende Stück der Halbkugel um
M und die Hilfshalbkugel um K. Auf dem Schattenbogen
des längsten Tages an, sind in der durch Abb. 2 illustrierten
Weise die Stunden angegeben. Der Strahl der zweiten Stun-
de nun bildet mit der Meridianebene den Winkel PKQ, (er
ist niedergeklappt in die Meridianebene dargestellt, seine
Ebene steht aber in der Tat senkrecht auf der Meridian-
ebene). Die Strahlen innerhalb der Hilfshalbkugel sind sämt-