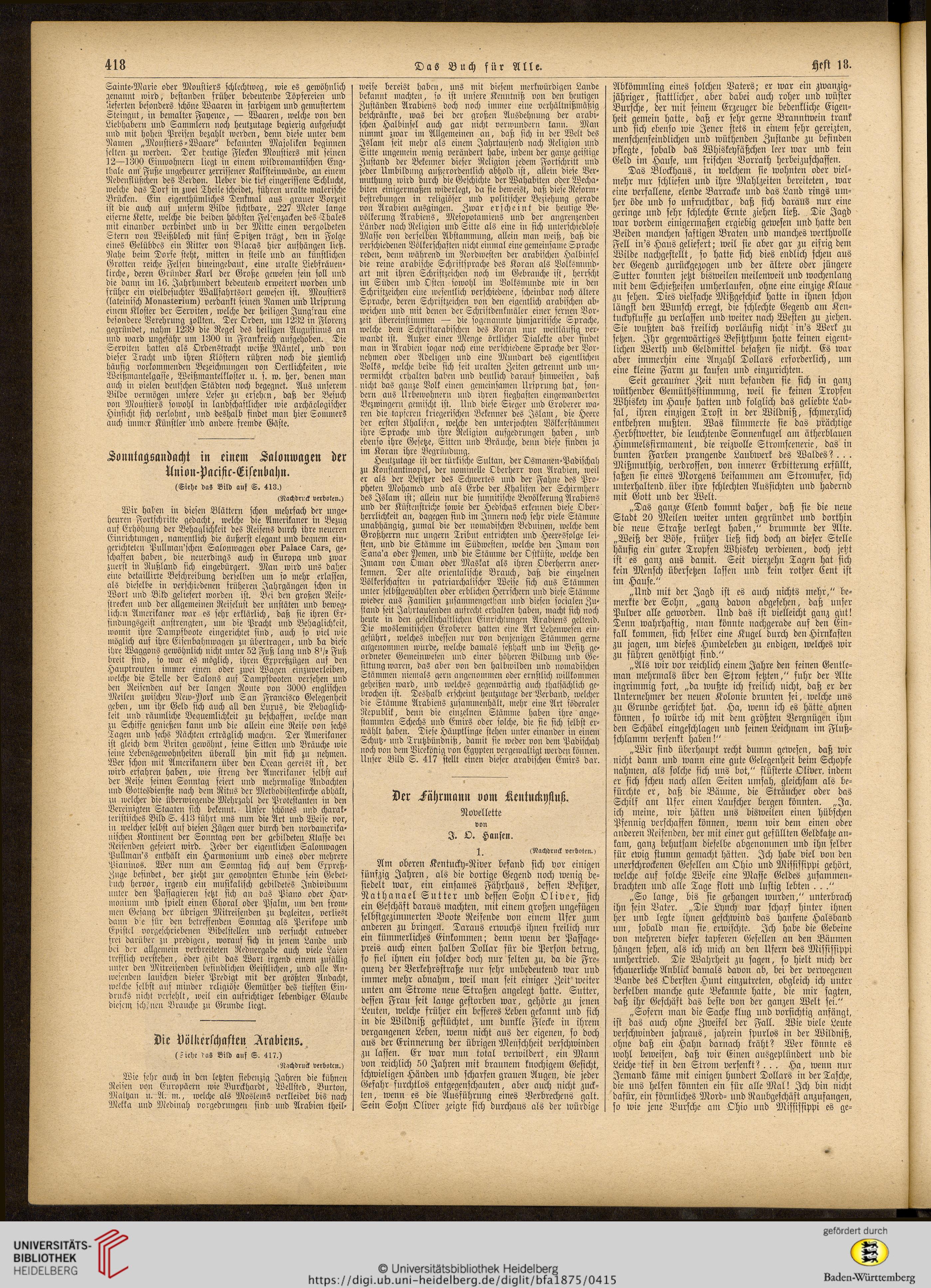418
Sainte-Marie oder Moustiers schlechtweg, wie es gewöhnlich
genannt wird, bestanden früher bedeutende Töpfereien und
lieferten besonders schöne Maaren in farbigem und gemustertem
Steingut, in bemalter Fayence, — Maaren, welche von den
Liebhabern und Sammlern noch heutzutage begierig ausgesucht
und mit hohen Preisen bezahlt werden, denn diese unter dem
Namen „Moustiers-Maare" bekannten Majoliken beginnen
selten zu werden. Der heutige Flecken Moustiers mit seinen
12—1800 Einwohnern liegt in einem wildromantischen Eug-
thale am Fuße ungeheurer zerrissener Kalksteinwände, an einein
Nebenflüßchen des Verdon, lieber die tief eingerisseue Schlucht,
welche das Dorf in zwei Theile scheidet, führen uralte malerische
Brücken. Ein eigenthümliches Denkmal aus grauer Vorzeit
ist die auch auf uuserm Bilde sichtbare, 227 Meter lange
eiserne Kette, welche die beiden höchsten Felftuzacken des Thales
mit einander verbindet und in der Mitte einen vergoldeten
Stern von Weißblech mit fünf Spitzen tragt, den in Folge
eines Gelübdes ein Ritter von Blacas hier aufhängen ließ.
Nahe beim Dorfe steht, mitten in steile und an künstlichen
Grotten reiche Felsen kineiugebaut, eine uralte Liebfräuen-
lirche, deren Gründer Karl der Große gewesen sein soll und
die dann im 16. Jahrhundert bedeutend erweitert worden und
früher ein vielbesuchter Wallfahrtsort gewesen ist. Moustiers
(lateinisch Nouastsriuiv) verdankt seinen Namen und Ursprung
einem Kloster der Serviten, welche der heiligen Jungfrau eine
besondere Verehrung zollten. Der Orden, um 1232 in Florenz
gegründet, nahm 1239 die Regel des heiligen Augustinus an
und ward ungefähr um 1300 in Frankreich aufgehoben. Die
Serviten hatten als Ordenstracht weiße Mäntel, und von
dieser Tracht und ihren Klöstern rühren noch die ziemlich
häufig verkommenden Bezeichnungen von Oertlichkeiten, wie
Meißmautelgasse, Weißmantelkloster u. s. w. her, denen mau
auch in vielen deutschen Städten noch begegnet. Aus unserem
Bilde vermögen unsere Leser zu ersehen, daß der Besuch
von Moustiers sowohl in landschaftlicher wie archäologischer
Hinsicht sich verlohnt, und deshalb findet man hier Sommers
auch immer Künstler und andere fremde Gäste.
Sonlltligsall-gcht in einem Salonwagen der
Anion-Parific-Eisenbahn.
(Siehe das Bild aus S. 413.)
(Nachdruck verboten.)
Wir haben in diesen Blättern schon mehrfach der unge-
heuren Fortschritte gedacht, welche die Amerikaner in Bezug
auf Erhöhung der Behaglichkeit des Reisens durch ihre neueren
Einrichtungen, namentlich die äußerst elegant und bequem ein-
gerichteten Pullmaüfchen Salonwagen oder kulaes Ours, ge-
schaffen haben, die neuerdings auch in Europa und zwar
zuerst in Rußland sich eingebürgert. Man wird uns daher
eine betaillirte Beschreibung derselben um so mehr erlassen,
als dieselbe in verschiedenen früheren Jahrgängen schon in
Wort und Bild.geliefert worden ist. Bei den großen Reise-
strecken und der allgemeinen Reiselust der uustäten und beweg-
lichen Amerikaner war es sehr erklärlich, daß sie ihren Er-
fiuduugsgeist nnstreugten, um die Pracht und Behaglichkeit,
womit ihre Dampfboote eingerichtet sind, auch so viel wie
möglich auf ihre Eisenbahnwagen zu übertragen, und da diese
ihre Waggons gewöhnlich nicht unter 52 Fuß iaug und 8ftr Fuß
breit sind, so war es möglich, ihren Expreßzügen auf den
Hauptrouten immer einen oder zwei Wagen eiuzuverleiben,
welche die Stelle der Salons auf Dampfbooten versehen und
den Reisenden auf der langen Route von 3000 englischen
Meilen zwischen New-Port und San Francisco Gelegenheit
geben, um ihr Geld sich auch all den Luxus, die Behaglich-
keit und räumliche Bequemlichkeit zu beschaffen, welche man
zu Schiffe genießen kann und die allein eine Reise von sechs
Tagen und sechs Nächten erträglich machen. Der Amerikaner
ist gleich dem Briten gewöhnt, seine Sitten und Bräuche wie
seine Lebensgewohnheiten überall hin mit sich zu nehmen.
Wer schon mit Amerikanern über den Ocean gereist ist, der
ivird erfahren haben, wie streng der Amerikaner selbst auf
der Reise seinen Sonntag feiert und mehrmalige Andachten
und Gottesdienste nach dem Ritus der Methodisteukirche abhält,
zu welcher die überwiegende Mehrzahl der Protestanten in den
Vereinigten Staaten sich bekennt. Unser schönes und charak-
teristisches Bild S. 413 führt uns nun die Art und Weise vor,
in welcher selbst auf diesen Zügen quer durch den uordamerika-
uischen Kontinent der Sonntag von der gebildeten Klasse der
Reisenden gefeiert wird. Jeder der eigentlichen Salonwagen
Pullman's enthält ein Harmonium und eines oder mehrere
Piauiuos. Wer nun am Sonntag sich auf dem Expreß-
Zuge befindet, der zieht zur gewohnten Stunde fein Gebet-
buch hervor, irgend ein musikalisch gebildetes Individuum
unter den Passagieren seht sich an das Piano oder Har-
monium und spielt einen Choral oder Psalm, nm den from-
men Gesang der übrigen Mitreisenden zu begleiten, verliest
daun die für den betreffenden Sonntag als Perikope und
Epistel vorgeschriebeueu Bibelstelleu und versucht entweder
frei darüber zn predigen, worauf sich in jenem Laude und
bei der allgemein verbreiteten Rednergabe auch viele Laien
trefflich verstehen, oder gibt das Wort irgend einem zufällig
unter den Mitreisenden befindlichen Geistlichen, und alle An-
wesenden lauschen dieser Predigt mit der größten Andacht,
welche selbst auf minder religiöse Gemüther des tiefsten Ein-
drucks nicht verfehlt, weil ein aufrichtiger lebendiger Glaube
diesem scheuen Branche zu Grunde liegt.
Die Völkerschaften Arabiens.
(siche las Bild auf S. 417.)
-Nachdruck vcrbotcn.)
Wie sehr auch in den letzten siebeuzig Jahren die kühnen
Reisen von Europäern ivie Vurckhardt, Wellsted, Burton,
Maltzan n. A. in., welche als Moslems verkleidet bis nach
Mekka und Mediuah vorgedrungen sind und Arabien theil-
Das Buch für Alle.
Heft 18.
weise bereist haben, uns mit diesem merkwürdigen Lande
bekannt machten, so ist unsere Kenutuiß von den heutigen
Zuständen Arabiens doch noch immer eine verhältnißmäßig
beschränkte, was bei der großen Ausdehnung der arabi-
schen Halbinsel auch gar nicht verwundern kann. Man
nimmt zwar im Allgemeinen an, daß sich in der Welt des
Islam seit mehr als einem Jahrtausend nach Religion und
Sitte ungemein wenig verändert habe, indem der ganze geistige
Zustand der Bekenner dieser Religion jedem Fortschritt und
jeder Umbildung außerordentlich abhold ist, allein diese Ver-
muthuug wird durch die Geschichte der Wahabiten oder Wecha-
biteu einigermaßen widerlegt, da sie beweist, daß diese Reform-
bestrebungen in religiöser und politischer Beziehung gerade
von Arabien ausgingen. Zwar erscheint die heutige Be-
völkerung Arabiens, Mesopotamiens und der angrenzenden
Länder nach Religion und Sitte als eine in sich nnterschiedlose
Masse von derselben Abstammung, allein man weiß, daß die
verschiedenen Völkerschaften nicht einmal eine gemeinsame Sprache
reden, denn während im Nordwesten der arabischen Halbinsel
die reine arabische Schriftsprache des Koran als Volksmund-
nrt mit ihren Schriftzeichen noch im Gebrauche ist, herrscht
im Süden und Osten sowohl im Volksmunde wie iu den
Schristzeicheu eine wesentlich verschiedene, scheinbar noch ältere
Sprache, deren Schriftzeichen von den eigentlich arabischen ab-
weichen und mit denen der Schriftdenkmäler einer fernen Vor-
zeit übereinstimmeu — die sogenannte himjaritische Sprache,
welche dem Schriftarabischcn des Koran nur weitläufig ver-
wandt ist. Außer einer Menge örtlicher Dialekte aber findet
mau in Arabien sogar noch eine verschiedene Sprache der Vor-
nehmen oder Adeligen und eine Mundart des eigentlichen
Volks, welche beide sich seit uralten Zeiten getrennt und un-
vermischt erhalten haben und deutlich darauf Hinweisen, daß
nicht das ganze Volk einen gemeinsamen Ursprung hat, son-
dern aus Urbewohnern und ihren sieghaften eiugewanderten
Bezwingern gemischt ist. Und diese Sieger und Eroberer wa-
ren die tapferen kriegerischen Bekenner des Islam, die Heere
der ersten Khalifen, welche den unterjochten Völkerstämmen
ihre Sprache und ihre Religion aufgedrungen haben, und
ebenso ihre Gesetze, Sitten und Bräuche, denn diese finden ja
im Koran ihre Begründung.
Heutzutage ist der türkische Sultan, der Osmanen-Padischah
zu Konstantinopel, der uominelle Oberherr von Arabien, weil
er als der Besitzer des Schwertes und der Fahne des Pro-
pheten Mohamed und als Erbe der Khalifen der Schirmherr
des Islam ist; allein nur die sunnitische Bevölkerung Arabiens
und der Küstenstriche sowie der Hedschas erkennen diese Ober-
herrlichkeit an, dagegen sind im Innern noch sehr viele Stämme
unabhängig, zumal die der nomadischen Beduinen, welche dem
Großherrn nur ungern Tribut entrichten und Heeresfolge lei-
sten, und die Stämme im Südwesten, welche den Imam von
Sana'a oder Pemeu, und die Stämme der Ostküste, welche den
Imam von Oman oder Maskat als ihren Oberherrn aner-
kennen. Der alte orientalische Brauch, daß die einzelnen
Völkerschaften in patriarchalischer Weise sich aus Stämmen
unter selbstgewählteu oder erblichen Herrschern und diese Stämme
wieder aus Familien zusainmengethan und diesen socialen Zu-
stand seit Jahrtausenden ausrecht erhalten haben, macht sich noch
heute in den gesellschastlichen Einrichtungen Arabiens geltend.
Die moslemitischeu Eroberer hatten eine Art Lehenwefen ein-
gesührt, welches indessen nur von denjenigen Stämmen gerne
angenommen würde, welche damals seßhaft und im Besitz ge-
ordneter Gemeinwesen und einer höheren Bildung und Ge-
sittung waren, das aber von den halbwilden und nomadischen
Stämmen niemals gern angenommen oder ernstlich willkommen
geheißen ward, und welches gegenwärtig auch thatsächlich ge-
brochen ist. Deshalb erscheint heutzutage der Verband, welcher
die Stämme Arabiens zusammeuhält, mehr eine Art föderaler
Republik, denn die einzelnen Stämme haben ihre ange-
stammten Schechs und Emirs oder solche, die sie sich selbst er-
wählt haben. Diese Häuptlinge stehen unter einander in einem
Schutz- und Trutzbündniß, damit sie weder von dem Padischah
»och von dem Vicekönig von Egypten vergewaltigt werden können.
Unser Bild S. 417 stellt einen dieser arabischen Emirs dar.
Der Fährmann vom Kentuckyfluß.
Novellette
von
I. O. Hausen.
(Nachdruck »erboten.)
Am oberen Kentucky-River befand sich vor einigen
fünfzig Jahren, als die dortige Gegend noch wenig be-
siedelt war, ein einsames Fährhaus, dessen Besitzer,
Nathanael Sutter und dessen Sohn -Oliver, sich
ein Geschäft daraus machten, mit einem großen ungefügen
selbstgczimmerten Boote Reisende von einem Ufer zum
anderen zu bringen. Daraus erwuchs ihnen freilich nur
ein kümmerliches Einkommen; denn wenn der Passage-
Preis auch einen halben Dollar für die Person betrug,
so fiel ihnen ein solcher doch nur selten zu, da die Fre-
quenz der Verkehrsstraße nur sehr unbedeutend war und
immer mehr abnahm, weil man seit einiger Zeill weiter
unten am Strome neue Straßen angelegt hatte. Sutter,
dessen Frau seit lange gestorben war, gehörte zu jenen
Leuten, welche früher ein besseres Leben gekannt und sich
in die Wildniß geflüchtet, um dunkle Flecke in ihrem
vergangenen Leben, wenn nicht ans der eigenen, so doch
aus der Erinnerung der übrigen Menschheit verschwinden
zu lassen. Er war nun total verwildert, ein Mann
von reichlich 50 Jahren nnt braunem knochigem Gesicht,
schwieligen Händen und scharfen grauen Augen, die jeder
Gefahr furchtlos entgegenschauten, aber auch nicht zuck-
ten, wenn es die Ausführung eines Verbrechens galt.
Sein Sohn Oliver zeigte sich durchaus als der würdige
Abkömmling eines solchen Vaters; er war ein zwanzig-
jähriger, stattlicher, aber dabei auch roher und wüster
Bursche, der mit seinem Erzeuger die bedenkliche Eigen-
heit gemein hatte, daß er sehr gerne Branntwein trank
und sich ebenso wie Jener stets in einem sehr gereizten,
menschenfeindlichen und wüthenden Zustande zu befinden
pflegte, sobald das Whiskehfüßchen leer war und kein
Geld im Hause, um frischen Vorrath herbeizuschaffen.
Das Blockhaus, in welchen: sie wohnten oder viel-
mehr nur schliefen und ihre Mahlzeiten bereiteten, war
eine verfallene, elende Barracke und das Land rings um-
her öde und so unfruchtbar, daß sich daraus nur eine
geringe und sehr schlechte Ernte ziehen ließ. Die Jagd
war vordem einigermaßen ergiebig gewesen und hatte den
Beiden manchen saftigen Braten und manches werthvolle
Fell in's Haus geliefert; weil sie aber gar zu eifrig dem
Wilde nachgesteÜt, so hatte sich dies endlich scheu aus
der Gegend zurückgezogen und der ältere oder jüngere
Sutter konnten jetzt bisweilen meilenweit und wochenlang
mit dem Schießeisen umherlaufen, ohne eine einzige Klaue
zu sehen. Dies vielfache Mißgeschick hatte in ihnen schon
längst den Wunsch erregt, die schlechte Gegend am Ken-
tuckyflusse zu verlassen und weiter nach Westen zu ziehen.
Sie wußten das freilich vorläufig nicht in's Werk zu
sehen. Ihr gegenwärtiges Besitzthum hatte keinen eigent-
lichen Werth und Geldmittel besaßen sie nicht. Es war
aber immerhin eine Anzahl Dollars erforderlich, um
eine kleine Farn: zu kaufen und einzurichten.
Seit geraumer Zeit nun befanden sie sich in ganz
wüthender Gemüthsstimmung, weil sie keinen Tropfen
Whiskey im Hause hatten und folglich das geliebte Lab-
sal, ihren einzigen Trost in der Wildniß, schmerzlich
entbehren mußten. Was kümmerte sie das prächtige
Herbstwetter, die leuchtende Sonnenkugel an: ätherblaueu
Himmelsfirmament, die reizvolle Stromscenerie, das in
bunten Farben prangende Laubwerk des Waldes? . . .
Mißmuthig, verdrossen, von innerer Erbitterung erfüllt,
saßen sie eines Morgens beisammen am Stromufer, sich
unterhaltend. über ihre schlechten Aussichten und hadernd
mit Gott und der Welt.
„Das ganze Elend kommt daher, daß sie die neue
Stadt 20 Meilen weiter unten gegründet und dorthin
die neue Straße verlegt haben," brummte der Alte.
„Weiß der Böse, früher ließ sich doch an dieser Stelle
häufig ein guter Tropfen Whiskey verdienen, doch jetzt
ist es ganz aus damit. Seit vierzehn Tagen hat sich
kein Mensch übersetzen lassen und kein rother Cent ist
im Hause."
„Und nut der Jagd ist es auch nichts mehr," be-
merkte der Sohn, „ganz davon abgesehen, daß unser
Pulver alle geworden. Und das ist vielleicht ganz güt!
Denn wahrhaftig, man könnte nachgerade auf den Ein-
fall kommen, sich selber eine Kugel durch den Hirnkasten
zu jagen, um dieses Hundeleben zu endigen, welches wir
zu führen genöthigt sind."
„Als wir vor reichlich einem Jahre den feinen Gentle-
man mehrmals über den Sjrom setzten," fuhr der Alte
ingrimmig fort, „da wußte ich freilich nicht, daß er der
Unternehmer der neuen Kolonie drunten sei, welche uns
zu Grunde gerichtet hat. Ha, wenn ich es hätte ahnen
können, so würde ich mit dem größten Vergnügen ihn:
den Schädel eingeschlagen und seinen Leichnam im Fluß-
schlamm versenkt haben!"
„Wir sind überhaupt recht dumm gewesen, daß wir
nicht dann und wann eine gute Gelegenheit beim Schopfe
nahmen, als solche sich uns bot," flüsterte Oliver, indem
er sich scheu nach allen Seiten umsah, gleichsam als be-
fürchte er, daß die Bäume, die Sträucher oder das
Schilf an: Ufer einen Lauscher bergen könnten. „Ja,
ich meine, wir hätten uns bisweilen einen hübschen
Pfennig verschaffen können, wenn wir dem einen oder
anderen Reisenden, der mit einer gut gefüllten Geldkatze an-
kam, ganz behutsam dieselbe abgenommen und ihn selber
für ewig stumm gemacht hätten. Ich habe viel von den
unerschrockenen Gesellen am Ohio und Mississippi gehört,
welche auf solche Weise eine Blasse Geldes zusammen-
brachten und alle Tage flott und lustig lebten. . ."
„So lange, bis sie gehangen wurden," unterbrach
ihn sein Vater. „Die Lynch war scharf hinter ihnen
her und legte ihnen geschwind das hänfene Halsband
um, sobald man sie erwischte. Ich habe die Gebeine
von mehreren dieser tapferen Gesellen an den Bäumen
hängen sehen, als ich mich an den Ufern des Mississippi
umhertrieb. Die Wahrheit zu sagen, so hielt mich der
schauerliche Anblick damals davon ab, bei der verwegenen
Bande des Obersten Hunt einzutreten, obgleich ich unter
derselben manche gute Bekannte hatte, die mir sagten,
daß ihr Geschäft das beste von der ganzen Welt sei."
„Sofern man die Sache klug und vorsichtig anfängt,
ist das auch ohne Zweifel der Fall. Wie viele Leute
verschwinden jahraus, jahrein spurlos in der Wildniß,
ohne daß ein Hahn darnach kräht? Wer könnte es
Wohl beweisen, daß wir Einen ausgeplündert und die
Leiche tief in den Strom versenkt? ... Ha, wenn nur
Jemand käme mit einigen hundert Dollars in der Tasche,
die uns helfen könnten ein für alle Mal! Ich bin nicht
dafür, ein förmliches Mord- und Raubgeschäft anzufangen,
so wie jene Bursche am Ohio und Mississippi es gc-
Sainte-Marie oder Moustiers schlechtweg, wie es gewöhnlich
genannt wird, bestanden früher bedeutende Töpfereien und
lieferten besonders schöne Maaren in farbigem und gemustertem
Steingut, in bemalter Fayence, — Maaren, welche von den
Liebhabern und Sammlern noch heutzutage begierig ausgesucht
und mit hohen Preisen bezahlt werden, denn diese unter dem
Namen „Moustiers-Maare" bekannten Majoliken beginnen
selten zu werden. Der heutige Flecken Moustiers mit seinen
12—1800 Einwohnern liegt in einem wildromantischen Eug-
thale am Fuße ungeheurer zerrissener Kalksteinwände, an einein
Nebenflüßchen des Verdon, lieber die tief eingerisseue Schlucht,
welche das Dorf in zwei Theile scheidet, führen uralte malerische
Brücken. Ein eigenthümliches Denkmal aus grauer Vorzeit
ist die auch auf uuserm Bilde sichtbare, 227 Meter lange
eiserne Kette, welche die beiden höchsten Felftuzacken des Thales
mit einander verbindet und in der Mitte einen vergoldeten
Stern von Weißblech mit fünf Spitzen tragt, den in Folge
eines Gelübdes ein Ritter von Blacas hier aufhängen ließ.
Nahe beim Dorfe steht, mitten in steile und an künstlichen
Grotten reiche Felsen kineiugebaut, eine uralte Liebfräuen-
lirche, deren Gründer Karl der Große gewesen sein soll und
die dann im 16. Jahrhundert bedeutend erweitert worden und
früher ein vielbesuchter Wallfahrtsort gewesen ist. Moustiers
(lateinisch Nouastsriuiv) verdankt seinen Namen und Ursprung
einem Kloster der Serviten, welche der heiligen Jungfrau eine
besondere Verehrung zollten. Der Orden, um 1232 in Florenz
gegründet, nahm 1239 die Regel des heiligen Augustinus an
und ward ungefähr um 1300 in Frankreich aufgehoben. Die
Serviten hatten als Ordenstracht weiße Mäntel, und von
dieser Tracht und ihren Klöstern rühren noch die ziemlich
häufig verkommenden Bezeichnungen von Oertlichkeiten, wie
Meißmautelgasse, Weißmantelkloster u. s. w. her, denen mau
auch in vielen deutschen Städten noch begegnet. Aus unserem
Bilde vermögen unsere Leser zu ersehen, daß der Besuch
von Moustiers sowohl in landschaftlicher wie archäologischer
Hinsicht sich verlohnt, und deshalb findet man hier Sommers
auch immer Künstler und andere fremde Gäste.
Sonlltligsall-gcht in einem Salonwagen der
Anion-Parific-Eisenbahn.
(Siehe das Bild aus S. 413.)
(Nachdruck verboten.)
Wir haben in diesen Blättern schon mehrfach der unge-
heuren Fortschritte gedacht, welche die Amerikaner in Bezug
auf Erhöhung der Behaglichkeit des Reisens durch ihre neueren
Einrichtungen, namentlich die äußerst elegant und bequem ein-
gerichteten Pullmaüfchen Salonwagen oder kulaes Ours, ge-
schaffen haben, die neuerdings auch in Europa und zwar
zuerst in Rußland sich eingebürgert. Man wird uns daher
eine betaillirte Beschreibung derselben um so mehr erlassen,
als dieselbe in verschiedenen früheren Jahrgängen schon in
Wort und Bild.geliefert worden ist. Bei den großen Reise-
strecken und der allgemeinen Reiselust der uustäten und beweg-
lichen Amerikaner war es sehr erklärlich, daß sie ihren Er-
fiuduugsgeist nnstreugten, um die Pracht und Behaglichkeit,
womit ihre Dampfboote eingerichtet sind, auch so viel wie
möglich auf ihre Eisenbahnwagen zu übertragen, und da diese
ihre Waggons gewöhnlich nicht unter 52 Fuß iaug und 8ftr Fuß
breit sind, so war es möglich, ihren Expreßzügen auf den
Hauptrouten immer einen oder zwei Wagen eiuzuverleiben,
welche die Stelle der Salons auf Dampfbooten versehen und
den Reisenden auf der langen Route von 3000 englischen
Meilen zwischen New-Port und San Francisco Gelegenheit
geben, um ihr Geld sich auch all den Luxus, die Behaglich-
keit und räumliche Bequemlichkeit zu beschaffen, welche man
zu Schiffe genießen kann und die allein eine Reise von sechs
Tagen und sechs Nächten erträglich machen. Der Amerikaner
ist gleich dem Briten gewöhnt, seine Sitten und Bräuche wie
seine Lebensgewohnheiten überall hin mit sich zu nehmen.
Wer schon mit Amerikanern über den Ocean gereist ist, der
ivird erfahren haben, wie streng der Amerikaner selbst auf
der Reise seinen Sonntag feiert und mehrmalige Andachten
und Gottesdienste nach dem Ritus der Methodisteukirche abhält,
zu welcher die überwiegende Mehrzahl der Protestanten in den
Vereinigten Staaten sich bekennt. Unser schönes und charak-
teristisches Bild S. 413 führt uns nun die Art und Weise vor,
in welcher selbst auf diesen Zügen quer durch den uordamerika-
uischen Kontinent der Sonntag von der gebildeten Klasse der
Reisenden gefeiert wird. Jeder der eigentlichen Salonwagen
Pullman's enthält ein Harmonium und eines oder mehrere
Piauiuos. Wer nun am Sonntag sich auf dem Expreß-
Zuge befindet, der zieht zur gewohnten Stunde fein Gebet-
buch hervor, irgend ein musikalisch gebildetes Individuum
unter den Passagieren seht sich an das Piano oder Har-
monium und spielt einen Choral oder Psalm, nm den from-
men Gesang der übrigen Mitreisenden zu begleiten, verliest
daun die für den betreffenden Sonntag als Perikope und
Epistel vorgeschriebeueu Bibelstelleu und versucht entweder
frei darüber zn predigen, worauf sich in jenem Laude und
bei der allgemein verbreiteten Rednergabe auch viele Laien
trefflich verstehen, oder gibt das Wort irgend einem zufällig
unter den Mitreisenden befindlichen Geistlichen, und alle An-
wesenden lauschen dieser Predigt mit der größten Andacht,
welche selbst auf minder religiöse Gemüther des tiefsten Ein-
drucks nicht verfehlt, weil ein aufrichtiger lebendiger Glaube
diesem scheuen Branche zu Grunde liegt.
Die Völkerschaften Arabiens.
(siche las Bild auf S. 417.)
-Nachdruck vcrbotcn.)
Wie sehr auch in den letzten siebeuzig Jahren die kühnen
Reisen von Europäern ivie Vurckhardt, Wellsted, Burton,
Maltzan n. A. in., welche als Moslems verkleidet bis nach
Mekka und Mediuah vorgedrungen sind und Arabien theil-
Das Buch für Alle.
Heft 18.
weise bereist haben, uns mit diesem merkwürdigen Lande
bekannt machten, so ist unsere Kenutuiß von den heutigen
Zuständen Arabiens doch noch immer eine verhältnißmäßig
beschränkte, was bei der großen Ausdehnung der arabi-
schen Halbinsel auch gar nicht verwundern kann. Man
nimmt zwar im Allgemeinen an, daß sich in der Welt des
Islam seit mehr als einem Jahrtausend nach Religion und
Sitte ungemein wenig verändert habe, indem der ganze geistige
Zustand der Bekenner dieser Religion jedem Fortschritt und
jeder Umbildung außerordentlich abhold ist, allein diese Ver-
muthuug wird durch die Geschichte der Wahabiten oder Wecha-
biteu einigermaßen widerlegt, da sie beweist, daß diese Reform-
bestrebungen in religiöser und politischer Beziehung gerade
von Arabien ausgingen. Zwar erscheint die heutige Be-
völkerung Arabiens, Mesopotamiens und der angrenzenden
Länder nach Religion und Sitte als eine in sich nnterschiedlose
Masse von derselben Abstammung, allein man weiß, daß die
verschiedenen Völkerschaften nicht einmal eine gemeinsame Sprache
reden, denn während im Nordwesten der arabischen Halbinsel
die reine arabische Schriftsprache des Koran als Volksmund-
nrt mit ihren Schriftzeichen noch im Gebrauche ist, herrscht
im Süden und Osten sowohl im Volksmunde wie iu den
Schristzeicheu eine wesentlich verschiedene, scheinbar noch ältere
Sprache, deren Schriftzeichen von den eigentlich arabischen ab-
weichen und mit denen der Schriftdenkmäler einer fernen Vor-
zeit übereinstimmeu — die sogenannte himjaritische Sprache,
welche dem Schriftarabischcn des Koran nur weitläufig ver-
wandt ist. Außer einer Menge örtlicher Dialekte aber findet
mau in Arabien sogar noch eine verschiedene Sprache der Vor-
nehmen oder Adeligen und eine Mundart des eigentlichen
Volks, welche beide sich seit uralten Zeiten getrennt und un-
vermischt erhalten haben und deutlich darauf Hinweisen, daß
nicht das ganze Volk einen gemeinsamen Ursprung hat, son-
dern aus Urbewohnern und ihren sieghaften eiugewanderten
Bezwingern gemischt ist. Und diese Sieger und Eroberer wa-
ren die tapferen kriegerischen Bekenner des Islam, die Heere
der ersten Khalifen, welche den unterjochten Völkerstämmen
ihre Sprache und ihre Religion aufgedrungen haben, und
ebenso ihre Gesetze, Sitten und Bräuche, denn diese finden ja
im Koran ihre Begründung.
Heutzutage ist der türkische Sultan, der Osmanen-Padischah
zu Konstantinopel, der uominelle Oberherr von Arabien, weil
er als der Besitzer des Schwertes und der Fahne des Pro-
pheten Mohamed und als Erbe der Khalifen der Schirmherr
des Islam ist; allein nur die sunnitische Bevölkerung Arabiens
und der Küstenstriche sowie der Hedschas erkennen diese Ober-
herrlichkeit an, dagegen sind im Innern noch sehr viele Stämme
unabhängig, zumal die der nomadischen Beduinen, welche dem
Großherrn nur ungern Tribut entrichten und Heeresfolge lei-
sten, und die Stämme im Südwesten, welche den Imam von
Sana'a oder Pemeu, und die Stämme der Ostküste, welche den
Imam von Oman oder Maskat als ihren Oberherrn aner-
kennen. Der alte orientalische Brauch, daß die einzelnen
Völkerschaften in patriarchalischer Weise sich aus Stämmen
unter selbstgewählteu oder erblichen Herrschern und diese Stämme
wieder aus Familien zusainmengethan und diesen socialen Zu-
stand seit Jahrtausenden ausrecht erhalten haben, macht sich noch
heute in den gesellschastlichen Einrichtungen Arabiens geltend.
Die moslemitischeu Eroberer hatten eine Art Lehenwefen ein-
gesührt, welches indessen nur von denjenigen Stämmen gerne
angenommen würde, welche damals seßhaft und im Besitz ge-
ordneter Gemeinwesen und einer höheren Bildung und Ge-
sittung waren, das aber von den halbwilden und nomadischen
Stämmen niemals gern angenommen oder ernstlich willkommen
geheißen ward, und welches gegenwärtig auch thatsächlich ge-
brochen ist. Deshalb erscheint heutzutage der Verband, welcher
die Stämme Arabiens zusammeuhält, mehr eine Art föderaler
Republik, denn die einzelnen Stämme haben ihre ange-
stammten Schechs und Emirs oder solche, die sie sich selbst er-
wählt haben. Diese Häuptlinge stehen unter einander in einem
Schutz- und Trutzbündniß, damit sie weder von dem Padischah
»och von dem Vicekönig von Egypten vergewaltigt werden können.
Unser Bild S. 417 stellt einen dieser arabischen Emirs dar.
Der Fährmann vom Kentuckyfluß.
Novellette
von
I. O. Hausen.
(Nachdruck »erboten.)
Am oberen Kentucky-River befand sich vor einigen
fünfzig Jahren, als die dortige Gegend noch wenig be-
siedelt war, ein einsames Fährhaus, dessen Besitzer,
Nathanael Sutter und dessen Sohn -Oliver, sich
ein Geschäft daraus machten, mit einem großen ungefügen
selbstgczimmerten Boote Reisende von einem Ufer zum
anderen zu bringen. Daraus erwuchs ihnen freilich nur
ein kümmerliches Einkommen; denn wenn der Passage-
Preis auch einen halben Dollar für die Person betrug,
so fiel ihnen ein solcher doch nur selten zu, da die Fre-
quenz der Verkehrsstraße nur sehr unbedeutend war und
immer mehr abnahm, weil man seit einiger Zeill weiter
unten am Strome neue Straßen angelegt hatte. Sutter,
dessen Frau seit lange gestorben war, gehörte zu jenen
Leuten, welche früher ein besseres Leben gekannt und sich
in die Wildniß geflüchtet, um dunkle Flecke in ihrem
vergangenen Leben, wenn nicht ans der eigenen, so doch
aus der Erinnerung der übrigen Menschheit verschwinden
zu lassen. Er war nun total verwildert, ein Mann
von reichlich 50 Jahren nnt braunem knochigem Gesicht,
schwieligen Händen und scharfen grauen Augen, die jeder
Gefahr furchtlos entgegenschauten, aber auch nicht zuck-
ten, wenn es die Ausführung eines Verbrechens galt.
Sein Sohn Oliver zeigte sich durchaus als der würdige
Abkömmling eines solchen Vaters; er war ein zwanzig-
jähriger, stattlicher, aber dabei auch roher und wüster
Bursche, der mit seinem Erzeuger die bedenkliche Eigen-
heit gemein hatte, daß er sehr gerne Branntwein trank
und sich ebenso wie Jener stets in einem sehr gereizten,
menschenfeindlichen und wüthenden Zustande zu befinden
pflegte, sobald das Whiskehfüßchen leer war und kein
Geld im Hause, um frischen Vorrath herbeizuschaffen.
Das Blockhaus, in welchen: sie wohnten oder viel-
mehr nur schliefen und ihre Mahlzeiten bereiteten, war
eine verfallene, elende Barracke und das Land rings um-
her öde und so unfruchtbar, daß sich daraus nur eine
geringe und sehr schlechte Ernte ziehen ließ. Die Jagd
war vordem einigermaßen ergiebig gewesen und hatte den
Beiden manchen saftigen Braten und manches werthvolle
Fell in's Haus geliefert; weil sie aber gar zu eifrig dem
Wilde nachgesteÜt, so hatte sich dies endlich scheu aus
der Gegend zurückgezogen und der ältere oder jüngere
Sutter konnten jetzt bisweilen meilenweit und wochenlang
mit dem Schießeisen umherlaufen, ohne eine einzige Klaue
zu sehen. Dies vielfache Mißgeschick hatte in ihnen schon
längst den Wunsch erregt, die schlechte Gegend am Ken-
tuckyflusse zu verlassen und weiter nach Westen zu ziehen.
Sie wußten das freilich vorläufig nicht in's Werk zu
sehen. Ihr gegenwärtiges Besitzthum hatte keinen eigent-
lichen Werth und Geldmittel besaßen sie nicht. Es war
aber immerhin eine Anzahl Dollars erforderlich, um
eine kleine Farn: zu kaufen und einzurichten.
Seit geraumer Zeit nun befanden sie sich in ganz
wüthender Gemüthsstimmung, weil sie keinen Tropfen
Whiskey im Hause hatten und folglich das geliebte Lab-
sal, ihren einzigen Trost in der Wildniß, schmerzlich
entbehren mußten. Was kümmerte sie das prächtige
Herbstwetter, die leuchtende Sonnenkugel an: ätherblaueu
Himmelsfirmament, die reizvolle Stromscenerie, das in
bunten Farben prangende Laubwerk des Waldes? . . .
Mißmuthig, verdrossen, von innerer Erbitterung erfüllt,
saßen sie eines Morgens beisammen am Stromufer, sich
unterhaltend. über ihre schlechten Aussichten und hadernd
mit Gott und der Welt.
„Das ganze Elend kommt daher, daß sie die neue
Stadt 20 Meilen weiter unten gegründet und dorthin
die neue Straße verlegt haben," brummte der Alte.
„Weiß der Böse, früher ließ sich doch an dieser Stelle
häufig ein guter Tropfen Whiskey verdienen, doch jetzt
ist es ganz aus damit. Seit vierzehn Tagen hat sich
kein Mensch übersetzen lassen und kein rother Cent ist
im Hause."
„Und nut der Jagd ist es auch nichts mehr," be-
merkte der Sohn, „ganz davon abgesehen, daß unser
Pulver alle geworden. Und das ist vielleicht ganz güt!
Denn wahrhaftig, man könnte nachgerade auf den Ein-
fall kommen, sich selber eine Kugel durch den Hirnkasten
zu jagen, um dieses Hundeleben zu endigen, welches wir
zu führen genöthigt sind."
„Als wir vor reichlich einem Jahre den feinen Gentle-
man mehrmals über den Sjrom setzten," fuhr der Alte
ingrimmig fort, „da wußte ich freilich nicht, daß er der
Unternehmer der neuen Kolonie drunten sei, welche uns
zu Grunde gerichtet hat. Ha, wenn ich es hätte ahnen
können, so würde ich mit dem größten Vergnügen ihn:
den Schädel eingeschlagen und seinen Leichnam im Fluß-
schlamm versenkt haben!"
„Wir sind überhaupt recht dumm gewesen, daß wir
nicht dann und wann eine gute Gelegenheit beim Schopfe
nahmen, als solche sich uns bot," flüsterte Oliver, indem
er sich scheu nach allen Seiten umsah, gleichsam als be-
fürchte er, daß die Bäume, die Sträucher oder das
Schilf an: Ufer einen Lauscher bergen könnten. „Ja,
ich meine, wir hätten uns bisweilen einen hübschen
Pfennig verschaffen können, wenn wir dem einen oder
anderen Reisenden, der mit einer gut gefüllten Geldkatze an-
kam, ganz behutsam dieselbe abgenommen und ihn selber
für ewig stumm gemacht hätten. Ich habe viel von den
unerschrockenen Gesellen am Ohio und Mississippi gehört,
welche auf solche Weise eine Blasse Geldes zusammen-
brachten und alle Tage flott und lustig lebten. . ."
„So lange, bis sie gehangen wurden," unterbrach
ihn sein Vater. „Die Lynch war scharf hinter ihnen
her und legte ihnen geschwind das hänfene Halsband
um, sobald man sie erwischte. Ich habe die Gebeine
von mehreren dieser tapferen Gesellen an den Bäumen
hängen sehen, als ich mich an den Ufern des Mississippi
umhertrieb. Die Wahrheit zu sagen, so hielt mich der
schauerliche Anblick damals davon ab, bei der verwegenen
Bande des Obersten Hunt einzutreten, obgleich ich unter
derselben manche gute Bekannte hatte, die mir sagten,
daß ihr Geschäft das beste von der ganzen Welt sei."
„Sofern man die Sache klug und vorsichtig anfängt,
ist das auch ohne Zweifel der Fall. Wie viele Leute
verschwinden jahraus, jahrein spurlos in der Wildniß,
ohne daß ein Hahn darnach kräht? Wer könnte es
Wohl beweisen, daß wir Einen ausgeplündert und die
Leiche tief in den Strom versenkt? ... Ha, wenn nur
Jemand käme mit einigen hundert Dollars in der Tasche,
die uns helfen könnten ein für alle Mal! Ich bin nicht
dafür, ein förmliches Mord- und Raubgeschäft anzufangen,
so wie jene Bursche am Ohio und Mississippi es gc-