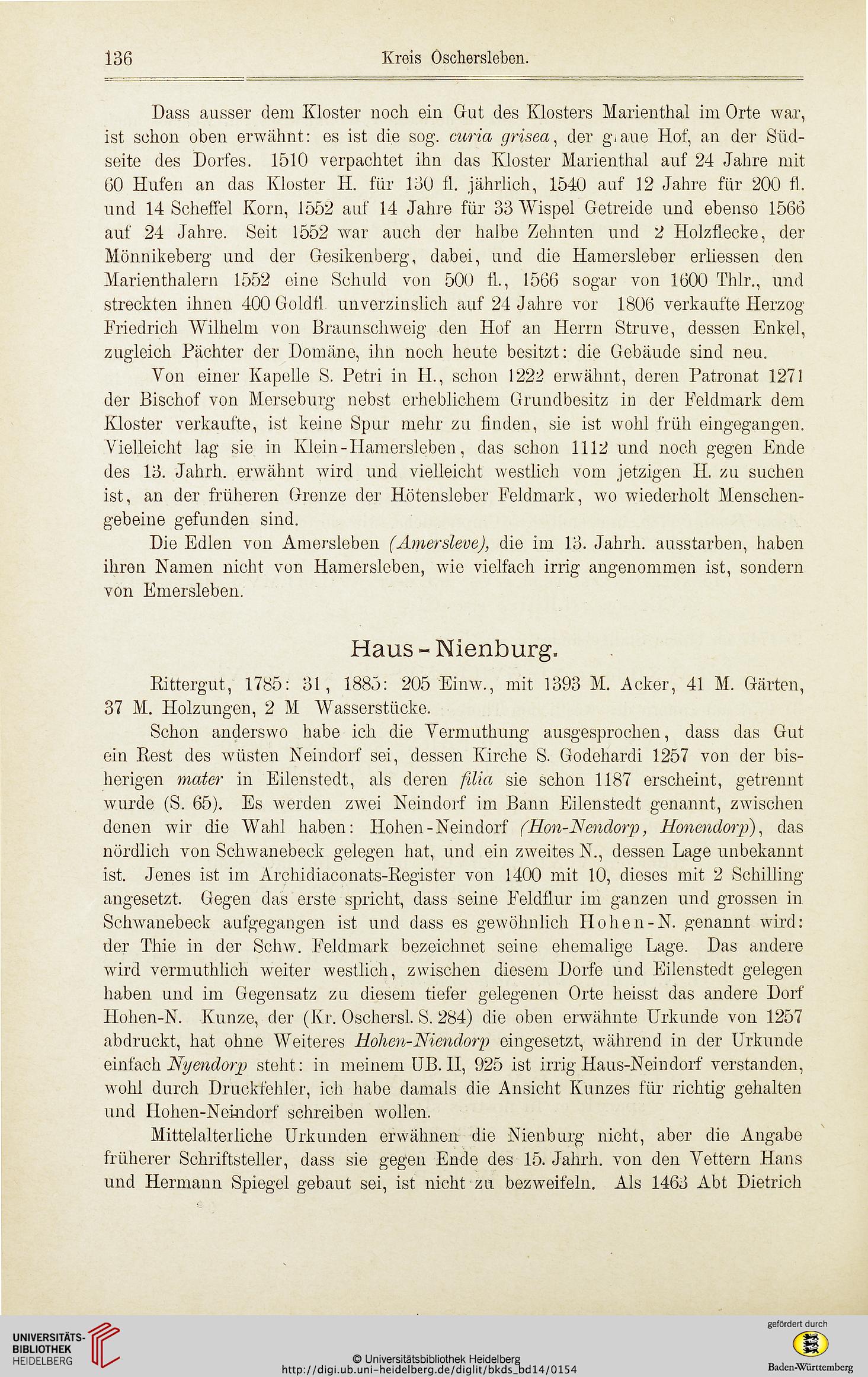136
Kreis Oschersleben.
Dass ausser dem Kloster noch ein Gut des Klosters Marienthal im Orte war,
ist schon oben erwähnt: es ist die sog. curia grisea, der giaue Hof, an der Süd-
seite des Dorfes. 1510 verpachtet ihn das Kloster Marienthal auf 24 Jahre mit
60 Hufen an das Kloster H. für 130 fl. jährlich, 1540 auf 12 Jahre für 200 fl.
und 14 Scheffel Korn, 1552 auf 14 Jahre für 33 Wispel Getreide und ebenso 1566
auf 24 Jahre. Seit 1552 war auch der halbe Zehnten und 2 Holzflecke, der
Mönnikeberg und der Gesikenberg, dabei, und die Hamersleber erliessen den
Marienthalern 1552 eine Schuld von 500 fl., 1566 sogar von 1600 Thlr., und
streckten ihnen 400 Goldfl unverzinslich auf 24 Jahre vor 1806 verkaufte Herzog
Friedrich Wilhelm von Braunschweig den Hof an Herrn Struve, dessen Enkel,
zugleich Pächter der Domäne, ihn noch heute besitzt: die Gebäude sind neu.
Von einer Kapelle S. Petri in H., schon 1222 erwähnt, deren Patronat 1271
der Bischof von Merseburg nebst erheblichem Grundbesitz in der Feldmark dem
Kloster verkaufte, ist keine Spur mehr zu finden, sie ist wohl früh eingegangen.
Vielleicht lag sie in Klein - Hamersleben, das schon 1112 und noch gegen Ende
des 13. Jahrh. erwähnt wird und vielleicht westlich vom jetzigen H. zu suchen
ist, an der früheren Grenze der Hötensleber Feldmark, wo wiederholt Menschen-
gebeine gefunden sind.
Die Edlen von Amersleben (Amersleve), die im 13. Jahrh. ausstarben, haben
ihren Namen nicht von Hamersleben, wie vielfach irrig angenommen ist, sondern
von Emersleben.
Haus - Nienburg.
Kittergut, 1785: 31, 1885: 205 Einw., mit 1393 M. Acker, 41 M. Gärten,
37 M. Holzungen, 2 M Wasserstücke.
Schon anderswo habe ich die Vermuthung ausgesprochen, dass das Gut
ein Rest des wüsten Neindorf sei, dessen Kirche S. Godehardi 1257 von der bis-
herigen mater in Eilenstedt, als deren film sie schon 1187 erscheint, getrennt
wurde (S. 65). Es werden zwei Neindorf im Bann Eilenstedt genannt, zwischen
denen wir die Wahl haben: Hohen-Neindorf (Hon-Nendorp, Honendorp), das
nördlich von Schwanebeck gelegen hat, und ein zweites N., dessen Lage unbekannt
ist. Jenes ist im Archidiaconats-Register von 1400 mit 10, dieses mit 2 Schilling
angesetzt. Gegen das erste spricht, dass seine Feldflur im ganzen und grossen in
Schwanebeck aufgegangen ist und dass es gewöhnlich Hohen-N. genannt wird:
der Thie in der Schw. Feldmark bezeichnet seine ehemalige Lage. Das andere
wird vermuthlicli weiter westlich, zwischen diesem Dorfe und Eilenstedt gelegen
haben und im Gegensatz zu diesem tiefer gelegenen Orte heisst das andere Dorf
Hohen-N. Kunze, der (Kr. Oschersl. S. 284) die oben erwähnte Urkunde von 1257
abdruckt, hat ohne Weiteres Hohen-Niendorp eingesetzt, während in der Urkunde
einfach Nyendorp steht: in meinem UB. II, 925 ist irrig Haus-Neindorf verstanden,
wohl durch Druckfehler, ich habe damals die Ansicht Kunzes für richtig gehalten
und Hohen-Neindorf schreiben wollen.
Mittelalterliche Urkunden erwähnen die Nienburg nicht, aber die Angabe
früherer Schriftsteller, dass sie gegen Ende des 15. Jahrh. von den Vettern Hans
und Hermann Spiegel gebaut sei, ist nicht zu bezweifeln. Als 1463 Abt Dietrich
Kreis Oschersleben.
Dass ausser dem Kloster noch ein Gut des Klosters Marienthal im Orte war,
ist schon oben erwähnt: es ist die sog. curia grisea, der giaue Hof, an der Süd-
seite des Dorfes. 1510 verpachtet ihn das Kloster Marienthal auf 24 Jahre mit
60 Hufen an das Kloster H. für 130 fl. jährlich, 1540 auf 12 Jahre für 200 fl.
und 14 Scheffel Korn, 1552 auf 14 Jahre für 33 Wispel Getreide und ebenso 1566
auf 24 Jahre. Seit 1552 war auch der halbe Zehnten und 2 Holzflecke, der
Mönnikeberg und der Gesikenberg, dabei, und die Hamersleber erliessen den
Marienthalern 1552 eine Schuld von 500 fl., 1566 sogar von 1600 Thlr., und
streckten ihnen 400 Goldfl unverzinslich auf 24 Jahre vor 1806 verkaufte Herzog
Friedrich Wilhelm von Braunschweig den Hof an Herrn Struve, dessen Enkel,
zugleich Pächter der Domäne, ihn noch heute besitzt: die Gebäude sind neu.
Von einer Kapelle S. Petri in H., schon 1222 erwähnt, deren Patronat 1271
der Bischof von Merseburg nebst erheblichem Grundbesitz in der Feldmark dem
Kloster verkaufte, ist keine Spur mehr zu finden, sie ist wohl früh eingegangen.
Vielleicht lag sie in Klein - Hamersleben, das schon 1112 und noch gegen Ende
des 13. Jahrh. erwähnt wird und vielleicht westlich vom jetzigen H. zu suchen
ist, an der früheren Grenze der Hötensleber Feldmark, wo wiederholt Menschen-
gebeine gefunden sind.
Die Edlen von Amersleben (Amersleve), die im 13. Jahrh. ausstarben, haben
ihren Namen nicht von Hamersleben, wie vielfach irrig angenommen ist, sondern
von Emersleben.
Haus - Nienburg.
Kittergut, 1785: 31, 1885: 205 Einw., mit 1393 M. Acker, 41 M. Gärten,
37 M. Holzungen, 2 M Wasserstücke.
Schon anderswo habe ich die Vermuthung ausgesprochen, dass das Gut
ein Rest des wüsten Neindorf sei, dessen Kirche S. Godehardi 1257 von der bis-
herigen mater in Eilenstedt, als deren film sie schon 1187 erscheint, getrennt
wurde (S. 65). Es werden zwei Neindorf im Bann Eilenstedt genannt, zwischen
denen wir die Wahl haben: Hohen-Neindorf (Hon-Nendorp, Honendorp), das
nördlich von Schwanebeck gelegen hat, und ein zweites N., dessen Lage unbekannt
ist. Jenes ist im Archidiaconats-Register von 1400 mit 10, dieses mit 2 Schilling
angesetzt. Gegen das erste spricht, dass seine Feldflur im ganzen und grossen in
Schwanebeck aufgegangen ist und dass es gewöhnlich Hohen-N. genannt wird:
der Thie in der Schw. Feldmark bezeichnet seine ehemalige Lage. Das andere
wird vermuthlicli weiter westlich, zwischen diesem Dorfe und Eilenstedt gelegen
haben und im Gegensatz zu diesem tiefer gelegenen Orte heisst das andere Dorf
Hohen-N. Kunze, der (Kr. Oschersl. S. 284) die oben erwähnte Urkunde von 1257
abdruckt, hat ohne Weiteres Hohen-Niendorp eingesetzt, während in der Urkunde
einfach Nyendorp steht: in meinem UB. II, 925 ist irrig Haus-Neindorf verstanden,
wohl durch Druckfehler, ich habe damals die Ansicht Kunzes für richtig gehalten
und Hohen-Neindorf schreiben wollen.
Mittelalterliche Urkunden erwähnen die Nienburg nicht, aber die Angabe
früherer Schriftsteller, dass sie gegen Ende des 15. Jahrh. von den Vettern Hans
und Hermann Spiegel gebaut sei, ist nicht zu bezweifeln. Als 1463 Abt Dietrich