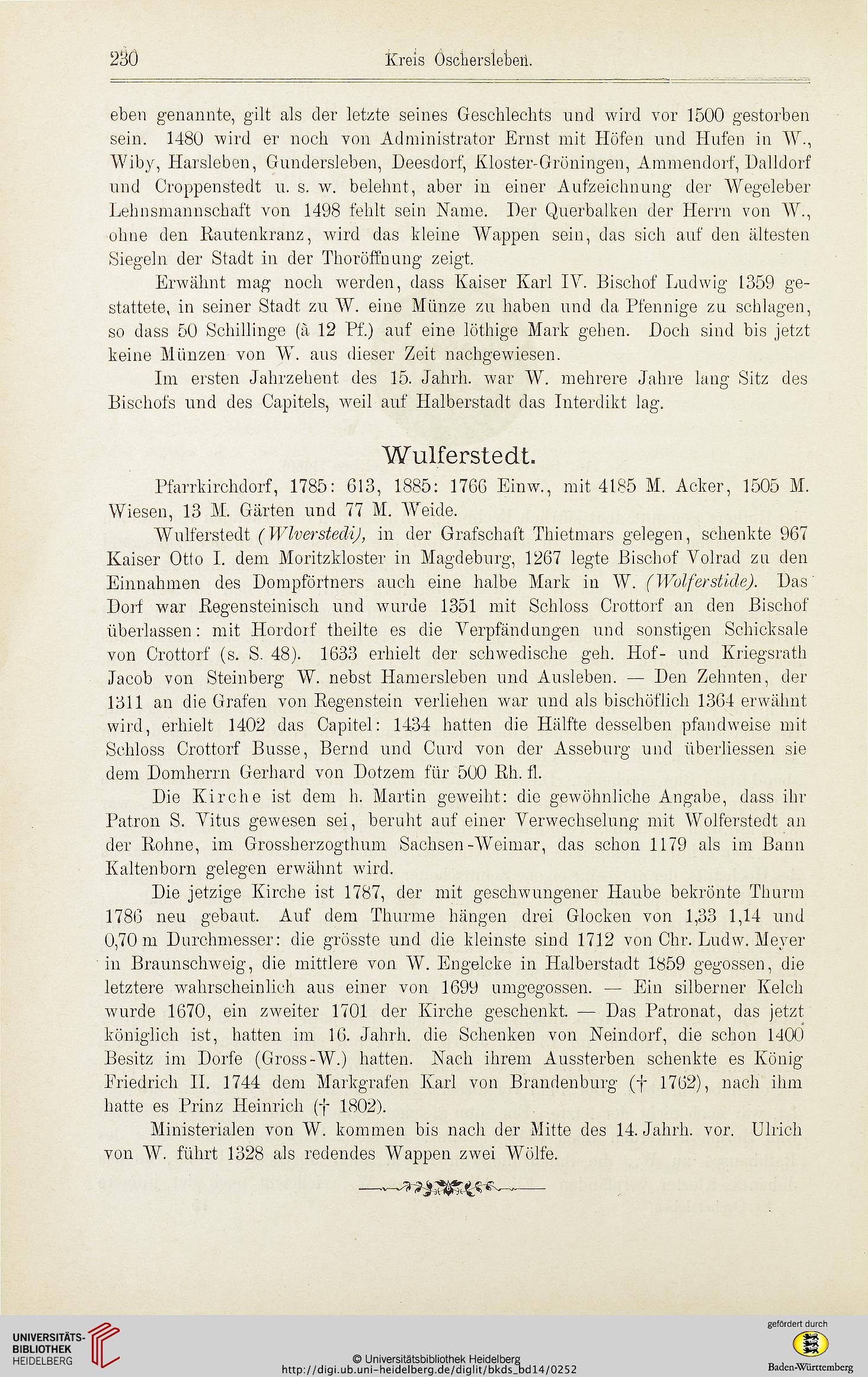230
Kreis Oschersiebeii.
eben genannte, gilt als der letzte seines Geschlechts und wird vor 1500 gestorben
sein. 1480 wird er noch von Administrator Ernst mit Höfen und Hufen in W.,
Wiby, Harsleben, Gundersleben, Deesdorf, Kloster-Groningen, Ammendorf, Dalldorf
und Croppenstedt u. s. w. belehnt, aber in einer Aufzeichnung der Wegeleber
Lehnsmannschaft von 1498 fehlt sein Name. Der Querbalken der Herrn von W.,
ohne den Bautenkranz, wird das kleine Wappen sein, das sich auf den ältesten
Siegeln der Stadt in der Thoröffnung zeigt.
Erwähnt mag noch werden, dass Kaiser Karl IV. Bischof Ludwig 1359 ge-
stattete, in seiner Stadt zu W. eine Münze zu haben und da Pfennige zu schlagen,
so dass 50 Schillinge (ä 12 Pf.) auf eine löthige Mark gehen. Doch sind bis jetzt
keine Münzen von W. aus dieser Zeit nachgewiesen.
Im ersten Jahrzehent des 15. Jahrh. war W. mehrere Jahre lang Sitz des
Bischofs und des Capitels, weil auf Halberstadt das Interdikt lag.
Wulferstedt.
Pfarrkirchdorf, 1785: 613, 1885: 1766 Einw., mit 4185 M. Acker, 1505 M.
Wiesen, 13 M. Gärten und 77 M. Weide.
Wulferstedt (WlverstediJ, in der Grafschaft Thietmars gelegen, schenkte 967
Kaiser Otto I. dem Moritzkloster in Magdeburg, 1267 legte Bischof Volrad zu den
Einnahmen des Dompförtners auch eine halbe Mark in W. (Wolfer stiele). Das
Dorf war Begensteinisch und wurde 1351 mit Schloss Crottorf an den Bischof
überlassen: mit Hordorf theilte es die Verpfändungen und sonstigen Schicksale
von Crottorf (s. S. 48). 1633 erhielt der schwedische geh. Hof- und Kriegsrath
Jacob von Steinberg W. nebst Hamersleben und Ausleben. — Den Zehnten, der
1311 an die Grafen von Begenstein verliehen war und als bischöflich 1364 erwähnt
wird, erhielt 1402 das Capitel: 1434 hatten die Hälfte desselben pfandweise mit
Schloss Crottorf Busse, Bernd und Curd von der Asseburg und iiberliessen sie
dem Domherrn Gerhard von Dotzem für 500 Bh. fl.
Die Kirche ist dem h. Martin geweiht: die gewöhnliche Angabe, dass ihr
Patron S. Vitus gewesen sei, beruht auf einer Verwechselung mit Wolferstedt an
der Bohne, im Grossherzogthum Sachsen-Weimar, das schon 1179 als im Bann
Kaltenborn gelegen erwähnt wird.
Die jetzige Kirche ist 1787, der mit geschwungener Haube bekrönte Thurm
1786 neu gebaut. Auf dem Thurme hängen drei Glocken von 1,63 1,14 und
0,70 m Durchmesser: die grösste und die kleinste sind 1712 von Chr. Ludw. Meyer
in Braunschweig, die mittlere von W. Engelcke in Halberstadt 1859 gegossen, die
letztere wahrscheinlich aus einer von 1699 umgegossen. — Ein silberner Kelch
wurde 1670, ein zweiter 1701 der Kirche geschenkt. — Das Patronat, das jetzt
königlich ist, hatten im 16. Jahrh. die Schenken von Neindorf, die schon 1400
Besitz im Dorfe (Gross-W.) hatten. Nach ihrem Aussterben schenkte es König
Friedrich II. 1744 dem Markgrafen Karl von Brandenburg (f 1762), nach ihm
hatte es Prinz Heinrich (j- 1802).
Ministerialen von W. kommen bis nach der Mitte des 14. Jahrh. vor. Ulrich
von W. führt 1328 als redendes Wappen zwei Wölfe.
—■—^ jj —
Kreis Oschersiebeii.
eben genannte, gilt als der letzte seines Geschlechts und wird vor 1500 gestorben
sein. 1480 wird er noch von Administrator Ernst mit Höfen und Hufen in W.,
Wiby, Harsleben, Gundersleben, Deesdorf, Kloster-Groningen, Ammendorf, Dalldorf
und Croppenstedt u. s. w. belehnt, aber in einer Aufzeichnung der Wegeleber
Lehnsmannschaft von 1498 fehlt sein Name. Der Querbalken der Herrn von W.,
ohne den Bautenkranz, wird das kleine Wappen sein, das sich auf den ältesten
Siegeln der Stadt in der Thoröffnung zeigt.
Erwähnt mag noch werden, dass Kaiser Karl IV. Bischof Ludwig 1359 ge-
stattete, in seiner Stadt zu W. eine Münze zu haben und da Pfennige zu schlagen,
so dass 50 Schillinge (ä 12 Pf.) auf eine löthige Mark gehen. Doch sind bis jetzt
keine Münzen von W. aus dieser Zeit nachgewiesen.
Im ersten Jahrzehent des 15. Jahrh. war W. mehrere Jahre lang Sitz des
Bischofs und des Capitels, weil auf Halberstadt das Interdikt lag.
Wulferstedt.
Pfarrkirchdorf, 1785: 613, 1885: 1766 Einw., mit 4185 M. Acker, 1505 M.
Wiesen, 13 M. Gärten und 77 M. Weide.
Wulferstedt (WlverstediJ, in der Grafschaft Thietmars gelegen, schenkte 967
Kaiser Otto I. dem Moritzkloster in Magdeburg, 1267 legte Bischof Volrad zu den
Einnahmen des Dompförtners auch eine halbe Mark in W. (Wolfer stiele). Das
Dorf war Begensteinisch und wurde 1351 mit Schloss Crottorf an den Bischof
überlassen: mit Hordorf theilte es die Verpfändungen und sonstigen Schicksale
von Crottorf (s. S. 48). 1633 erhielt der schwedische geh. Hof- und Kriegsrath
Jacob von Steinberg W. nebst Hamersleben und Ausleben. — Den Zehnten, der
1311 an die Grafen von Begenstein verliehen war und als bischöflich 1364 erwähnt
wird, erhielt 1402 das Capitel: 1434 hatten die Hälfte desselben pfandweise mit
Schloss Crottorf Busse, Bernd und Curd von der Asseburg und iiberliessen sie
dem Domherrn Gerhard von Dotzem für 500 Bh. fl.
Die Kirche ist dem h. Martin geweiht: die gewöhnliche Angabe, dass ihr
Patron S. Vitus gewesen sei, beruht auf einer Verwechselung mit Wolferstedt an
der Bohne, im Grossherzogthum Sachsen-Weimar, das schon 1179 als im Bann
Kaltenborn gelegen erwähnt wird.
Die jetzige Kirche ist 1787, der mit geschwungener Haube bekrönte Thurm
1786 neu gebaut. Auf dem Thurme hängen drei Glocken von 1,63 1,14 und
0,70 m Durchmesser: die grösste und die kleinste sind 1712 von Chr. Ludw. Meyer
in Braunschweig, die mittlere von W. Engelcke in Halberstadt 1859 gegossen, die
letztere wahrscheinlich aus einer von 1699 umgegossen. — Ein silberner Kelch
wurde 1670, ein zweiter 1701 der Kirche geschenkt. — Das Patronat, das jetzt
königlich ist, hatten im 16. Jahrh. die Schenken von Neindorf, die schon 1400
Besitz im Dorfe (Gross-W.) hatten. Nach ihrem Aussterben schenkte es König
Friedrich II. 1744 dem Markgrafen Karl von Brandenburg (f 1762), nach ihm
hatte es Prinz Heinrich (j- 1802).
Ministerialen von W. kommen bis nach der Mitte des 14. Jahrh. vor. Ulrich
von W. führt 1328 als redendes Wappen zwei Wölfe.
—■—^ jj —