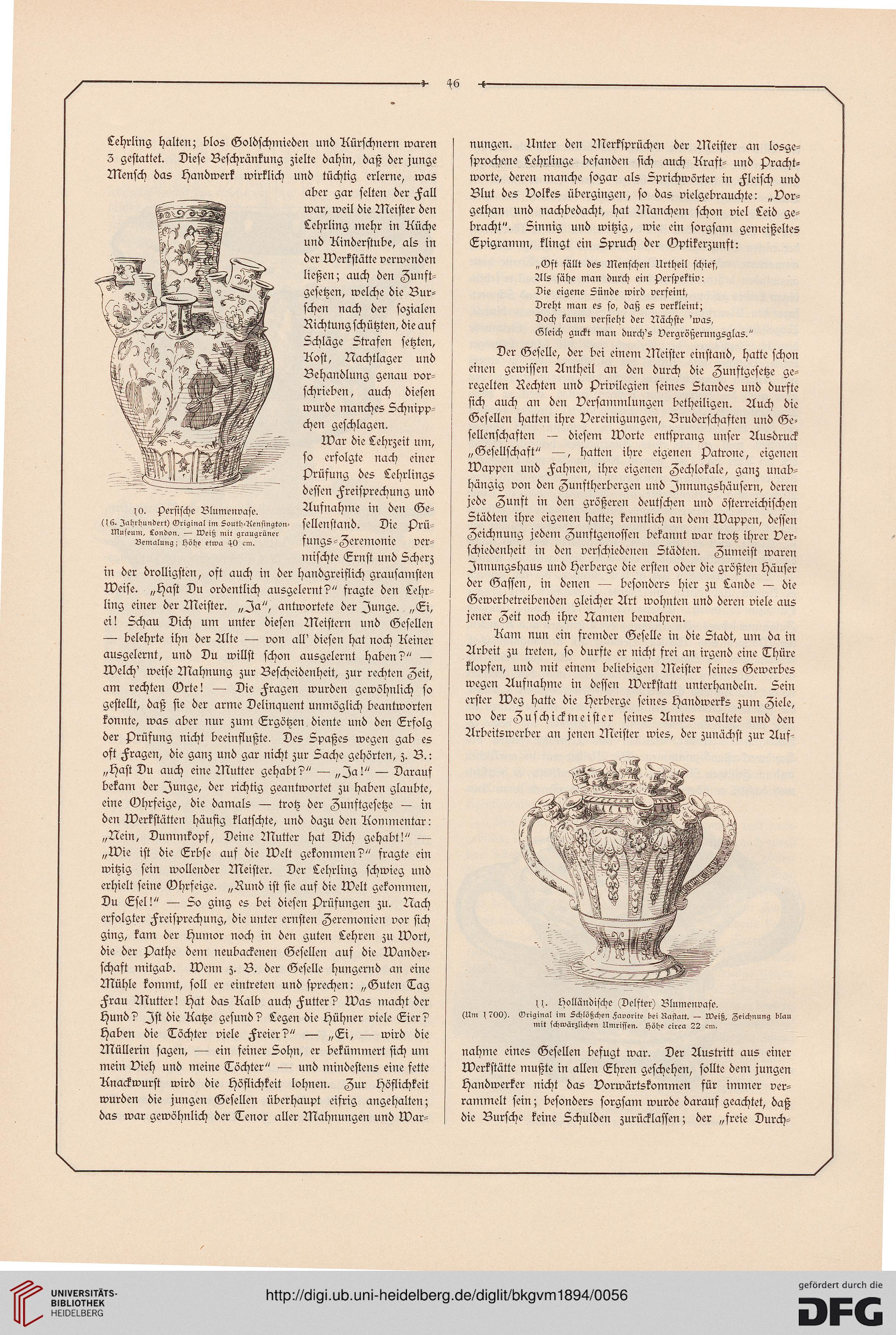Lehrling halten; blos Goldschmieden und Kürschnern waren
3 gestattet. Diese Beschränkung zielte dahin, daß der junge
Mensch das Handwerk wirklich und tüchtig erlerne, was
aber gar selten der Fall
war, weil die ITTeifter den
Lehrling mehr in Rüche
und Rinderstube, als in
der Werkstätte verwenden
ließen; auch den Zunft-
gesetzen, welche die Bur-
schen nach der sozialen
Richtung schützten, die auf
Schläge Strafen setzten,
Rost, Nachtlager und
Behandlung genau vor-
schrieben, auch diesen
wurde manches Schnipp-
chen geschlagen.
War die Lehrzeit um,
so erfolgte nach einer
Prüfung des Lehrlings
dessen Freisprechung und
Ausnahme in den Ge-
(lü. Jahrhundert) Driginal in, Soutli-Aensington- selleil>tand. Die PrÜ
Museum, London. — weiß mit graugrüner , —
Bemalung; Höhe etwa 40 cm. | Un^S^QjCtCTlIOntC VCV^
mischte Ernst und Scherz
in der drolligsten, oft auch in der handgreiflich grausamsten
Weise, „Hast Du ordentlich ausgelernt?" fragte den Lehr-
ling einer der Meister. „Za", antwortete der Zunge. „Li,
ei! Schau Dich um unter diesen Meistern und Gesellen
— belehrte ihn der Alte — von all' diesen hat noch Reiner
ausgelernt, und Du willst schon ausgelernt haben?" —
Welch' weise Mahnung zur Bescheidenheit, zur rechten Zeit,
am rechten Orte! — Die Fragen wurden gewöhnlich so
gestellt, daß sie der arme Delinquent unmöglich beantworten
konnte, was aber nur zuin Ergötzen. diente und den Erfolg
der Prüfung nicht beeinflußte. Des Spaßes wegen gab es
oft Fragen, die ganz und gar nicht zur Sache gehörten, z. B.:
„Hast Du auch eine Mutter gehabt?" -— „Za!" — Darauf
bekam der Zunge, der richtig geantwortet zu haben glaubte,
eine Ohrfeige, die damals — trotz der Zunftgesetze — in
den Werkstätten häuflg klatschte, und dazu den Rommentar:
„Nein, Dummkopf, Deine Mutter hat Dich gehabt!" —
„Wie ist die Erbse auf die Welt gekommen?" fragte ein
witzig sein wollender Meister. Der Lehrling schwieg und
erhielt seine Ohrfeige. „Rund ist sie auf die Welt gekoinmen,
Du Esel!" — So ging es bei diesen Prüfungen zu. Nach
erfolgter Freisprechung, die unter ernsten Zeremonien vor sich
ging, kam der Humor noch in den guten Lehren zu Wort,
die der pathe den: neubackenen Gesellen auf die Wander-
schaft mitgab. Wenn z. B. der Geselle hungernd an eine
Mühle kommt, soll er eintreten und sprechen: „Guten Tag
Frau Mutter! Hat das Ralb auch Futter? Was macht der
Hund? Zft die Ratze gesund? Legen die Hühner viele Eier?
Haben die Töchter viele Freier?" — „Ei, — wird die
Müllerin sagen, — ein feiner Sohn, er bekümmert sich uni
mein Bieh und meine Töchter" — und mindestens eine fette
Rnackwurft wird die Höflichkeit lohnen. Zur Höflichkeit
wurden die jungen Gesellen überhaupt eifrig angehalten;
das war gewöhnlich der Tenor aller Mahnungen und War-
nungen. Unter den Merksprüchen der Meister an losge-
sprochene Lehrlinge befanden sich auch Rraft- und Pracht-
worte, deren manche sogar als Sprichwörter in Fleisch und
Blut des Volkes übergingen, so das vielgebrauchte: „Vor-
gethan und nachbedacht, hat Manchem schon viel Leid ge-
bracht". Sinnig und witzig, wie ein sorgsain gemeißeltes
Epigramm, klingt ein Spruch der Gptikerzunft:
„Gft fällt des Menschen Urtheil schief,
Als sähe man durch ein Perspektiv:
Die eigene Sünde wird verfemt,
Dreht man es so, daß es verkleint;
Doch kaum versieht der Nächste 'was,
Gleich guckt man durch's Vergrößerungsglas."
Der Geselle, der bei einem Meister einstand, hatte scholl
einen gewissen Antheil an den durch die Zunftgesetze ge-
regelten Rechten und Privilegien seines Standes und durfte
sich auch an den Versainmlungen betheiligen. Auch die
Gesellen hatten ihre Vereinigungen, Bruderschaften und Ge-
sellenschaften — diesem Worte eiltsprang unser Ausdruck
„Gesellschaft" —, hatten ihre eigenen Patrone, eigenen
Wappen und Fahnen, ihre eigenen Zechlokale, ganz unab-
hängig von den Zunftherbergen und Znnungshäusern, deren
jede Zunft in den größeren deutschen und österreichischen
Städten ihre eigeilen hatte; kenntlich ail dem Wappen, dessen
Zeichnuilg jedem Zuilftgenosseil bekannt war trotz ihrer Ver-
schiedenheit in den verschiedenen Städten. Zumeist waren
Znnungshaus und Herberge die ersten oder die größten Häuser
der Gassen, in denen — besonders hier zu Lande — die
Gewerbetreibeliden gleicher Art wohnteil und deren viele aus
jener Zeit noch ihre Namen bewahren.
Ram nun ein frenlder Geselle in die Stadt, Uln da in
Arbeit zu treten, so durfte er nicht frei an irgend eine Thüre
klopfen, und mit einem beliebigen Meister seines Gewerbes
wegen Aufnahme in dessen Werkstatt unterhandeln. Sein
erster Weg hatte die Herberge seines Handwerks zum Ziele,
wo der Zu sch ick ln ei ft er seines Amtes waltete und den
Arbeitswerber an jenen Meister wies, der zunächst zur Aust
Holländische (Delfter) Blumenvase.
(Um J700). Original im Schlößchen Favorite bei Rastatt. — Weiß, Zeichnung blau
mit schwärzlichen Umrissen. Höbe circa 22 cm.
nähme eines Gesellen befugt war. Der Austritt aus einer
Werkstätte nlußte in allen Ehren geschehen, sollte dem jungen
Handwerker nicht das Vorwärtskommen für immer ver-
ralnmclt fein; besonders forgsmil wurde darauf geachtet, daß
die Bursche keine Schulden zurücklassen; der „freie Durch-
;o. Persische Blumenvase.
3 gestattet. Diese Beschränkung zielte dahin, daß der junge
Mensch das Handwerk wirklich und tüchtig erlerne, was
aber gar selten der Fall
war, weil die ITTeifter den
Lehrling mehr in Rüche
und Rinderstube, als in
der Werkstätte verwenden
ließen; auch den Zunft-
gesetzen, welche die Bur-
schen nach der sozialen
Richtung schützten, die auf
Schläge Strafen setzten,
Rost, Nachtlager und
Behandlung genau vor-
schrieben, auch diesen
wurde manches Schnipp-
chen geschlagen.
War die Lehrzeit um,
so erfolgte nach einer
Prüfung des Lehrlings
dessen Freisprechung und
Ausnahme in den Ge-
(lü. Jahrhundert) Driginal in, Soutli-Aensington- selleil>tand. Die PrÜ
Museum, London. — weiß mit graugrüner , —
Bemalung; Höhe etwa 40 cm. | Un^S^QjCtCTlIOntC VCV^
mischte Ernst und Scherz
in der drolligsten, oft auch in der handgreiflich grausamsten
Weise, „Hast Du ordentlich ausgelernt?" fragte den Lehr-
ling einer der Meister. „Za", antwortete der Zunge. „Li,
ei! Schau Dich um unter diesen Meistern und Gesellen
— belehrte ihn der Alte — von all' diesen hat noch Reiner
ausgelernt, und Du willst schon ausgelernt haben?" —
Welch' weise Mahnung zur Bescheidenheit, zur rechten Zeit,
am rechten Orte! — Die Fragen wurden gewöhnlich so
gestellt, daß sie der arme Delinquent unmöglich beantworten
konnte, was aber nur zuin Ergötzen. diente und den Erfolg
der Prüfung nicht beeinflußte. Des Spaßes wegen gab es
oft Fragen, die ganz und gar nicht zur Sache gehörten, z. B.:
„Hast Du auch eine Mutter gehabt?" -— „Za!" — Darauf
bekam der Zunge, der richtig geantwortet zu haben glaubte,
eine Ohrfeige, die damals — trotz der Zunftgesetze — in
den Werkstätten häuflg klatschte, und dazu den Rommentar:
„Nein, Dummkopf, Deine Mutter hat Dich gehabt!" —
„Wie ist die Erbse auf die Welt gekommen?" fragte ein
witzig sein wollender Meister. Der Lehrling schwieg und
erhielt seine Ohrfeige. „Rund ist sie auf die Welt gekoinmen,
Du Esel!" — So ging es bei diesen Prüfungen zu. Nach
erfolgter Freisprechung, die unter ernsten Zeremonien vor sich
ging, kam der Humor noch in den guten Lehren zu Wort,
die der pathe den: neubackenen Gesellen auf die Wander-
schaft mitgab. Wenn z. B. der Geselle hungernd an eine
Mühle kommt, soll er eintreten und sprechen: „Guten Tag
Frau Mutter! Hat das Ralb auch Futter? Was macht der
Hund? Zft die Ratze gesund? Legen die Hühner viele Eier?
Haben die Töchter viele Freier?" — „Ei, — wird die
Müllerin sagen, — ein feiner Sohn, er bekümmert sich uni
mein Bieh und meine Töchter" — und mindestens eine fette
Rnackwurft wird die Höflichkeit lohnen. Zur Höflichkeit
wurden die jungen Gesellen überhaupt eifrig angehalten;
das war gewöhnlich der Tenor aller Mahnungen und War-
nungen. Unter den Merksprüchen der Meister an losge-
sprochene Lehrlinge befanden sich auch Rraft- und Pracht-
worte, deren manche sogar als Sprichwörter in Fleisch und
Blut des Volkes übergingen, so das vielgebrauchte: „Vor-
gethan und nachbedacht, hat Manchem schon viel Leid ge-
bracht". Sinnig und witzig, wie ein sorgsain gemeißeltes
Epigramm, klingt ein Spruch der Gptikerzunft:
„Gft fällt des Menschen Urtheil schief,
Als sähe man durch ein Perspektiv:
Die eigene Sünde wird verfemt,
Dreht man es so, daß es verkleint;
Doch kaum versieht der Nächste 'was,
Gleich guckt man durch's Vergrößerungsglas."
Der Geselle, der bei einem Meister einstand, hatte scholl
einen gewissen Antheil an den durch die Zunftgesetze ge-
regelten Rechten und Privilegien seines Standes und durfte
sich auch an den Versainmlungen betheiligen. Auch die
Gesellen hatten ihre Vereinigungen, Bruderschaften und Ge-
sellenschaften — diesem Worte eiltsprang unser Ausdruck
„Gesellschaft" —, hatten ihre eigenen Patrone, eigenen
Wappen und Fahnen, ihre eigenen Zechlokale, ganz unab-
hängig von den Zunftherbergen und Znnungshäusern, deren
jede Zunft in den größeren deutschen und österreichischen
Städten ihre eigeilen hatte; kenntlich ail dem Wappen, dessen
Zeichnuilg jedem Zuilftgenosseil bekannt war trotz ihrer Ver-
schiedenheit in den verschiedenen Städten. Zumeist waren
Znnungshaus und Herberge die ersten oder die größten Häuser
der Gassen, in denen — besonders hier zu Lande — die
Gewerbetreibeliden gleicher Art wohnteil und deren viele aus
jener Zeit noch ihre Namen bewahren.
Ram nun ein frenlder Geselle in die Stadt, Uln da in
Arbeit zu treten, so durfte er nicht frei an irgend eine Thüre
klopfen, und mit einem beliebigen Meister seines Gewerbes
wegen Aufnahme in dessen Werkstatt unterhandeln. Sein
erster Weg hatte die Herberge seines Handwerks zum Ziele,
wo der Zu sch ick ln ei ft er seines Amtes waltete und den
Arbeitswerber an jenen Meister wies, der zunächst zur Aust
Holländische (Delfter) Blumenvase.
(Um J700). Original im Schlößchen Favorite bei Rastatt. — Weiß, Zeichnung blau
mit schwärzlichen Umrissen. Höbe circa 22 cm.
nähme eines Gesellen befugt war. Der Austritt aus einer
Werkstätte nlußte in allen Ehren geschehen, sollte dem jungen
Handwerker nicht das Vorwärtskommen für immer ver-
ralnmclt fein; besonders forgsmil wurde darauf geachtet, daß
die Bursche keine Schulden zurücklassen; der „freie Durch-
;o. Persische Blumenvase.