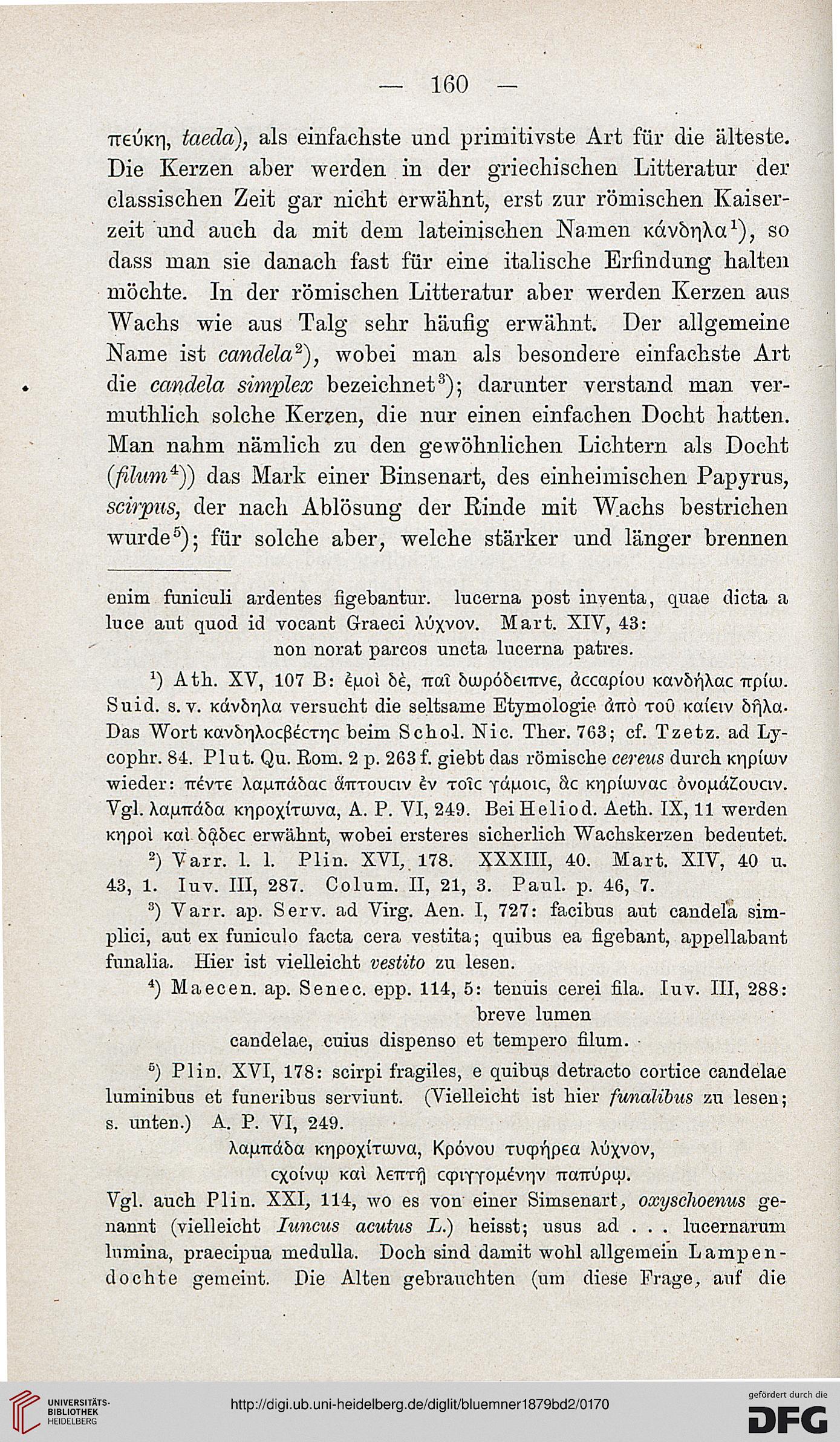— 160 -
ireuKn, taeäa), als einfachste und primitivste Art für die älteste.
Die Kerzen aber werden in der griechischen Litteratur der
classischen Zeit gar nicht erwähnt, erst zur römischen Kaiser-
zeit und auch da mit dem lateinischen Namen KdvbriXa1), so
dass man sie danach fast für eine italische Erfindung halten
möchte. In der römischen Litteratur aber werden Kerzen aus
Wachs wie aus Talg sehr häufig erwähnt. Der allgemeine
Name ist candela'2), wobei man als besondere einfachste Art
die candela simplex bezeichnet3); darunter verstand man ver-
muthlich solche Kerzen, die nur einen einfachen Docht hatten.
Man nahm nämlich zu den gewöhnlichen Lichtern als Docht
(filum1)) das Mark einer Binsenart, des einheimischen Papyrus,
scirpns, der nach Ablösung der Rinde mit Wachs bestrichen
wurde5); für solche aber, welche stärker und länger brennen
onim ftmiculi ardentes figebantur. luoerna post inyenta, quae dicta a
luce aut quod id vocant Graeci Xuxvov. Mart. XIV, 43:
non norat parcos uncta lucerna patres.
J) Ath. XV, 107 B: £uoi 6e, iraT bwpobemve, dccapiou Kavbr)Xac irpiui.
Suid. s.v. KdvbnXa versucht die seltsame Etymologie Coro tou Kaieiv brjXa-
Das Wort KavbnXocßecTnc beim Schol. Nie. Ther. 763; cf. Tzetz. ad Ly-
eophr. 84. Plut. Qu. Rom. 2 p. 263 f. giebt das römische cereus durch Knpioiv
wieder: irevxe Xauirdbac ötttouciv £v toic Yauoic, Sc Kupiiuvac övo|ad£ouav.
Vgl. Xauxraba Knpoxrrujva, A. P. VI, 249. BeiHeliod. Aeth. IX, 11 werden
Knpoi Kai bäbec erwähnt, wobei ersteres sicherlich Wachskerzen bedeutet.
") Varr. 1. 1. Plin. XVI, 178. XXXIII, 40. Mart. XIV, 40 u.
43, 1. luv. III, 287. Colum. II, 21, 3. Paul. p. 46, 7.
3) Varr. ap. Serv. ad Virg. Aen. I, 727: faeibus aut candela sim-
plici, aut ex funiculo facta cera vestita; quibus ea figebant, appellabant
funalia. Hier ist vielleicht vestito zu lesen.
4) Maecen. ap. Senec. epp. 114, 5: tenuis cerei fila. luv. III, 288:
breve lumen
candelae, cuius dispenso et tempero filum. ■
6) Plin. XVI, 178: scirpi fragiles, e quibus detracto cortice candelae
luminibus et funeribus serviunt. (Vielleicht ist hier funalibus zu lesen;
s. unten.) A. P. VI, 249.
Xaimöbcc KnpoxiTUJva, Kpövou Ti)cpr]pea Xuxvov,
cxoivuj Kai XeuTf) ccprn"ou£vi-|v irormjpai.
Vgl. auch Plin. XXI, 114, wo es von einer Simsenart, oxyschoenus ge-
nannt (vielleicht luneus acutus L.) heisst; usus ad . . . lucernarivm
lumina, praeeipua medulla. Doch sind damit wohl allgemein Lampen-
dochte gemeint. Die Alten gebrauchten (um diese Frage, auf die
ireuKn, taeäa), als einfachste und primitivste Art für die älteste.
Die Kerzen aber werden in der griechischen Litteratur der
classischen Zeit gar nicht erwähnt, erst zur römischen Kaiser-
zeit und auch da mit dem lateinischen Namen KdvbriXa1), so
dass man sie danach fast für eine italische Erfindung halten
möchte. In der römischen Litteratur aber werden Kerzen aus
Wachs wie aus Talg sehr häufig erwähnt. Der allgemeine
Name ist candela'2), wobei man als besondere einfachste Art
die candela simplex bezeichnet3); darunter verstand man ver-
muthlich solche Kerzen, die nur einen einfachen Docht hatten.
Man nahm nämlich zu den gewöhnlichen Lichtern als Docht
(filum1)) das Mark einer Binsenart, des einheimischen Papyrus,
scirpns, der nach Ablösung der Rinde mit Wachs bestrichen
wurde5); für solche aber, welche stärker und länger brennen
onim ftmiculi ardentes figebantur. luoerna post inyenta, quae dicta a
luce aut quod id vocant Graeci Xuxvov. Mart. XIV, 43:
non norat parcos uncta lucerna patres.
J) Ath. XV, 107 B: £uoi 6e, iraT bwpobemve, dccapiou Kavbr)Xac irpiui.
Suid. s.v. KdvbnXa versucht die seltsame Etymologie Coro tou Kaieiv brjXa-
Das Wort KavbnXocßecTnc beim Schol. Nie. Ther. 763; cf. Tzetz. ad Ly-
eophr. 84. Plut. Qu. Rom. 2 p. 263 f. giebt das römische cereus durch Knpioiv
wieder: irevxe Xauirdbac ötttouciv £v toic Yauoic, Sc Kupiiuvac övo|ad£ouav.
Vgl. Xauxraba Knpoxrrujva, A. P. VI, 249. BeiHeliod. Aeth. IX, 11 werden
Knpoi Kai bäbec erwähnt, wobei ersteres sicherlich Wachskerzen bedeutet.
") Varr. 1. 1. Plin. XVI, 178. XXXIII, 40. Mart. XIV, 40 u.
43, 1. luv. III, 287. Colum. II, 21, 3. Paul. p. 46, 7.
3) Varr. ap. Serv. ad Virg. Aen. I, 727: faeibus aut candela sim-
plici, aut ex funiculo facta cera vestita; quibus ea figebant, appellabant
funalia. Hier ist vielleicht vestito zu lesen.
4) Maecen. ap. Senec. epp. 114, 5: tenuis cerei fila. luv. III, 288:
breve lumen
candelae, cuius dispenso et tempero filum. ■
6) Plin. XVI, 178: scirpi fragiles, e quibus detracto cortice candelae
luminibus et funeribus serviunt. (Vielleicht ist hier funalibus zu lesen;
s. unten.) A. P. VI, 249.
Xaimöbcc KnpoxiTUJva, Kpövou Ti)cpr]pea Xuxvov,
cxoivuj Kai XeuTf) ccprn"ou£vi-|v irormjpai.
Vgl. auch Plin. XXI, 114, wo es von einer Simsenart, oxyschoenus ge-
nannt (vielleicht luneus acutus L.) heisst; usus ad . . . lucernarivm
lumina, praeeipua medulla. Doch sind damit wohl allgemein Lampen-
dochte gemeint. Die Alten gebrauchten (um diese Frage, auf die