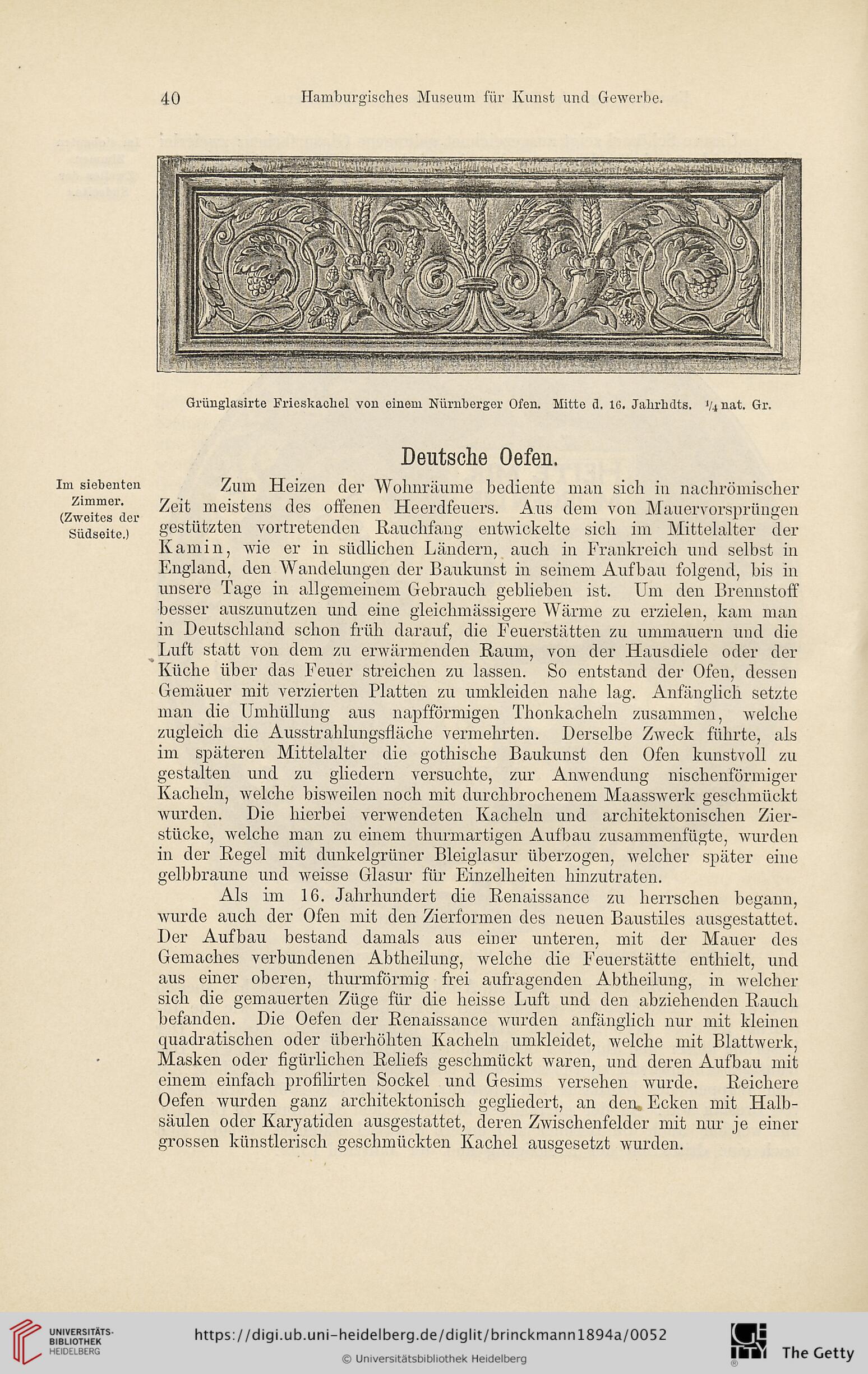40
Hamburgisches Museum für Kunst und Gewerbe.
Grünglasirte Frieskaehel von einem Nürnberger Ofen. Mitte d. 16. Jalirhdts. Vinat. Gr.
Deutsche Oefen.
Zum Heizen der Wohnräume bediente man sich in nachrömischer
Zeit meistens des offenen Heerdfeuers. Aus dem von Mauervorsprungen
gestützten vortretenden Rauchfang entwickelte sich im Mittelalter der
Kamin, wie er in südlichen Ländern, auch in Frankreich und selbst in
England, den Wandelungen der Baukunst in seinem Aufbau folgend, bis in
unsere Tage in allgemeinem Gebrauch geblieben ist. Um den Brennstoff
besser auszunutzen und eine gleichmässigere Wärme zu erzielen, kam man
in Deutschland schon früh darauf, die Feuerstätten zu ummauern und die
Luft statt von dem zu erwärmenden Raum, von der Hausdiele oder der
Küche über das Feuer streichen zu lassen. So entstand der Ofen, dessen
Gemäuer mit verzierten Blatten zu umkleiden nahe lag. Anfänglich setzte
man die Umhüllung aus napfförmigen Thonkacheln zusammen, welche
zugleich die Ausstrahlungsfläche vermehrten. Derselbe Zweck führte, als
im späteren Mittelalter die gothische Baukunst den Ofen kunstvoll zu
gestalten und zu gliedern versuchte, zur Anwendung nischenförmiger
Kacheln, welche bisweilen noch mit durchbrochenem Maasswerk geschmückt
wurden. Die hierbei verwendeten Kacheln und architektonischen Zier-
stücke, welche man zu einem thurmartigen Aufbau zusammenfügte, wurden
in der Regel mit dunkelgrüner Bleiglasur überzogen, welcher später eine
gelbbraune und weisse Glasur für Einzelheiten hinzutraten.
Als im 16. Jahrhundert die Renaissance zu herrschen begann,
wurde auch der Ofen mit den Zierformen des neuen Baustiles ausgestattet.
Der Aufbau bestand damals aus einer unteren, mit der Mauer des
Gemaches verbundenen Abtheilung, welche die Feuerstätte enthielt, und
aus einer oberen, thurmförmig frei aufragenden Abtheilung, in welcher
sich die gemauerten Züge für die heisse Luft und den abziehenden Rauch
befanden. Die Oefen der Renaissance wurden anfänglich nur mit kleinen
quadratischen oder überhöhten Kacheln umkleidet, welche mit Blattwerk,
Masken oder figürlichen Reliefs geschmückt waren, und deren Aufbau mit
einem einfach profilirten Sockel und Gesims versehen wurde. Reichere
Oefen wurden ganz architektonisch gegliedert, an den. Ecken mit Halb-
säulen oder Karyatiden ausgestattet, deren Zwischenfelder mit nur je einer-
grossen künstlerisch geschmückten Kachel ausgesetzt wurden.
Im siebenten
Zimmer.
(Zweites der
Südseite.)
Hamburgisches Museum für Kunst und Gewerbe.
Grünglasirte Frieskaehel von einem Nürnberger Ofen. Mitte d. 16. Jalirhdts. Vinat. Gr.
Deutsche Oefen.
Zum Heizen der Wohnräume bediente man sich in nachrömischer
Zeit meistens des offenen Heerdfeuers. Aus dem von Mauervorsprungen
gestützten vortretenden Rauchfang entwickelte sich im Mittelalter der
Kamin, wie er in südlichen Ländern, auch in Frankreich und selbst in
England, den Wandelungen der Baukunst in seinem Aufbau folgend, bis in
unsere Tage in allgemeinem Gebrauch geblieben ist. Um den Brennstoff
besser auszunutzen und eine gleichmässigere Wärme zu erzielen, kam man
in Deutschland schon früh darauf, die Feuerstätten zu ummauern und die
Luft statt von dem zu erwärmenden Raum, von der Hausdiele oder der
Küche über das Feuer streichen zu lassen. So entstand der Ofen, dessen
Gemäuer mit verzierten Blatten zu umkleiden nahe lag. Anfänglich setzte
man die Umhüllung aus napfförmigen Thonkacheln zusammen, welche
zugleich die Ausstrahlungsfläche vermehrten. Derselbe Zweck führte, als
im späteren Mittelalter die gothische Baukunst den Ofen kunstvoll zu
gestalten und zu gliedern versuchte, zur Anwendung nischenförmiger
Kacheln, welche bisweilen noch mit durchbrochenem Maasswerk geschmückt
wurden. Die hierbei verwendeten Kacheln und architektonischen Zier-
stücke, welche man zu einem thurmartigen Aufbau zusammenfügte, wurden
in der Regel mit dunkelgrüner Bleiglasur überzogen, welcher später eine
gelbbraune und weisse Glasur für Einzelheiten hinzutraten.
Als im 16. Jahrhundert die Renaissance zu herrschen begann,
wurde auch der Ofen mit den Zierformen des neuen Baustiles ausgestattet.
Der Aufbau bestand damals aus einer unteren, mit der Mauer des
Gemaches verbundenen Abtheilung, welche die Feuerstätte enthielt, und
aus einer oberen, thurmförmig frei aufragenden Abtheilung, in welcher
sich die gemauerten Züge für die heisse Luft und den abziehenden Rauch
befanden. Die Oefen der Renaissance wurden anfänglich nur mit kleinen
quadratischen oder überhöhten Kacheln umkleidet, welche mit Blattwerk,
Masken oder figürlichen Reliefs geschmückt waren, und deren Aufbau mit
einem einfach profilirten Sockel und Gesims versehen wurde. Reichere
Oefen wurden ganz architektonisch gegliedert, an den. Ecken mit Halb-
säulen oder Karyatiden ausgestattet, deren Zwischenfelder mit nur je einer-
grossen künstlerisch geschmückten Kachel ausgesetzt wurden.
Im siebenten
Zimmer.
(Zweites der
Südseite.)